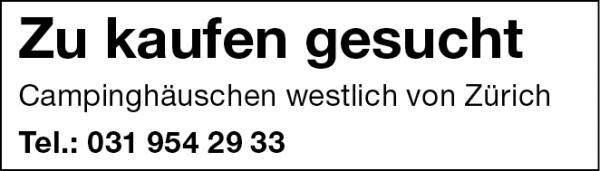Heini Hofmann
Ursprünglich gehörten die «schönhalsigen Ruderer», wie sie der deutsche Dichter Rudolf Alexander Schröder nannte, nicht zu den einheimischen Vogelarten. Es waren wohl Ästheten, die den Höckerschwan in seinem anmutigen Jugendstil-Gewand auf unseren Gewässern ansiedelten – analog der beliebten Anschaffung der rosaroten, hochbeinigen Schönhälse namens Flamingos in den Tiergärten. Doch heute ist Fremdling Schwan mit seiner weissen Weste an die hiesige Umgebung angepasst und gehört genauso zu den Schweizer Seen und Flüssen wie Enten, Haubentaucher oder Blässhühner.
Die vornehmen Gänse
Als klein Hansli vom Bauerndorf zusammen mit den Eltern erstmals an die Gestade eines Sees gekommen war, meinte er angesichts der dort majestätisch dahinsegelnden Schwäne: «Schau Vater, da hat es auch Gänse!», worauf der Stammesälteste den kleinen Naseweis überlegen lächelnd korrigierte: «Hansli, das sind doch keine Gänse, das sind Schwäne!». Und die Moral von der Geschicht’: Recht hatte auch der kleine Wicht! Denn die stolzen Schönhälse namens Schwäne sind – zoologisch betrachtet – nichts weiter als Gänse, wenn auch zugegebenermassen deren High-Society.
Dies hinderte Heinrich Heine nicht, den Umstand, dass sich Göttervater Zeus seiner geliebten Leda in Schwanengestalt näherte, zoologisch-sarkastisch zu kommentieren, indem er Leda rügt: «Welch’ eine Gans bist du gewesen, dass ein Schwan dich konnt betören!». Doch was Heine nicht bedachte und die schöne Leda halbwegs entschuldigt: Die Verführung geschah an Land. Was das bedeutet? Ferenc Molnar sagt es in seinem Lustspiel «Der Schwan», wenn er postuliert: «Schwäne sollten immer majestätisch in der Mitte des Wassers bleiben; denn sie sehen an Land wie Gänse aus.»
Eingebürgert und verwildert
Die Ansiedlung von ursprünglich in Mitteleuopa nicht heimischen Höckerschwänen aus Nordosteuropa und Kleinasien reicht bis ins 16. und 17., in England gar ins 13. Jahrhundert zurück. Die erste Schwanenansiedlung in der Schweiz geschah 1690 in Luzern; doch der eigentliche Boom erfolgte dann erst im 19. und bis ins 20. Jahrhundert hinein.
Der schneeweisse, wohlgeformte und majestätisch schwimmende Wasservogel diente vorerst zur verzierenden Belebung verträumter Weiher in Landgut-, Schloss- und Stadtpärken. Von hier fand er den Weg in träge Fliessgewässer, gestaute Flussstrecken und schliesslich auf Seen.
Kurz: Bei den Schwänen in ganz Mitteleuropa handelt es sich praktisch durchwegs um mehr oder weniger verwilderte Nachkommen von Parkschwänen. Während die Höckerschwäne im kontinentalen Bereich ihres Verbreitungsgebiets Zugvögel sind, gelten sie in Europa als Stand- und Strichvögel; ein Umherstreichen im Frühjahr und Herbst ist hauptsächlich nahrungsbedingt.
Seit wann auf Schweizer Seen?
Wann der Höckerschwan auf welchen Schweizer Seen angesiedelt wurde, ist nicht in allen Fällen eruierbar: Auf dem Genfersee war es 1837, woraus sich die erste Schweizer Kolonie entwickelte, auf dem Neuenburgersee ebenfalls 1837, auf dem Bodensee 1885, auf dem Thunersee 1889 und auf dem Zürichsee 1929. Bei anderen fehlt eine genaue Angabe, so auch für den Bieler- und Murtensee.
Ein indirekter Hinweis bezüglich Bielersee ergibt sich aus dem Jahr 1897, dem Gründungsdatum der Schwanenkolonie an der Schüss. Ab diesem Zeitpunkt, wenn nicht schon früher, waren Höckerschwäne somit wohl auch auf dem Bielersee vertreten.
Heute findet man den weissen Langhals auf vielen grossen und kleinen Seen, meist auf Höhen bis zu 600 Meter über Meer, gelegentlich bis auf 1000 Meter über Meer, in den Alpen sogar bis über 1700 Meter über Meer. So früher im Bündnerland auf den Seen von Arosa und St. Moritz. Allerdings mussten Schwäne auf solcher Höhe im Winter wegen vereistem Wasser abwandern oder eingefangen und anderswo überwintert werden, so wurden beispielsweise die Tiere von St. Moritz an den Bodensee gebracht.
Auf Schweizer Gewässern tummeln sich heute über 7000 Tiere, während es Mitte letztes Jahrhundert erst deren 2000 waren. Allerdings befinden sich darunter nur etwa 600 Brutpaare; die übrigen sind noch nicht fortpflanzungsfähige Jungtiere, alte Einzelgänger sowie Paare, die kein Brutrevier erobern konnten. Die stärksten Höckerschwan-Populationen finden sich auf dem Bodensee, dem Neuenburgersee und dem Genfersee, das heisst, auf den drei grössten Seen der Schweiz. Zum Vergleich: In ganz West- und Mitteleuropa leben momentan knapp 200 000 Höckerschwäne.
Von halbwild bis zahm
Schwäne haben keine natürlichen Feinde und sind jagdlich bedeutungslos. Deshalb, und auch weil sie sich im Sommerhalbjahr wegen der Überdüngung unserer Gewässer reichlich ernähren und zudem das Winterhalbjahr dank ihrer Robustheit gut überdauern können, gedeihen die Schönhälse derart munter, dass sie zu einem ökologischen Problem werden können.
Allerdings pflegen nicht alle dasselbe Verhältnis zum Menschen und gehen deshalb auf unterschiedliche Distanz: Während die halbwilden Schwäne nährstoffreiche Gewässer mit seichten Ufern, dichtem Unterwasserpflanzengürtel, ausgedehnter Verlandungszone und breitem Schilfgürtel bevorzugen, halten sich die zahmen und somit vom Menschen abhängigen Langhälse gerne an besiedelten Gestaden auf, bis hinein in Städte, wo sie sich auch nicht scheuen, vor aller Augen zu brüten.
Der namengebende Höcker
Die schönhalsigen Tiere gleiten, weissen Papierschiffen gleich, majestätisch und lautlos über das Wasser, den Schwanz leicht angehoben und den Hals anmutig gebogen, mit leicht abwärts weisendem Schnabel. Fast könnte man meinen, die «stolzen» Gesellen wüssten um ihre Schönheit. Ihre «saubere Weste», das schneeweisse Gefieder, dominiert die Gesamterscheinung der imposanten Schwimmvögel, pointiert durch einige auffallende Attribute.
Der orangerote Schnabel, der mit feinen Hornlamellen versehen ist, die ein Herausfiltern der Nahrung aus dem Wasser ermöglichen, ist ein Mehrzweckinstrument, das sowohl zum Fressen wie zum Putzen und Verteilen des Bürzeldrüsensekrets, ja sogar zum Eierwenden, dient. Am Schnabelgrund sitzt ein mehr oder weniger grosser, schwarz gefärbter Höcker, der dem Tier den Namen gibt; er ist beim Männchen – zumal in der Brutzeit – stärker ausgebildet als beim Weibchen, das sich auch sonst, mit Ausnahme vielleicht der Körpergrösse, kaum vom männlichen Partner unterscheidet.
Maskenhaft wirken die «Zügel» am Kopf des weissen Tieres. Gemeint sind nicht jene, die der Held der Gralssage in Richard Wagners Oper «Lohengrin» in Händen hält, wenn er auf Geheiss des Königs Artus in einem von einem Schwan gezogenen Nachen der bedrängten Herzogin Elsa von Brabant zu Hilfe eilt, sondern die – wie der Höcker ebenfalls schwarzen – unbefiederten Partien seitlich am Kopf, die sich nach hinten bis zu den nussbraunen Augen verjüngen.
Die «Unveränderlichen»
Beine und Ruderfüsse der erwachsenen Schwäne schliesslich sind von grau-schwarzer Farbe, und die Zehen zwei bis vier sind durch Schwimmhäute verbunden, wie das für alle Gänseartigen typisch ist, zu welcher Ordnung neben Gänsen, Enten und Sägern auch die Schwäne gehören. Das Jugendkleid der Schönhälse ist braun, im Übergang zur Adultfärbung scheckig, weil dann die weissen Federbasen sichtbar werden. Seit wenigen Jahrzehnten beobachtet man bei den halbdomestizierten Schwänen unter Jungtieren gelegentlich ein bereits im Jugendkleid reinweiss gefärbtes Individuum.
Dabei handelt es sich um eine streng alternativ vererbte Mutante, bedingt durch ein rezessives Gen im Geschlechtschromosom. Man nennt solche Tiere «Unveränderliche» (immutabilis), oder, weil diese Spielerei der Natur zuerst in Polen gesehen wurde, auch «Polenschwäne». Ihre Beine und Füsse bleiben zeitlebens fleischfarben. Genaueres weiss man nicht. Vermutet wird, dass diese «unveränderlichen» Jungschwäne, weil sie kein Jugendkleid tragen, das bei älteren Artgenossen schonendere Behandlung auslösen würde, einem stärkeren Selektionsdruck ausgesetzt sind.
Tierliches Tragflügelboot
Schwäne sind, obschon wir Menschen sie meistens am Tag zu sehen pflegen, sowohl tag- als auch nachtaktiv. Während Jungschwäne bei Gefahr auf Tauchstation gehen, tun dies ältere nicht. Denn erwachsen sind sie so etwas wie die Alphatiere unter dem Wassergeflügel, und als solche geziemt es sich nicht, feige die Flossen zu klopfen.
Im Gegenteil, man stellt sich mit Droh- und Imponiergebaren der Gefahr: Angriff oder Imponierschwimmen erfolgt mit S-förmig zurückgelegtem Hals, angehobenen Ellenbogen, sodass sich die Flügel weissen Segeln gleich über den Rücken wölben, unter gereiztem Zischen und – besonders imposant – mit schäumender Bugwelle. Dabei schiesst das tierliche Tragflügelboot ruckartig vor, weil in solch dringenden Fällen mit beiden Füssen gleichzeitig gerudert wird.
Fressen nach Entenmanier
Einen grossen Teil der Nahrung holen sich die Schwäne schnatternd von der Wasseroberfläche. Durch Eintauchen des langen Halses, durch Gründeln oder im Extremfall gar Kopfstehen können Wasserpflanzen abgeweidet werden. Über den Wasserspiegel ragende Pflanzen oder Gräser auf dem Festland werden nicht nach Gänseart seitlich abgebissen, sondern nach Entenmanier abgerupft.
Um die im untiefen Seegrund verborgenen Kleintiere oder oberflächlichen Pflanzensprossen zu erreichen, bedienen sich die Schwäne eines Tricks: Mit paddelnden Ruderbewegungen der Füsse wühlen sie den Grund auf, um danach den Filtrierschnabel in Aktion zu setzen. Jungschwäne können – als Nestflüchter – sogleich selbstständig fressen; von den Alttieren werden sie lediglich in gute Futtergründe geführt.
35 Tage Brutzeit
Schwanenpaare verhalten sich zur Brutzeit territorial, im Winter dagegen sind sie gesellig. Während Wildschwäne meist grosse Territorien beanspruchen – bis zu einem Kilometer, wobei es an günstigen Brutplätzen selten auch kolonieartige Konzentrationen geben kann –, begnügen sich halbwilde und zahme Höckerschwäne mit wesentlich kleineren Territorien. Nur gelegentlich liegen zwei Nester nahe beieinander. Nichtbrütende Schönhälse finden sich in Gruppen zusammen.
Verwilderte Höckerschwäne pflegen ihr Nest in ufernahen Biotopen zu bauen, mit einer Zugangsschneise vom Wasser her. Halbzahme Artvertreter sind da weniger wählerisch; zwar achten auch sie auf Wassernähe, jedoch nicht besonders auf Deckung – sogar Flosse sind ihnen genehm und auch ein naher Uferweg stört sie nicht.
Der Nestbau setzt frühestens im Februar ein, meist jedoch später. Gewöhnlich beginnt die Schwanenfrau im April zu legen: fünf bis sieben (manchmal gar neun) grosse, graugrüne Eier, die im Verlauf des Brütens, das 35 Tage dauert, schmutzig-braungelb werden. Der Bruterfolg liegt allerdings kaum über 50 Prozent.
Kinderliebe – Kindstötung
Den Brutbereich verteidigt der Schwanenmann kompromisslos. Sind die grauen Daunenjungen geschlüpft, werden sie von den Eltern betreut, wobei die Mutter gewöhnlich an der Spitze des Schwimmzügleins führt, während der Vater überwachend hinterher schwimmt. Fürsorgend werden der Jungmannschaft von den Altvögeln Gräser abgerupft und Wasserpflanzen ausgerissen. Kleine Schwanenkinder dürfen gelegentlich – wohl meist bei Mama – nach Haubentaucherart auf dem Rücken mitreiten.
Um die eigenen Jungen kümmern sich die Schwaneneltern wunderbar; fremde dagegen werden oft kaltblütig durch Flügelhiebe und Ertränken umgebracht. Dies ist die Kehrseite der Schwanenromantik, die von harten Naturgesetzen bestimmt wird.
Doch zurück zur Familienidylle; sie dauert bis in den Winter hinein. Dann, beim Wiedererwachen des Bruttriebs, geben die Altvögel den Jungschwänen den Lauf- oder besser gesagt den Schwimmpass. Nun müssen sie sich selbst durchschlagen. Und wenn sie – gewöhnlich mit drei Jahren – geschlechtsreif geworden sind, beginnt der Reigen von vorn.
Ganze 25 Halswirbel
An Land ruht der Höckerschwan liegend oder stehend; im Wasser lässt er sich treiben. Beim Schlafen wird der Schnabel nicht unter den Flügel, sondern unter das Schultergefieder gesteckt. Dabei wird oft ein Bein rückwärts angehoben. Wenn sich ein Schwan putzt, imponiert die extreme Geschmeidigkeit seines Halses, beruhend auf der stolzen Zahl von 25 Wirbeln (kein anderer Vogel hat mehr) und einer genial koordinierten Muskulatur.
Das Sich-Putzen, das an Land wesentlich länger dauert als im Wasser, besteht aus einem vielschichtigen Zeremoniell: Schwanzwedeln, Kopf-Halsreiben, Sich-Flügeln, Putzknabbern, Gefiederglätten, Schnabeleintauchen, Schnabelschleudern, Kopfkratzen, Kopfschütteln, Streckschütteln, Federndurchziehen, erneut Kopfschütteln, Flügelwinkeln – und dann wieder Schwanzwedeln. Wer weiss trägt, putzt länger.
Dissonanter Schwanengesang
Das Thema Höckerschwan ist in den letzten Jahren zum ökologischen Schwanengesang mit Dissonanzen mutiert. Denn der Homo sapiens ist rasch und gerne bereit zu glauben, dass es ohne ihn nicht geht – so auch beim «Schwanenproblem», das tatsächlich eines ist, jedoch vornehmlich ein hausgemachtes. Und ebenso vorschnell greifen wir zu Vorurteilen und machen unüberprüfte Hypothesen zu Wahrheiten.
Zum Beispiel die falsche Behauptung, der Schwan konkurrenziere die anderen pflanzenfressenden Wasservogelarten wie Tauchenten und Blässhühner. In Tat und Wahrheit richtet sich die Unterwasserweide nach der Halslänge: Gründelnde Enten nutzen die ufernahe Flachwasserzone, während der Schwan – seinem Langhals entsprechend – Unterwasserschichten zwischen 30 und 120 cm bevorzugt. Das universale Blässhuhn dagegen kann metertief tauchen und somit konkurrenzlose Unterwasserweiden in Beschlag nehmen.
Ein anderes, unüberlegtes Dogma ist die Behauptung, ohne menschliches Eingreifen (Dezimieren der Schwanengelege beispielsweise durch Anstechen der Eier) würden sich die Langhälse grenzenlos vermehren. Dagegen spricht bereits ihr strenges Territorialprinzip. Zudem wird durch solches Management die Zahl der brütenden Paare nicht reduziert, wohl aber das bewährte, natürliche Ausleseprinzip gestört und damit der Überbevölkerung Vorschub geleistet.
Vertierlichte Menschlichkeit
Mehr noch: Durch gut gemeinte Tierliebe im Sinne vertierlichter Menschlichkeit – sprich: übertriebene Winterfütterung – verhilft der Mensch dem «Schwanenproblem» erst recht zum Durchbruch.
Dies führt zu Massierungen auf kleinen Gewässern und Überdüngung derselben durch grosse Kotmengen. Dieser künstlich erzeugte Populationsüberdruck ist mitverantwortlich für den zunehmenden Weidegang von Schwänen auf gewässerangrenzendem Acker- und Wiesland. Die Folge: zertretene Jungpflanzen, abgefressene Sprösslinge von Wintergetreide und Verkotung der Grasnarbe und damit auch des Viehfutters.
Natürlich ist es nicht bloss die menschliche Winterhilfe, die durch Reduktion der natürlichen Mortalität den Schwanensegen vergrössert, sondern auch die – durch indirekte Menscheinwirkung hervorgerufene – Eutrophierung vieler Seen, die das Nahrungsangebot multipliziert (typischerweise zeichnen sich weniger belastete Seen mit relativ steilen Ufern durch geringere Schwanendichte als agglomerationsbeeinflusste Gewässer aus).
Weil überdies – nebst dem Fehlen natürlicher Feinde – ein Überfluten der Nester dank Seespiegelregulierungen dahinfällt, greift der Mensch in seiner Hilflosigkeit zum nur bedingt tauglichen Mittel bestandesregulatorischer Massnahmen, also Eierstechen und Hegeabschüsse – und bleibt dabei alleweil Zauberlehrling.
Am effizientesten wäre rigorose Zurückhaltung bei der Winterfütterung und die Einsicht, dass die Natur eigene Regulationsmechanismen beherrscht.