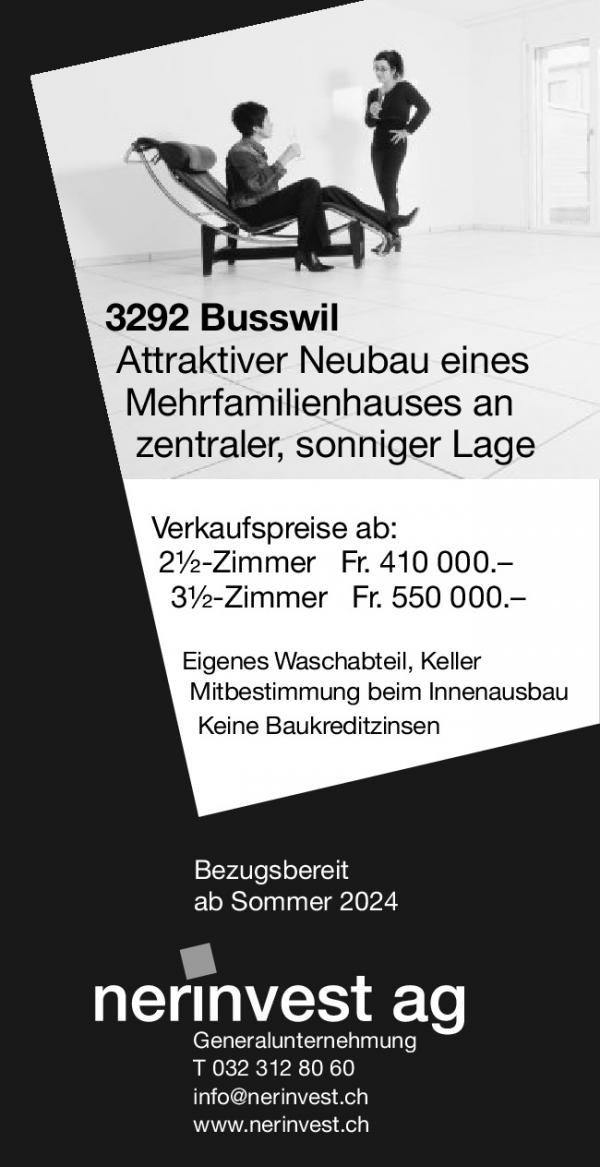- Dossier
Aufgezeichnet: Mengia Spahr
Ich könnte mir gut vorstellen, einmal in der Rehabilitation zu arbeiten. Dort macht man eine sogenannte Langzeitpflege. Man begleitet Personen während der Genesung nach einer Krankheit oder einem Unfall. Wenn der Patient oder die Patientin plötzlich hilfsbedürftig ist, ist dies oft eine pure Überforderung. Als Pflegender tritt man ins Leben der Betroffenen, wenn für sie alles schlimm ist, und unterstützt sie, bis es wieder besser geht. Da machen kleine Dinge viel aus. Man merkt: Leben ist das Wichtigste. Wobei das natürlich eine schwierige Aussage ist, denn es wird wohl manchmal zu viel gemacht, um Leben zu erhalten.
Ich habe diesen Herbst die Ausbildung zur Pflegefachperson am Bildungszentrum Pflege in Bern begonnen. Während drei Jahren habe ich abwechselnd sechs Monate Schule und sechs Monate Praktikum. Zurzeit bin ich in der Schulphase. Daneben helfe ich einem Mann, der im Rollstuhl sitzt. Das ist jedoch nur ein kleiner Nebenjob, denn neben dem Studium ist es nicht erlaubt, mehr als acht Stunden pro Woche zu arbeiten. Während der Ausbildung hat man einen geringen Lohn. Ich hatte Glück und konnte für die Praktika einen Vertrag mit einem Betrieb abschliessen. Deshalb verdiene ich etwas mehr als die meisten anderen Studierenden. Das ist praktisch, denn ich bin mit meinen 25 Jahren auch schon etwas älter und muss selbst für meinen Lebensunterhalt aufkommen.
Als es darum ging, einen Beruf zu erlernen, schnupperte ich als Schreiner, Elektrotechniker und Kleinkindererzieher – alles interessierte mich. Ich machte dann eine Ausbildung zum Automatiker und erlangte die technische Berufsmatur. Nach der Lehre blieb ich bei der Firma, begann ein Elektrotechnik-Studium und da wurde mir schnell bewusst, dass ich etwas anderes suche. Die Arbeit machte mir zwar Spass, aber mir fehlte das Menschliche. Ich hatte zwischenzeitlich im Zivildienst mit beeinträchtigten Personen gearbeitet. Das gefiel mir.
Ausschlaggebend für einen Wechsel war auch der Tod meines Vaters vor zwei Jahren. Ich war zuvor mit ihm und meiner Schwester während eines Monats in Indien. Mein Vater machte dort eine Therapie und wurde dabei von einem Physiotherapeuten begleitet. Das faszinierte mich extrem – und ich entschied, dass ich Physiotherapie studieren möchte. Im Frühling 2020 kündigte ich meine Stelle, um mich auf das Aufnahmeverfahren zu konzentrieren. Doch ich bestand die Prüfung nicht. Eine Pflege-Ausbildung war meine zweite Wahl. Im Zivildienst und in Praktika sammelte ich weitere Erfahrungen in diesem Bereich, bevor ich das Studium begann.
In meiner Klasse sind wir 38, davon sechs Männer. Das sei ein relativ hoher Anteil, sagt man. Bei der Ausbildung zum Automatiker war es genau umgekehrt: Es hatte nur eine Frau.
Mein Umfeld hat es nicht überrascht, dass ich eine Pflegeausbildung in Angriff nehme. Mein bester Kollege ist selber Pflegefachmann und meine beste Kollegin studiert Sozialpädagogik. Auch in meiner Familie sind viele im sozialen Bereich tätig. Wir haben eine soziale Ader. Mit der Technik fiel ich etwas aus dem Rahmen.
In der Pflege gibt es sicher immer wieder Phasen, in denen man unter Druck steht. Während der Praktika habe ich das noch nicht so erlebt. Aber ich habe auch gemerkt, dass man sich manchmal weniger Zeit nehmen kann als man möchte. Im Paraplegikerzentrum in Nottwil zum Beispiel, gab es eine schwer erkrankte Frau, die eine sehr aufwendige Pflege benötigte. Andere Patienten kamen deshalb etwas zu kurz. Andererseits wurde die betroffene Patientin zwar lange gepflegt, hatte aber sonst wenig Austausch. Als Praktikant konnte ich ab und zu mit ihr ein Gespräch führen oder ein Spiel spielen. Oft fehlen aber die Ressourcen dafür. Dabei ist die psychische Pflege auch extrem wichtig.
Den Spitalalltag habe ich noch nicht wirklich erlebt, aber dort gehen die Wechsel so schnell, dass man nicht alles tun kann, was man sollte und möchte. In unangenehmen Situation versucht man das Beste für den Patienten zu machen. Man muss die Menschen so akzeptieren, wie sie sind und auf sie eingehen. Ich denke, das ist etwas, was ich gut kann. Ein wenig habe ich wohl ein Helfersyndrom. In dem Beruf kann dies gefährlich sein, aber ich habe festgestellt, dass ich mich gut abgrenzen kann. Ich kann zu Hause abschalten. Es ist mir wichtig, meine Grenzen nicht zu überschreiten. In einem Praktikum konnte ich einmal nicht mehr. Ein Patient machte mir so viele Vorwürfe, dass ich innerlich extrem unruhig wurde. Ich verliess den Raum, ohne etwas zu sagen und holte jemanden, um mich abzulösen. In solchen Situationen hilft es mir wohl, dass ich schon etwas älter bin: Ich kann vieles einstecken und erst einmal auf mich wirken lasse, bevor ich handle und reagiere.
Man weiss ja, dass viele Pflegende den Beruf frühzeitig verlassen. Ich habe mich schon auch gefragt, weshalb ich mir das antue. Andererseits: Viele, die aufhören, haben sich wohl nach der Schule für eine Lehre in der Pflege entschieden. Ich verstehe gut, wenn man so jung noch nicht weiss, was zu einem passt.
Wegen der Coronapandemie sind die Pflegenden natürlich zum grossen Thema geworden. Es ist aber nicht so, dass ich mich für den Beruf entschieden habe, um einem Pflegenotstand entgegenzuwirken. Ich kann einfach gut mit Menschen. Es gibt mir Energie, wenn ich mit Menschen arbeite, für sie da sein kann. Im Zivildienst habe ich damals Kontakte mit beeinträchtigten Personen geknüpft und einer aus der Gruppe fragte mich diesen Sommer, ob ich ihn in die Ferien begleiten wolle. Das tat ich gerne.