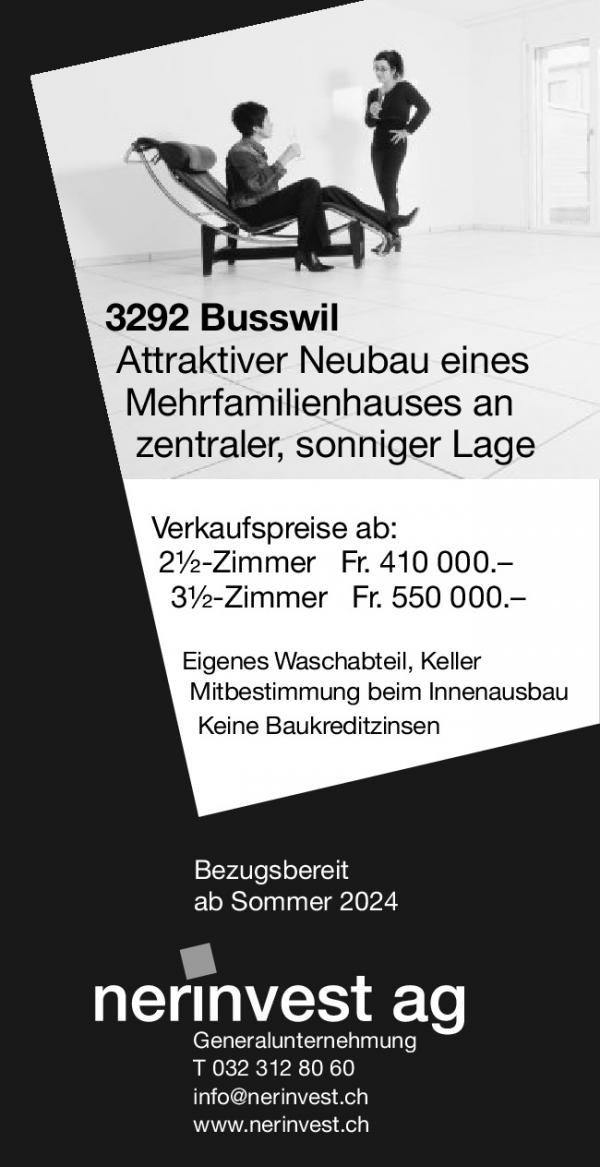- Dossier
Interview: Peter Staub
Jérôme Tschudi, Sie kamen vor ein paar Tagen aus Brasilien zurück. Hatten Sie bei der Ankunft in der Schweiz einen Kulturschock?
Jérôme Tschudi: Einen Kulturschock nicht, aber mir war kalt. Deshalb trage ich noch jetzt einen Pullover. Wir hatten vor dem Amazonas-Delta in Brasilien um 2 Uhr 28 Grad, am Tag wurde es noch wesentlich wärmer.
Die Temperaturen sind das Eine. Aber hier führen Sie auch wieder ein anderes Leben.
Das ist so. Das Leben an Bord war anstrengender, als ich erwartet hatte. Man hat zwar nicht übermässig viel gearbeitet, aber wir befanden uns in einer sehr rauen Gegend: Wir hatten bis zu drei Meter hohe Wellen. Da kämpfte ich den ganzen Tag ums Gleichgewicht. Das war wie eine riesige Power Plate, auf der wir ständig «herumgondelten». Man muss sich immer festhalten, man versucht ständig, das Gleichgewicht zu halten. Dazu kommt dann natürlich noch die Arbeit. Deshalb wurde ich jeweils sehr schnell müde.
Sie haben abgenommen.
Ja, vier Kilogramm sind weg. Ich habe genügend gegessen, aber die Anstrengungen waren doch grösser, als ich dachte. Eigentlich war geplant, dass ich zwei Wochen später nach Hause komme. Aber ich realisierte, dass ich mich länger erholen muss, bevor ich wieder als Chirurg arbeite. Nach der Rückkehr habe ich die ersten Tage vorwiegend geschlafen. Nun fahre ich in die Berge, um mich aktiv zu erholen.
Dass Sie vorzeitig abreisten, war kein Problem?
Nein, ich kündigte das frühzeitig an. Greenpeace organisierte einen Ersatz. In dieser Zeit sind auch keine wissenschaftlichen Expeditionen mehr geplant, sondern die Esperanza wird einheimischen Schulklassen gezeigt.
Sie sind zurückgeflogen. Hat Ihr Sold gereicht, um die CO2-Kompensation zu bezahlen?
Ich bezahlte auch den Flug selber. In meinem Tagebuch schrieb ich darüber, wie ich zum Arbeitsvertrag kam. Darin hiess es, dass man mir die Reisespesen zurückerstatte. Das schrieb ich vor allem, damit jüngere Interessierte wissen, wie das normalerweise läuft.
Sie waren acht Wochen unterwegs. Sind Sie als «neuer Mensch» zurückgekehrt?
Nein, das glaube ich nicht. Für mich hat sich nicht so viel verändert. Aber ich machte mir natürlich schon Gedanken; auf meinen Wachen hatte ich genügend Zeit dafür. Ich habe mich entschlossen, tatsächlich in einem Jahr, wenn ich 65 Jahre alt werde, die Pension anzutreten. Ich will nach 40 Jahren Medizin noch etwas anderes machen.
Nach dieser Erfahrung: Würden Sie wieder auf die Karriere als Chirurg setzen? Oder würden Sie eine Laufbahn als Umweltaktivist einschlagen, wenn Sie noch einmal 30 wären?
Die Umwelt war mir immer wichtig. Aber diese Frage stellte sich mir nie, weil ich diese Option nicht hatte. Bereits damals unterstützte ich Greenpeace, kannte aber die Arbeit auf den Schiffen nicht. Wenn man darauf als Arzt arbeiten will, ist es ein Vorteil, wenn man Allgemeinpraktiker ist, da man von psychologischen Problemen über Blutdruck bis Kreislaufprobleme alles antrifft. Als Notfall-Doktor in Biel machte ich das jahrelang, daher kannte ich diese Arbeit gut. Als Chirurg hatte ich drei Einsätze. Hier wäre ich als Nicht-Chirurg wohl ein wenig ins Schleudern geraten. Das Schiff ist medikamentös gut ausgerüstet, aber als Chirurg habe ich natürlich hohe Ansprüche: Wenn ich etwas mache, will ich gute Arbeit leisten.
Sie mussten selbst zum Zahnarzt. Was ist passiert?
Das war eine spezielle Erfahrung. Zuerst war es eine strategische Entscheidung. Ich hatte ein Problem mit einem gebrochenen Zahn, der sich zu entzünden begann. Und ich wollte nicht, dass ich deswegen den ganzen Betrieb lahmlege, falls die Schmerzen auf hoher See so stark werden sollten, dass ich an Land zurückmusste. Denn die Wissenschaftler hatten in dieser Phase nur eine Woche Zeit, um ihre Forschungen zu machen. Ein vermeidbarer Notfall hätte nicht ins Programm gepasst. Deshalb fuhr ich zur Zahnärztin, als das Schiff im Hafen lag. Diese hat mir den Zahn gut geflickt, aber die Umstände waren speziell. In der Praxis gab es nicht den Luxus, wie wir ihn in der Schweiz kennen.
Bei Landgängen haben Sie auch Erfahrungen mit der brasilianischen Realität gemacht.
Lustig war das nicht. Brasilien hat einen enormen Bevölkerungsdruck: Ein grosser Teil der Bevölkerung ist unter 20. Die Jugendlichen brauchen alle eine Ausbildung und danach eine Stelle. Das zweite Thema ist die Umwelt. Weil die Leute kein Geld haben, nehmen sie sich, was sie brauchen. Es gibt Leute, die in den Urwald gehen, um Tiere zu schiessen, die sie dann essen. Die Unterentwicklung sieht man auch auf den Strassen. Die Schlaglöcher werden teilweise mit Abfall gefüllt. Wenn man sieht, wie wenig Geld vorhanden ist und dann Touristen unterwegs sind, die zuviel Geld haben, versteht man, dass die Versuchung gross ist, den Touristen etwas abzunehmen.
Die Sicherheitsmassnahmen in den Häfen waren rigoros. Haben Sie sich da nicht wie in einem goldenen Käfig gefühlt?
Im Käfig auf jeden Fall, im goldenen aber nicht. Für uns war der Standard auf dem Schiff normal. Die Esperanza ist relativ einfach aber zweckmässig eingerichtet. Wir hatten eine Klimaanlage, die jedoch nicht ganz runterkühlte, aber wenn man statt 35 nur noch 26 Grad hatte, war das doch ein riesiger Unterschied.
Da dürfte auch die Luftfeuchtigkeit ein Thema gewesen sein.
Diese betrug gegen 100 Prozent. Im Gegensatz zu den Tropen, wo die Schweizer in die Ferien gehen, um Palmenstrände und blauen Himmel zu geniessen, hatte es bei uns praktisch immer Wolken. Und es regnete jeden Tag mehrfach und stark. Die Feuchtigkeit sorgte dafür, dass man sehr schnell schwitzte, man brauchte nur den kleinen Finger zu heben. Die Umweltbedingungen waren also nicht gerade paradiesisch.
Wie waren Sie untergebracht? Darüber haben Sie in Ihrem Tagebuch nichts geschrieben.
Am Anfang war ich in einer Kajüte mit vier Kojen. Als nach den drei Wochen Überfahrt die ersten Wissenschaftler an Bord kamen, erhielten wir eine Zweierkoje, da wir nachts Wache schoben und die Wissenschaftler bei den Schichtwechseln nicht wecken sollten.
Gab es da ein Waschbecken?
Die Toiletten und Duschen waren Gemeinschaftsanlagen für alle. In der Kajüte hatten wir ein kleines Waschbecken, wo wir uns waschen und die Zähne putzen konnten.
Sie erwähnten die Wachen. Wie war das, nachts alleine auf dem Boot unterwegs zu sein?
Das war nicht wahnsinnig herausfordernd. Im Hafen passten wir auf, dass keine Unbefugten aufs Schiff kamen. Wir hatten in Belem zwar einheimische Wachen, aber die waren nicht immer zuverlässig, sodass wir sie gelegentlich wecken mussten. Wir hatten aber auch sonst genug zu tun. Wir drehten regelmässig unsere Runden, um zu kontrollieren, ob alles in Ordnung war, was durchaus nicht immer der Fall war.
Sie waren auch als Hilfskraft tätig, haben aufgeräumt, geputzt und gestrichen. Wie war das für Sie, als hoch spezialisierter Arzt, solche sogenannt niedere Arbeiten auszuführen?
Als Arzt hatte ich höchstens zehn Prozent der Zeit zu tun. Da ich weder als Matrose noch sonst als Fachkraft qualifiziert war, blieb für mich nur unqualifizierte Arbeit, denn man kann an Bord niemanden brauchen, der nichts macht.
Haben Ihnen diese Tätigkeiten Spass gemacht?
Die Arbeit war nicht immer sehr erhebend. Aber für mich war das Erlebnis, Teil einer Mannschaft zu sein, wichtiger. Wäre ich bloss der Arzt gewesen, hätte ich mich zu Tode gelangweilt. So aber sah ich in alle Bereiche desSchiffes hinein und lernte die Leute besser kennen, da wir in den Pausen miteinander sprechen konnten. Auf mein Alter nahm man immer Rücksicht. Obwohl es auf dem Schiff keine leichten Arbeiten gab, versuchte man, mich so einzusetzen, dass ich mich nie verletzte. So erhielt ich immer den «Schoggi-Job», auch wenn der daraus bestand, das WC zu putzen.
Waren Sie trotzdem als vollwertiges Crewmitglied akzeptiert?
Ja, jeder arbeitete im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und ich war voll integriert. Das war ein fantastisches Erlebnis, wie in einer Grossfamilie. Ich erhielt immer wieder kleine Komplimente, wie das in einem Betrieb nicht immer üblich ist.
Ihre Kollegen wussten, dass Sie ein Tagebuch publizierten?
Ja, die Kampagnenleute luden die Artikel teilweise runter, druckten sie aus und hängten sie auf. Wer Deutsch konnte, las die Tagebücher und reklamierte, wenn ein Artikel nicht vollständig ausgedruckt werden konnte.
Wie war das Feedback aus der Schweiz?
Erstaunlich gross. Nicht nur in Biel, sogar im Spital Burgdorf wurden die Artikel gelesen. Sogar mein Sohn wurde bei seiner Arbeit von Kunden auf meine Berichte angesprochen.
Sie haben immer wieder davon geschrieben, dass die Aktivisten Sie beeindruckt haben. Was war an ihnen besonders?
Ich bewundere alle Leute, die sich freiwillig einsetzen. Aber meine Kollegen auf dem Schiff hatten alle auch ein sehr grosses Herz, das beeindruckte mich. Sie engagieren sie sich auch für Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen. Ihre Einsätze leisten sie in der Regel für wenig Geld.
Hat sich Ihre Lebenseinstellung durch diese Expedition nun nachhaltig verändert?
Ich weiss nicht. Ich habe viele interessante Leute kennengelernt, von denen ich sehr viel gelernt habe. Ich brach aus dem medizinischen Umfeld aus, das einen ja sonst richtiggehend auffrisst. Jetzt öffnete ich mal ein Fenster und sah, was es sonst noch gibt. Ich werde mich in den nächsten Jahren sicher weiter als Freiwilliger engagieren. Wo mich das hinführt, kann ich noch nicht sagen. Ich könnte mir vorstellen, als Berichterstatter tätig zu sein. Als Matrose eher nicht mehr.