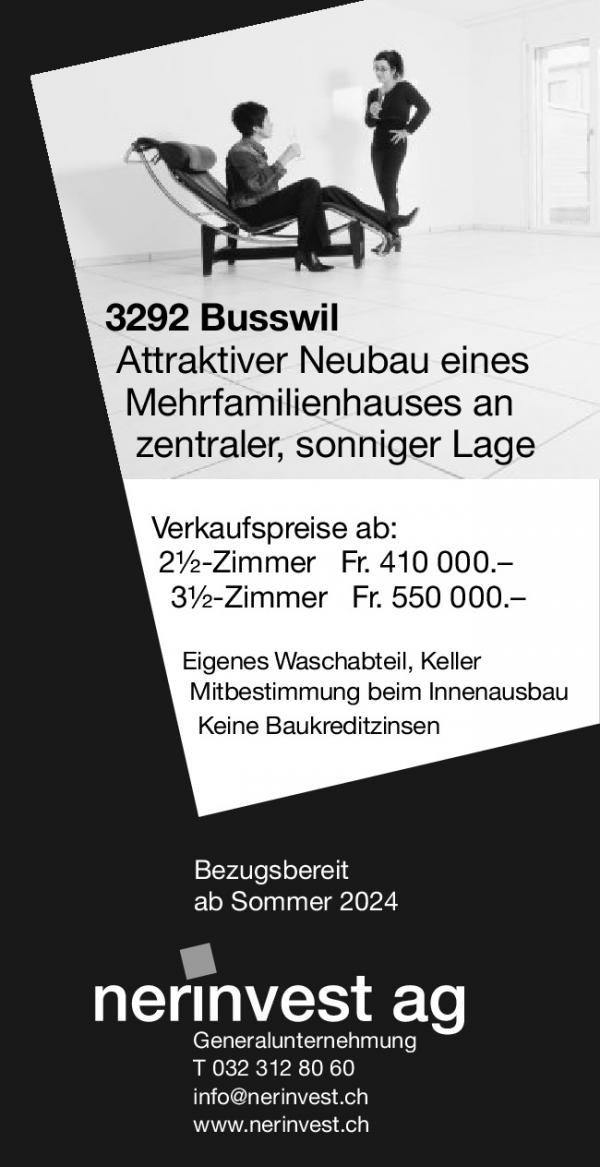- Dossier
Aufgezeichnet: Vanessa Naef
Gerade arbeite ich an einem Cello, es ist ein Spezialauftrag. Daneben bin ich an einer neuen Geige. Dass ich gleichzeitig zwei neue Instrumente bauen kann, ist schön, aber eher eine Ausnahme.
Es geht mit einem massiven Stück Holz los. Gleich am Anfang kommt die Bandsäge zum Einsatz. Danach ist alles Handarbeit. Für fast jeden Handgriff gibt es ein eigenes Werkzeug. Dazu gehören Hobel in verschiedenen Grössen, der kleinste so schmal wie eine Fingerspitze. Mit einem Ausstecheisen forme ich die Wölbung ins Holz, und mit einer Ziehklinge verfeinere ich diese. Ich verleime die Zargen – also die Seiten – den Boden und den Hals aus Ahornholz miteinander. Die Decke wiederum ist aus Fichte.
Den Lack trage ich Schicht für Schicht mit dem Pinsel auf. Für den charakteristischen braun-rötlichen Farbton mische ich Farbe in den Lack. Viele Arbeitsschritte sind nötig, bis ein neues Instrument seine ersten Töne von sich geben kann. Wie das Instrument klingt, offenbart sich erst ganz am Schluss, wenn ich die Saiten aufziehe. Vorher hat man lediglich eine Idee davon. Schätzungsweise 400 Stunden werde ich insgesamt für dieses Cello aufwenden.
Die Leute haben oft eine romantische Vorstellung vom Geigenbau. Sie denken an den Neubau von Geigen, Bratschen und Celli. Doch meistens repariere ich Instrumente und mache Servicearbeiten. Fleissige Geigenspieler lassen den Bogen jährlich frisch behaaren. Ausserdem vermiete ich Instrumente – das ist mein einziges regelmässiges Einkommen.
Eine Geige kann Jahrhunderte alt werden. Das finde ich faszinierend, es steckt eine Menge Geschichte darin. Entsprechend setzt man alles daran, ein wertvolles Instrument wie zum Beispiel eine Stradivari wieder zu reparieren. Bei grossen Restaurationen mache ich einen Gipsabdruck.
Es ist gut, ein selbst gebautes Modell vor Ort zu haben – deshalb mache ich manchmal ohne Auftrag eine Geige. Die Kundschaft muss der Geigenbauerin vertrauen. Sie geben einen Auftrag, ohne genau zu wissen, was herauskommt. Eigentlich wollen die Musizierenden das Instrument ausprobieren, den Klang hören und es spüren. Bei einem Neubau ist das nicht möglich, sie kennen vorher nur mich und ein anderes Instrument von mir.
Ich habe mit unterschiedlichen Menschen zu tun, von der dreijährigen «Suzuki-Schülerin» bis zum 97-Jährigen, der immer noch jeden Tag musiziert. Musikschulen bringen Schülerinnen, nicht nur aus Biel, sondern auch von weiter her wie Delémont oder Langenthal. Für das Geigenbauen braucht es Geduld. Und natürlich muss man feinmotorisch begabt sein. Ich finde, man kann es mit dem Zeichnen vergleichen – üben bringt einen weiter.
Dass man kaum mit Maschinen, sondern von Hand arbeitet, ist der Grund, warum ich diesen Beruf gewählt habe. Ich wollte mit Holz schaffen, aber nicht in einer Schreinerei. Heutzutage kann man fast nirgends mehr so viel von Hand herstellen. Ich denke, das ist, was die Leute am Geigenbau fasziniert.
Meine Werkstatt in der Altstadt von Biel ist eine Art «Aquarium». Durch das Schaufenster sehen die Leute in mein Atelier, wo ich auf wenigen Quadratmetern alles beherberge und arbeite. Viele Menschen bleiben stehen und schauen mir über die Schultern. Sie freuen sich spontan darüber. Das finde ich schön. Manchmal frage ich mich, was sie für ein Bild vom Geigenbauen haben. Wahrscheinlich finden sie es romantisch, weil es wirklich noch wie früher funktioniert.
Wie viele Geigenbauer bin ich quer in den Beruf eingestiegen. Nachdem ich das Abitur in München gemacht habe, habe ich ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht, das ist eine Art Zivildienst. Danach habe ich ein Kunststudium angefangen, aber gemerkt, dass das nicht passt. Ich wollte stattdessen etwas Konkretes tun. Also habe ich eine Geigenbauschule in Deutschland besucht. Einige wenige Betriebe bilden selbst aus. Doch die meisten sind Einzelkämpfer und schauen, dass sie es mit ihrem Geschäft schaffen. Die Ausbildung ist recht aufwendig. Die Plätze sind auch in Schulen rar: In der einzigen Schweizer Schule in Brienz sind es etwa zehn Personen, verteilt auf vier Lehrjahre.
Bevor ich 2013 selbstständig wurde, war ich fünf Jahre in Bern angestellt. Es braucht eine Weile, um sich zu etablieren, aber es läuft langsam richtig gut. Obwohl ich es überhaupt nicht so gemacht habe, wie man es machen müsste. Ich hatte keinen Businessplan, stand jahrelang nicht mal im Telefonbuch. Aber es hat funktioniert, gerade in einer Welt, wo viel von Mund zu Mund läuft.
In Biel gelandet bin ich der Liebe wegen. Mein Mann, ein Emmentaler, hat hier Violine studiert. Kennengelernt haben wir uns aber, als ich noch in Deutschland angestellt war. Er hat in unserem Betrieb einen Kurs für Barockmusik gegeben. Dann hat sich das mit uns ergeben – und wir sind natürlich eine gute Kombination. Wir musizieren gerne zusammen. Projektweise mache ich Kammermusik, im Moment übe ich für ein Passionskonzert. Neben der Geige spiele ich Barockgeige. Ihre Saiten sind aus Darm, wie früher. Ihr Ton ist weicher, und man kann klanglich mehr gestalten. Sie kommt heute vor allem in der historischen Aufführungspraxis zum Einsatz. Das heisst, man spielt die Musik, wie zum Beispiel Bach, auf möglichst authentische Weise – mit den Instrumenten und Techniken, die man damals zur Verfügung hatte. Inzwischen kooperieren Chöre gerne mit Orchestern, die Barockinstrumente verwenden – dann wird der Chor nicht so übertönt. Ich höre aber nicht immer klassische Musik: Beim Arbeiten mag ich gerne Radio, auch auf Französisch, um meine Sprachkenntnisse zu erweitern.