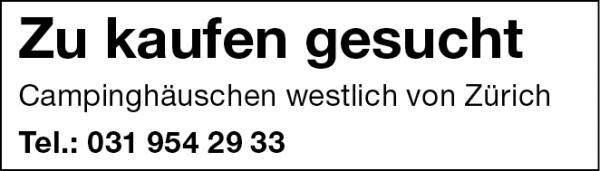Lino Schaeren
Der Bieler Gemeinderat setzt die Leitplanken für die städtische Klimapolitik der nächsten Jahrzehnte: Gestern hat Bau-, Energie- und Umweltdirektorin Barbara Schwickert (Grüne) ein Klimareglement präsentiert, das Biel dazu verpflichtet, ab dem Jahr 2050 netto keine Treibhausgasemissionen mehr auszustossen und damit das Pariser Klimaabkommen zu erfüllen. Die Stadtverwaltung als Vorbild soll gar bereits zehn Jahre früher soweit sein. Das Reglement setzt zudem verbindliche Zwischenziele und regelt die Finanzierung von Klimaschutzmassnahmen, die über das gesetzlich Vorgeschriebene hinausgehen. Beim Klimareglement handelt es sich allerdings noch um einen Entwurf – der Stadtrat wird das Papier kommende Woche an seiner Doppelsitzung beraten. Die Chancen, dass das Klimareglement im Parlament eine Mehrheit findet, dürften aber gut stehen. Schliesslich wurde es vom Gemeinderat überhaupt erst im Auftrag des Stadtrats erarbeitet.
Das Reglement geht auf einen überparteilichen parlamentarischen Vorstoss der Fraktionen SP/Juso, Grüne, GLP und Einfach libres zurück. Die Motion fand eine komfortable Mehrheit, einzig die Fraktion SVP/Die Eidgenossen übte sich in Fundamentalopposition. Die FDP stellte sich nicht grundsätzlich gegen die reglementierte Umsetzung es Pariser Abkommens auf Stadtebene – auch mit Verweis auf den Kurswechsel der nationalen Partei in Sachen Klimapolitik.
«Sehr ambitioniert»
Der Gemeinderat hat gestern indes nicht nur das Klimareglement präsentiert, sondern auch eine deutlich umfassendere Klimastrategie. Diese wurde unter Beizug eines Fachausschusses erarbeitet und bildet die Datengrundlage für die im Reglement definierten Ziele – und skizziert Massnahmen, um diese zu erreichen. Laut den Erhebungen betrugen die Treibhausgasemissionen 2017 auf Bieler Stadtgebiet 227 000 Tonnen CO-Äquivalente, die grauen Emissionen nicht mit eingerechnet.
Wenig überraschend tragen nebst der Wirtschaft die Haushalte und damit die Liegenschaften sowie der Verkehr zusammen mehr als 50 Prozent zu den Emissionen bei (siehe Grafik rechts). Bis ins Jahr 2030 sollen die Emissionen auf unter 131 000 Tonnen gesenkt werden, 2050 muss laut Reglement eine schwarze Null resultieren. Ein «sehr ambitionierter» Fahrplan, wie Barbara Schwickert gesteht; insbesondere auch, weil der Gemeinderat weitergehende Ziele formuliert hat als vom Stadtrat gefordert: Die Stadtregierung will komplett auf Kompensationen durch das Einkaufen von Klima-Zertifikaten verzichten. Die Stadtratsmotion hätte dem Gemeinderat immerhin eine Kompensation von fünf Prozent eingeräumt.
Darauf verzichtet dieser aus wirtschaftlichen und politischen Gründen: Die Kompensation von fünf Prozent der Emissionen würde die Stadt derzeit jährlich rund eine Million Franken kosten, rechnet Schwickert vor. Geld, das man lieber in Klimaschutzmassnahmen investiere. Die Stadtregierung spricht sich aber auch grundsätzlich gegen Kompensationen aus: Die Klimaziele sollten mit Massnahmen vor Ort umgesetzt werden und nicht andernorts, schreibt sie in ihrem Bericht an das Parlament.
Fossile Energie dominiert
Obwohl sich die Regierung also in der städtischen Politik noch weniger Spielraum geben will als vom Stadtrat gefordert, hält Schwickert den gezeichneten Weg für machbar. Dies auch mit Blick auf die Entwicklung der letzten Jahre: Von 2010 bis 2017 sanken die Treibhausgasemissionen in Biel bereits um 13 Prozent, «die Richtung stimmt also», so die Energiedirektorin. Die Trendrechnung zeigt aber auch: Werden nicht zusätzliche Massnahmen ergriffen, dürfte die Klimaneutralität im Jahr 2050 um rund 100 000 Tonnen CO-Äquivalente verfehlt werden.
Was also plant der Gemeinderat? Er hat in seiner Energiestrategie vier Handlungsfelder definiert:
Während die Stadt beim Konsum praktisch nur präventiv wirken kann, sind die Möglichkeiten bei den Gebäuden und beim Verkehr gross. Die Zahlen zeigen, wie viel es etwa im Bereich der Wärmeversorgung noch zu tun gibt – oder, je nach Perspektive, wie gross das Potenzial ist. Im Jahr 2017 lag der Erdgasanteil bei der Wärmeversorgung in Biel bei 45, der Erdölanteil bei 31 Prozent. Zwar hat der Energie Service Biel (ESB) auf dieses Jahr hin 20 Prozent Biogas in sein Gas-Grundangebot aufgenommen, das er mittels Zertifikaten in Dänemark finanziert. Der Anteil der fossilen Brennstoffe dürfte sich dadurch aber nur geringfügig verkleinert haben. Was verdeutlicht, welch zentrale Rolle dem ESB, eine eigenständige Unternehmung im Besitz der Stadt, in der Klimapolitik Biels zukommt. Der Gemeinderat will deshalb die Eigentümerstrategie des ESB auf «netto null» ausrichten. Der Energieversorger soll die Abkehr vom Erdgas weiter vorantreiben und stattdessen Fernwärme, Biogas und andere erneuerbare Energieträger fördern.
Schwickert, von Amtes wegen Vizepräsidentin des ESB-Verwaltungsrats, sagt, dass mittelfristig der Bau einer eigenen Biogasanlage oder die Beteiligung an einer solchen im Raum stehe. Vor allem will der ESB aber auch in den nächsten Jahren zig Millionen Franken in Fernwärmeprojekte investieren. Alleine das Projekt «Seewassernutzung», welches das Gebiet westlich des Bieler Hauptbahnhofs und grosse Teile von Nidau mit Wärme und Kälte versorgen soll, wirft Kosten von rund 30 Millionen auf. Massiv und vor allem schnell in die Fernwärme investieren will der ESB aber nicht nur, weil das Potenzial hinsichtlich der Klimapolitik gross ist. Er will auch das Feld besetzen; im Bereich Fernwärme besitzt der Bieler Energieversorger keine Monopolstellung. Da Fernwärme in Stadtteilen mit grosser Dichte durchaus ein lukratives Geschäft sein kann, fürchtet man laut Schwickert, dass andere Investoren die Filetstücke wegschnappen könnten.
Vom Kanton zurückgepfiffen
Beim Anstreben der Energiewende im Gebäudebereich hat der Gemeinderat zuletzt allerdings auch zwei empfindliche Rückschläge hinnehmen müssen. Im Februar 2019 wurde das kantonale Energiegesetz an der Urne mit 50,6 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Damit fielen eingeplante Instrumente für das Erreichen der Klimaziele weg: Das Gesetz sah etwa ein Verbot von Ölheizungen für Neubauten oder die Nachbesserung schlecht isolierter Häuser beim Heizungsersatz vor. Schwickert hofft deshalb, dass der Kanton diese und weitere Punkte in einigen Jahren in einer neuen Vorlage wieder aufgreift. Bis dahin wollte der Gemeinderat eigentlich die Vorgaben auf Gemeindegebiet verschärfen und unter anderem eine Anschlusspflicht für Fernwärmeverbunde in der städtischen Bauordnung festschreiben.
Doch auch hier folgte die Enttäuschung, denn der Kanton hat kürzlich die Stadt Bern bei ebendiesem Vorhaben zurückgepfiffen: Eine generelle Anschlusspflicht sei nicht mit kantonalem Gesetz vereinbar. Barbara Schwickert sieht die Fernwärme-Expansion dadurch jedoch nicht ausgebremst: «Wo Fernwärmenetz besteht, stossen wir grundsätzlich auch auf Interesse.» Ohne Anschlusspflicht sinkt für den ESB aber die Planungssicherheit.
Stadtra befindet über Ziele
Ausbremsen will der Gemeinderat hingegen den motorisierten Individualverkehr. Die Stadtregierung möchte die öffentlichen Parkplätze ebenso weiter reduzieren wie das autoarme Wohnen vorantreiben. Zudem sollen die Gebühren für öffentliche Parkplätze – nach Abhängigkeit vom Standort – erhöht werden. Weiter sieht der Gemeinderat Vorgaben zur klimafreundlichen Mobilität beim Abschluss von Baurechtsverträgen vor. Gleichzeitig sollen Fuss-, Langsam- und öffentlicher Verkehr weiter gefördert werden. Schwickert sagt: «Wer nach Biel kommt, soll das wenn möglich ohne Auto tun. Und wenn, dann mit einem elektrischen.»
Das ist aber alles Zukunftsmusik. Es sind lediglich grobe Skizzen möglicher Massnahmen aus der gemeinderätlichen Klimastrategie. Die Absicht, die Strategie zeitgleich mit dem Klimareglement zu veröffentlichen, ist klar: Der Gemeinderat will dem Parlament aufzeigen, ob und wie die Ziele, über die es nächste Woche zu befinden hat, erreichbar sind. Und die Stadtregierung zeigt auch auf, wie sie Massnahmen, die weiter gehen als das Vorgeschriebene, finanzieren möchte. Auf Erdgas soll ab dem 1. Januar 2021 eine zusätzliche Abgabe von 0,2 Rappen pro Kilowattstunde erhoben werden. Das entspricht etwa 25 Franken jährlich pro Haushalt. Dadurch sollen pro Jahr rund 500 000 Franken in eine Spezialfinanzierung für Klimaschutzmassnahmen fliessen.
Die komplette Klimastrategie und den Klimareglement-Entwurf des Gemeinderats finden Sie unter www.bielertagblatt.ch/klima
- Der Energieverbrauch der Gebäude soll gesenkt und erneuerbar gedeckt werden
- Verkehr soll vermieden und verlagert werden
- Der Verkehr soll erneuerbar abgewickelt werden
- Die Emissionen des Konsums sollen verringert werden