
von Peter Staub
Mais non. Nicht schon wieder. Die Mostschweizer, diese sprachpolitischen Banausen, die so weit von der Westschweiz entfernt leben, haben es wieder getan. Für eine Mehrheit des Thurgauer Kantonsparlaments ist Französisch scheinbar des Teufels.
Das Frühfranzösisch hat der thurgauische Grosse Rat bereits vor drei Jahren beerdigt, weil die Primarschüler mit dem Lernen von zwei Fremdsprachen überfordert seien. Seither üben sich die dortigen Schüler ab der dritten Klasse in Englisch und erst ab der fünften Klasse in Französisch. Und nun wollen die Thurgauer Politiker das Französisch ganz aus der Primarschule verbannen.
Die zweitwichtigste Landessprache soll künftig erst ab der Sekundarstufe zum Pflichtfach werden. Das letzte Wort ist zum Glück noch nicht gesprochen. Zuerst muss das Parlament seinen Entscheid in einer zweiten Lesung bekräftigen. Und dann ist es wahrscheinlich, dass die unterlegene Minderheit das Referendum ergreift.
Es wäre ein Leichtes, nun über die politischen Ignoranten aus Mostindien herzuziehen, ihnen auf die sprichwörtlich langen Finger zu klopfen und sich darüber zu mokieren, wie schwierig es sein muss, mit diesem sagenhaften Dialekt akzentfreies Französisch zu lernen. Doch dafür ist das Thema Zweisprachigkeit zu ernst.
Wohin es führen kann, wenn dem Sprachfrieden eines Landes nicht genügend Beachtung geschenkt wird, erleben wir in Belgien, wo sich Flamen und Wallonen so sehr zerstritten haben, dass sie es nur noch mit äusserster Mühe schaffen, in einem gemeinsamen Staat zu leben. Man mag einwenden, der Zusammenhalt der verschiedenen eidgenössischen Kulturen sei durch das Ausscheren der Thurgauer aus dem harmonisierten Modell des Sprachunterrichts nicht grundlegend gefährdet.
Damit würde jedoch verkannt, dass politische und technische Katastrophen in der Regel mit kleinen, durchaus vermeidbaren Ereignissen beginnen. Zudem stimmt der grosse Kanton Zürich in zwei Wochen darüber ab, ob in seinen Primarschulen künftig nur noch eine Fremdsprache unterrichtet wird. Auch in anderen Deutschschweizer Kantonen wie Luzern oder Baselland wird immer mal wieder darüber diskutiert, Französisch zurückzustufen.
Wer in der Minderheit ist, schaut mit Fug undRecht genau hin, wie die Mehrheit mit ihren Anliegen und ihrer Sprache umgeht. Deshalb ist es Frère Jacques oder Soeur Jaqueline aus der Romandie nicht egal, wie ihre Sprache in Mostindien künftig unterrichtet wird. In der Westschweiz ist es umgekehrt kaum ein Thema, Deutsch als Unterrichtsfach zu dezimieren.
Virginie Borel, Geschäftsführerin des in Biel ansässigen Forums für die Zweisprachigkeit, ist deshalb mit gutem Grund wütend über den «schlechten Entscheid» des Thurgauer Parlaments. Gegenüber Radio «Canal 3» hat sie darauf hingewiesen, es sei nicht nur in der helvetischen Gesellschaft, sondern auch in der Schweizer Wirtschaft zentral, dass Deutschweizer auch Französisch sprechen.
Wir freuen uns oft über die Sprachenvielfalt in der Schweiz und über die daraus resultierenden unterschiedlichen Lebensarten. Zu diesem kulturellen Reichtum müssen wir Sorge tragen: Ohne das frankofone Viertel der Bevölkerung und die noch kleineren italienisch- und romanischsprachigen Minderheiten wäre die Eidgenossenschaft ein weniger interessantes Land.
Die Mehrsprachigkeit der Willensnation Schweiz, die sich weder über eine Einheitssprache noch über eine Einheitsreligion, sondern über eine gemeinsame Geschichte und über die historisch gewachsene Demokratie definiert, sollte auch für Politiker in der Ostschweiz eine Bereicherung sein.
Die Ostschweizer Politiker können sich am Kanton Bern ein Beispiel nehmen, der soeben eine Expertenkommission unter dem Präsidium des Bieler Ständerats Hans Stöckli eingesetzt hat, um die Zweisprachigkeit im Kanton zu fördern. Und an der Stadt Biel, wo der gelebte Bilinguismus den Alltag der Menschen bereichert.
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden oder Registrieren.

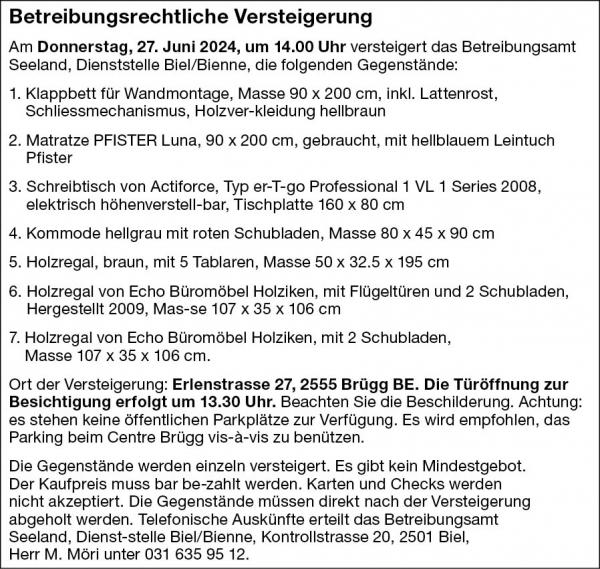




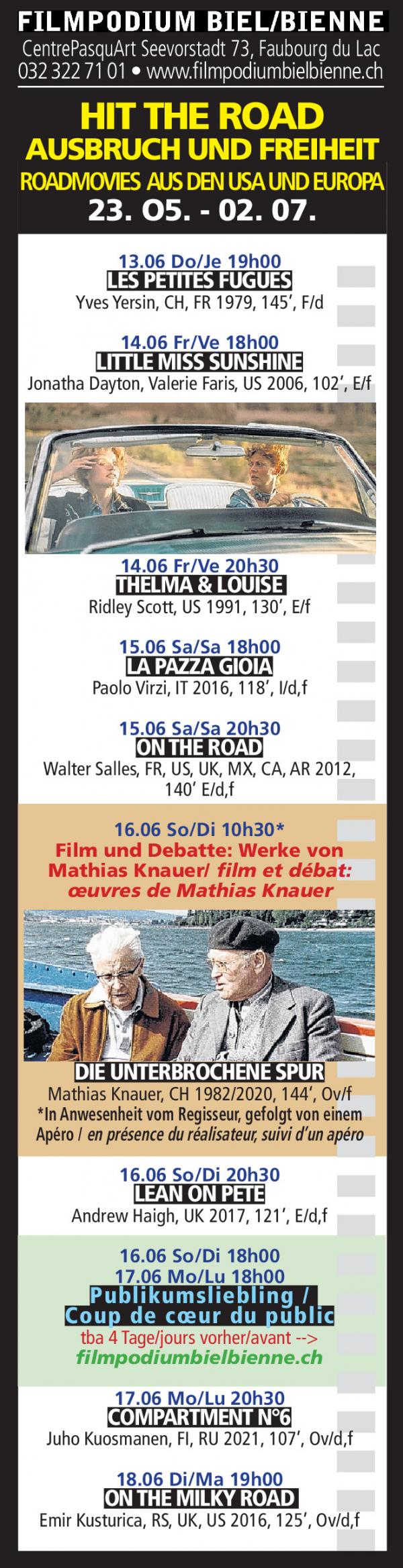






Kommentare
Wenn schon zuerst Englisch und danach Französisch lernen und nicht umgekehrt - auch in Biel-Bienne