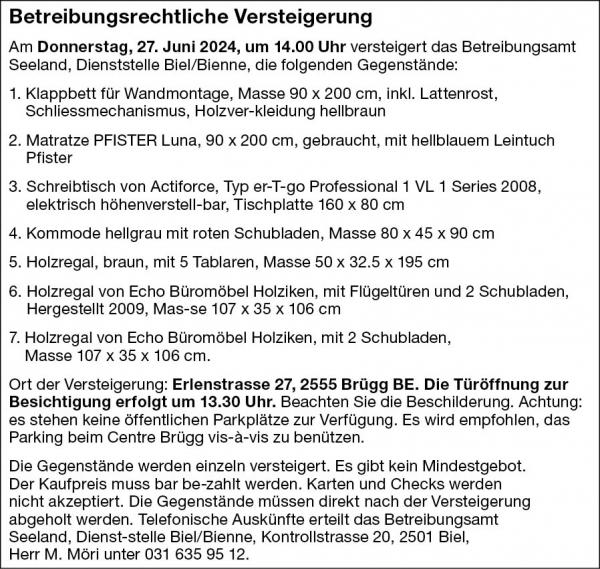Interview: Brigitte Jeckelmann
Die Spitäler haben sich für einen Grossandrang von Covid-19-Patienten vorbereitet. Vor allem bei älteren Menschen oder Personen mit Vorerkrankungen kann eine Infektion mit dem Coronavirus gravierend verlaufen. Sie müssen auf der Intensivstation beatmet werden, doch die Zahl der Plätze ist begrenzt. In norditalienischen Spitälern müssen Ärzte entscheiden, wer an die Lungenmaschine kommt und wer nicht. In den neuen Richtlinien der Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften ist als eines von vielen Kriterien ein Alter von über 85 Jahren genannt. Organisationen wie der Schweizerische Seniorenrat halten das für eine Diskriminierung älterer Menschen.
Marcus Laube, fühlen sich ältere Menschen durch die neuen Richtlinien zu Recht diskriminiert?
Marcus Laube: So würde ich das nicht sehen. In den Richtlinien steht vor allem: Man soll das tun, was ein sinnvolles therapeuthisches Ziel hat. Dieses muss man bei jeder Patientin und jedem Patienten individuell definieren. Und dieses Ziel ist nicht altersabhängig.
Aber von den über 85-Jährigen sollen die meisten eine Covid-19-Erkrankung nicht überleben.
Die vorliegenden Zahlen erlauben nur, zu sagen, dass kranke Menschen, die älter als 60 Jahre sind, den schweren Krankheitsverlauf der Covid-19-Infektion weniger oft überleben als jüngere. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es zudem Zahlen, die sagen, dass bei den über 80-Jährigen rund 50 Prozent versterben. Wobei auch ein betagter Mensch mit Covid-19 gute Chancen hat, durch eine intensivmedizinische Therapie wieder gesund zu werden. Er wird aber nicht gesünder sein als vorher. Wenn jemand schon vor der Infektion schwer krank war, wird er es auch danach noch sein. Jemand, der zwar betagt, aber fit ist, hat eine faire Chance, den Gesundheitszustand wie jener vor der Erkrankung wieder zu erreichen. Vorausgesetzt, es kommt nicht zu Komplikationen. Diese treten bei den älteren Menschen häufig ein, weil ihre Organreserven deutlich geringer sind als bei jüngeren.
Würden Sie einem bereits schwer kranken, älteren Menschen zu einer Beatmung raten?
Wir müssen das machen, was vernünftig ist. Wenn der ältere, schwer kranke Mensch trotz der Behandlung, die ihm bevorsteht, sterben würde oder dadurch in eine Situation geraten kann, die von ihm nicht gewünscht ist, darf man ihm diese tatsächlich nicht anbieten. Wenn man sich wie in Italien entscheiden muss – das ist aber bei uns im Moment wohlgemerkt nicht so – dann muss man diejenigen Patienten behandeln, die eine grössere Wahrscheinlichkeit zu überleben haben. Und zwar für ein gutes Überleben. Das Alter allein ist als Kriterium nicht ausschlaggebend.
Können Sie das näher erklären?
Bei sechs 25-jährigen Patienten im gleichen Gesundheitszustand und fünf verfügbaren Plätzen wäre eine Entscheidung für mich unmöglich. Wenn ich aber einen 25-Jährigen vor mir habe und daneben einen 92-Jährigen aus einem Pflegeheim, der noch auf niedrigem Niveau ein gutes Leben hat, dann fällt die Wahl auf den Jüngeren mit den grösseren Überlebenschancen und der Aussicht auf ein Leben mit guter Lebensqualität. Bei einem 25-jährigen, sehr schwer kranken und einem 70-jährigen Patienten mit sehr guter Gesundheit wählt man dagegen eher Letzteren. In einem Notstand, wie er in Italien herrscht, sind solche Entscheide notwendig. Aber ja, sie treffen zu müssen, wäre unglaublich hart. Man muss auf alle Fälle jede Situation individuell anschauen und vernünftige Medizin machen.
Was bedeutet das?
Eine Grundaufgabe von uns Ärzten und Pflegefachleuten ist es, den Patientinnen und Patienten das zukommen zu lassen, das für sie oder ihn stimmt. Dafür ist eine Patientenverfügung hilfreich. Darin ist der Wille des Patienten festgehalten. Idealerweise hat er das auch mit der Familie vorbesprochen, die uns diese Informationen gibt, wenn der Patient nicht mehr selber entscheiden kann. Es ist wichtig, dass sich jeder in jedem Alter der Frage stellt, was er in seinem Leben will und was nicht. Oft sind jedoch die Formulierungen in den Patientenverfügungen nicht präzise genug. Wenn jemand zum Beispiel «keine Maschinen und Schläuche» will, reicht das für einen Therapieentscheid unter Umständen nicht aus. Bei einer Lungenentzündung etwa kann eine Woche an der Beatmungsmaschine reichen, und man ist wieder gesund. Wenn man das den Menschen so darlegt, sind sie meistens damit einverstanden.
Was würden Sie jemandem empfehlen, der eine Patientenverfügung erstellen möchte?
Ich würde ihn darauf aufmerksam machen, dass es ganz verschiedene Patientenverfügungen gibt und dass es wichtig ist, eine zu wählen, die es erlaubt, seine Anliegen und seine Meinung abzubilden. Für die Zeit der Coronapandemie hat ein Team des klinischen Ethikkomitees des Universitätsspitals Zürich eine Patientenverfügung in Kurzform erstellt, die sehr gut ist. Sie enthält zwölf Fragen, die so formuliert sind, dass die Antworten keine Zweifel über den Willen des Patienten offenlassen. Eine Frage zum Beispiel lautet: In welchem Krankheitszustand möchten Sie nicht mehr lebensverlängernd behandelt werden? Da sagt etwa eine Patientin, die gerne Pilze sucht: «Wenn ich das nicht mehr kann, könnt ihr mich gleich begraben.» Ein anderer Patient möchte keine Behandlung, die ihn pflegeabhängig macht. Lebensqualität bedeutet für jeden etwas anderes. Dabei denke ich an Stephen Hawking. Der britische Astrophysiker litt an der Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose. Betroffene verlieren die Muskeln an Armen und Beinen, und sie bekommen mit der Zeit immer mehr Mühe mit Kauen, Sprechen und Schlucken. Das Bild seiner verkrümmten Gestalt im Rollstuhl wird wohl jedem präsent sein. Viele würden sagen, dass sie so nicht leben wollen. Hawking aber wollte so leben. Mit der genannten Patientenverfügung in Kurzform haben Ärzte eine gute Grundlage, im Interesse des Patienten zu handeln. Und das bedeutet nicht nur, die Lebenszeit zu verlängern, sondern auch eine Form von Leben zu gewährleisten, die man will oder nicht will.
Ist die maximal mögliche Therapie nicht immer die beste?
Wir können heute mehr Medizin machen, als manchmal wünschenswert ist. Wir können Menschen lange am Leben erhalten: Das Herz schlägt, die Lunge und die Ausscheidungsorgane funktionieren. Aber wenn die Behandlung zu Ende ist, besteht in gewissen Situationen das Risiko, pflegeabhängig zu werden. Das heisst, die physische und psychische Autonomie zu verlieren. Wenn man das den Menschen erklärt, sagen sie oft, es sei nicht wirklich das, was sie wollen. Sehen Sie, ich kann als Arzt nicht einfach eine Patientenverfügung lesen, zur Kenntnis nehmen und umsetzen. Für viele intensivmedizinische Behandlungsentscheide sind intensive Gespräche mit den Angehörigen und den Betroffenen nötig. Es ist notwendig, genügend Zeit für eine faire Entscheidung aufzuwenden. Und zwar fair dem Patienten gegenüber.
Und wenn die Zeit fehlt und es um Leben und Tod geht?
Dann fangen wir mit der maximalen Therapie an. Wenn sich der Zustand des Patienten stabilisiert hat und die Lebensgefahr abgewendet ist, schauen wir im Team nochmals, ob wir alle Aspekte beleuchtet haben. Sind wir auf gutem Weg? Haben wir das richtige Behandlungsziel vor Augen? Was machen wir, wenn wir dieses Ziel nicht erreichen können? Was ist der alternative Plan? Dabei haben wir immer das Schicksal des Betroffenen vor Augen. Und manchmal müssen wir den Familien sagen, dass wir einen Entscheid fällen müssen, der für die Zurückbleibenden hart, aber zum Wohl des Patienten ist. Die meisten wollen die Leidenszeit nicht verlängern. Im Französischen gibt es den treffenden Begriff «acharnement thérapeutique» – also des Therapierens um jeden Preis. Ich glaube, wir Ärzte müssen sehr vorsichtig sein, dass wir mit all den Möglichkeiten, die wir haben, nichts Ungutes tun.
Haben Sie selber eine Patientenverfügung?
Nein. Ich habe aber meiner Familie meinen Willen klar kommuniziert. In dem Sinn ist es trotzdem eine Patientenverfügung, indem ich meine Ansicht über Pflegeabhängigkeit und Autonomie bei meinen nächsten Angehörigen deponiert habe. Es muss also nicht zwingend irgendwo schriftlich festgehalten sein. Im Gesetz gibt es eine klare Reihenfolge, welche Personen zu medizinischen Fragen Stellung nehmen können. Wenn ein Patient keine Verfügung hat, steht also fest, wer Vertreter des Betroffenen sein darf, wenn dieser nicht mehr urteilsfähig ist. Das ist im neuen Jugend- und Erwachsenenschutzgesetz sehr gut geregelt. Spannend dabei ist: Es gelten nicht in erster Linie die verwandtschaftlichen Beziehungen, sondern die Intensität des Kontakts. Das Ziel ist dasselbe: Ein möglichst realistisches, faires Bild zu schaffen über den Willen des Patienten oder der Patientin.
Wie viele Covid-19-Patienten haben Sie im Spitalzentrum bisher künstlich beatmet?
Sehr viele noch nicht. Zehn benötigten eine Beatmungsmaschine. Bei allen konnten wir das machen, was sinnvoll ist. Eine Patientin war erst Mitte 40, ansonsten gesund. Sie konnte kürzlich wieder nach Hause gehen. Ein anderer Patient um die 80 ist gestorben. Er war schon vorher schwerstkrank, die aktuellen Umstände erlaubten uns trotzdem, ihn wie gewohnt zu therapieren. Zuvor hatten wir mit ihm und den Angehörigen definiert, an welchem Punkt die kurative Therapie zu beenden sein würde. Das haben wir dann getan. Es ist wichtig, zu wissen: In einem solchen Moment lassen wir die Menschen nicht alleine. Wir beginnen dann mit der palliativen, der begleitenden Therapie. Die Patienten müssen am Lebensende weder Atemnot, Durst, Angst noch Schmerzen erleiden und können in Würde sterben.
Sterben die Patienten dann im Spital?
In diesem Fall ja. Wo ein Patient stirbt, kommt aber auf das Umfeld und den Gesundheitszustand des Betroffenen an. Wenn immer möglich, sollten Menschen in ihrer gewohnten Umgebung einschlafen können. Jemanden, der sagt, er wolle sterben, sollte man nicht zwingen, ins Spital zu gehen. Es macht keinen Sinn, dass Betagte aus einem Pflegeheim, die schon auf niedrigem Niveau leben, ins Akutspital kommen, um hier zu sterben. In der aktuellen Ausnahmesituation braucht es bei den vorgelagerten Institutionen sicher mehr Mut als in normalen Zeiten, zu sagen, dass das Lebensende gekommen ist. Die Heime sollten dabei unterstützt werden, Palliativmedizin anbieten zu können. Wenn jeder in der Behandlungskette umsichtige und für die Patienten gute Entscheidungen trifft, haben wir im Spital noch lange genügend Reserven.
Eine Intensivstation stellt man sich vollgestopft mit Geräten vor, piepsende Maschinen, Menschen an Schläuchen – wie nah sind Ärzte und Pflegende den Patienten in einer solchen Umgebung?
Sehr nah. Das Bild, das die Menschen von der Intensivmedizin als einer Maschinenmedizin haben, ist nur teilweise korrekt. Wir führen jeden Tag sehr viele und intensive Gespräche. Ärzte und Pflegefachleute stehen in engem Kontakt mit Patienten und Angehörigen. Wir müssen täglich zahlreiche Entscheidungen fällen und hinterfragen uns ständig. Das fängt schon damit an, wenn man uns einen Patienten für die Intensivstation anmeldet. Wir müssen uns mit der Vorgeschichte auseinandersetzen und uns die Frage stellen: Wollen wir dem Betroffenen die Intensivmedizin zumuten? Oder ist das etwas, das wir nicht machen sollten, weil es ein schlechtes Ergebnis haben wird und vom Patienten so nicht gewünscht ist? Dazu muss man wissen: Eine halbe Intensivmedizin gibt es nicht. Entweder macht man es richtig oder gar nicht. Wenn wir allerdings zum Schluss kommen, dass eine Behandlung nicht mehr sinnvoll ist, können wir sie auch abbrechen. Wie gesagt: Wir können heute fast jeden zum Überleben bringen. Aber was ist dann mit dem Patienten in einigen Monaten oder Jahren? Solche Fragen müssen wir versuchen, möglichst fair zu beantworten.
Gilt in der heutigen Medizin Lebensqualität vor Lebenszeit?
Grundsätzlich ja, aber es kommt darauf an, wo. In manchen Ländern ist es praktisch ausgeschlossen, dass man eine Therapie abbricht. In der Schweiz hingegen wird niemand während zwei Jahren an der Maschine beatmet. Zum Beispiel nach einem Herzstillstand, wenn man merkt, dass das Hirn stark geschädigt ist, dann hört man bei uns mit der Therapie auf. Denn dieser Mensch wird nie mehr wach werden.
Stirbt ein Mensch dann nicht sowieso?
Nicht, wenn man weiterbehandelt und der Patient Flüssigkeit, Nahrung und Beatmung bekommt. So kann man lebenswichtige Funktionen lange aufrechterhalten, bevor jemand spontan stirbt. Komastationen, in denen Menschen ohne Aussicht auf Besserung hospitalisiert werden, gibt es in der Schweiz nicht. Anders gesagt: In unserem Land haben wir die Chance, dass jemand auch sterben darf. Und zwar auf eine Weise sterben, indem man eine andere, eine palliative Medizin macht und den Menschen an seinem Lebensende begleitet. Weil er ein schlechtes Leben haben würde, müsste er so weiter leben.
Weiterleben oder sterben – wer entscheidet darüber?
Daran ist immer ein ganzes Team beteiligt, in dem die Angehörigen mit drin sind. Den endgültigen Entscheid selbst müssen wir Ärzte von der Intensivmedizin treffen. Das darf man nicht den Angehörigen alleine aufbürden. Mit der Hilfe der Angehörigen, unserem Wissen und aufgrund der therapeutischen Zielsetzung treffen wir eine faire Entscheidung im Sinne des Patienten. Sicher, wir haben heute starke Instrumente, um Menschen das Überleben zu ermöglichen. Heute sollte niemand mehr an einem Herzinfarkt oder einer Lungenentzündung sterben. Aber wir dürfen auch Grenzen setzen.
Wie verläuft eine künstliche Beatmung bei einem Covid-19-Patienten?
Man braucht eine Maschine, die die Atmung unterstützt oder übernimmt. Dann braucht es ein Verbindungsstück zwischen Maschine und Mensch, beziehungsweise dessen Lunge. Das Verbindungsstück ist ein Schlauch, der unter Narkose durch den Mund in die Luftröhre eingelegt wird. Falls die Beatmung länger dauert und die Stimmbänder beschädigt werden könnten, nehmen wir einen Luftröhrenschnitt vor. Dann führt der Schlauch direkt durch diesen Schnitt in die Atemwege. Sobald die Maschine nicht mehr notwendig ist, entfernt man den Schlauch, die Wunde am Hals wächst wieder zu, und die Menschen können wieder normal sprechen und atmen.
Was nehmen die Patienten davon wahr?
Der Luftröhrenschnitt und das Einlegen des Schlauchs erfolgen unter Narkose, davon spüren sie nichts. Danach lässt man die Patienten langsam aufwachen. Gegen Ende der Beatmung brauchen Patienten dann kaum mehr Schmerz- und Schlafmedikamente, und sie sind bei vollem Bewusstsein. Ich habe schon Patienten erlebt, die unter Beatmung mit ihrer Familie per Facetime kommunizierten.
Wie lange dauert eine künstliche Beatmung?
Mit Covid-19-Patienten haben wir noch wenig Erfahrung. Wenn ein Covid-19-Fall auf der Intensivstation an die Lungenmaschine muss, dann benötigt er diese für mindestens ein bis zwei Wochen. Deshalb hat der Bund die Beatmungsplätze in der Schweiz auf fast 1000 verdoppelt. Wie wir haben alle Intensivstationen ihre Kapazitäten erhöht. Wir sind gut vorbereitet, wenn der Ansturm kommen sollte.
Wie viele Beatmungsplätze gibt es aktuell im Spitalzentrum?
Normalerweise haben wir sechs Beatmungsplätze. Momentan betreiben wir neun. Wir sind aber in der Lage, in kurzer Zeit vier weitere zu beschaffen. Und falls nötig, können wir noch eine zusätzliche Reserve aktivieren.
Glauben Sie, der grosse Ansturm wird noch kommen?
Wenn das Patientenaufkommen in einem Ausmass bleibt, das wir bewältigen können, dann haben wir gewonnen. Es wird sicher noch einige Kranke geben, wovon auch manche sterben werden. Aber wenn nicht alle gleichzeitig Spitalbehandlung benötigen, ist es zu schaffen. Inzwischen ist klar, dass die Massnahmen des Bundes greifen. Wenn wir alle unseren Teil dazu beitragen, bin ich zuversichtlich, dass wir diese besondere Situation meistern können.