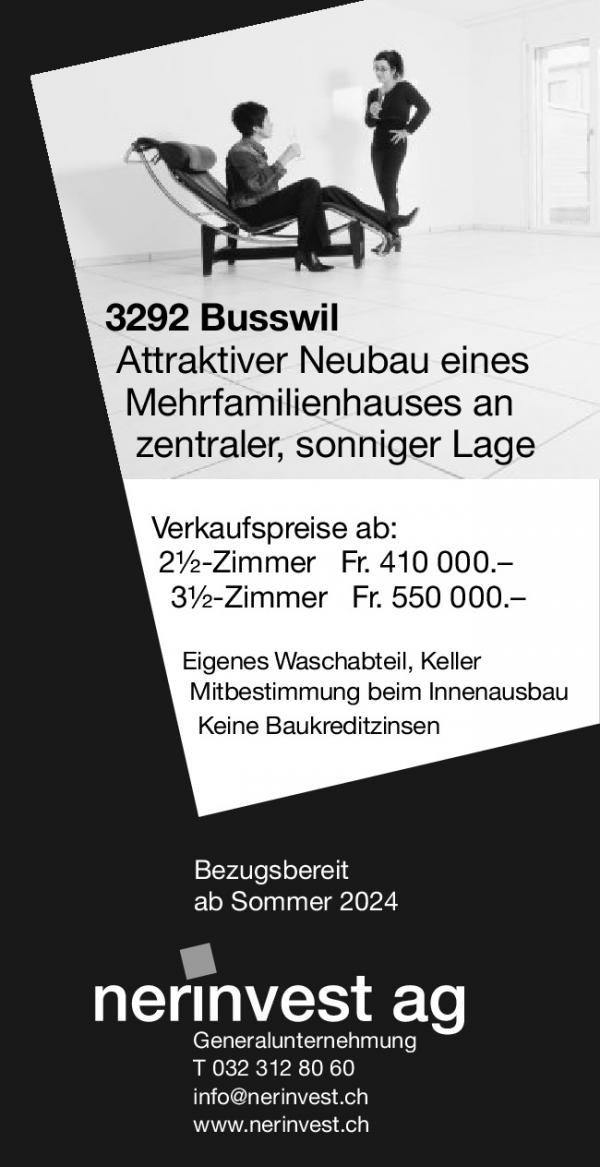Lotti Teuscher
Das letzte Tageslicht versickert im Nichts. Das Wiwannihorn, 3001 Meter hoch, zeichnet sich als schwarzer Scherenschnitt ab vor dem nachtdunklen, verhangenen Himmel. Davor die kleine Wiwannihütte, gebaut aus Stein, gelbes Licht in den Fenstern. Bis auf das Rauschen des Windes sind alle Geräusche verstummt. Hier befindet sich die letzte Trutzburg der Menschen in einer alpinen Welt, 2470 Meter über Meer.
Eine archaische Welt im Unesco-Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch, in der eigene Regeln herrschen. Hier kann auf strahlend blauen Himmel unerwartet ein Donnerschlag folgen: Gewitter, die sich bis zur letzten Minute hinter dem Wiwannihorn verstecken. Ab der Hütte gibt es keine Pfade mehr; nur noch Spuren in Geröll, Schnee und Firn. In der Nacht zuvor hat ein Wolf in der Nähe der Hütte drei Schwarznasenschafe gerissen.
Und hier befindet sich der Schauplatz einer Legende, die über viele Generationen hinweg weitererzählt wird. Ein düsteres Geheimnis, das sich um Suonen rankt – bis heute die Lebensadern der trockensten Region der Schweiz. Doch dazu später mehr.
Hans-Christian Leiggener, Direktor des Unesco-Weltnaturerbes und Bergführer, sagt, das Wiwannihorn sei der «schönste 3000er der Alpen». Als Erstes nennt Leiggener die Zugänglichkeit – den Katzsprung von der Zivilisation in eine subalpine, später in eine alpine und kurz danach in eine hochalpine Gebirgswelt.
Eben noch standen meine Freundin Monique und ich staunend in Visp im Rhonetal. Verblüfft ob der Dimension der Fabrik Lonza, gestartet 1897 als Lonza Elektrizitätswerke. Heute ein Biotechnologie-Unternehmen, das enorme Mengen des weltweit begehrten Impfstoffs Moderna produziert. Die «Lonza» platzt aus allen Nähten, erstellt Erweiterungsbauten, 1000 neue Mitarbeiter werden in Tranchen eingestellt. Derzeit sucht die Fabrik 150 Personen, von der Putzkraft bis zur Spezialistin.
800 Jahre alte Lärchen
30 Minuten später wandern wir beim Fuxtritt los, 1850 Meter über Meer; bis hierher führt ein Forststrässchen. Der Pfad schlängelt sich den Berg hoch wie eine geschmeidige Vipernatter, die seltenste Schlangenart der Schweiz. Nur etwa 1000 Exemplare leben über dem Rhonetal und dem Lac Léman.
Noch wandern wir im Schatten des Lärchenwaldes an gewaltigen Felsbrocken vorbei; Zeugen von Felsstürzen aus grosser Höhe. Etliche der Lärchen sind unfassbar alt: Als die Walliser im Mittelalter die Grafen von Savoyen vertrieben, waren die Nadelbäume zarte Keimlinge. Heute sind ihre Stämme, Äste und Wurzeln dick und knorrig, die rötliche Borke grob und rau. Bis zu 800 Jahre sind diese Methusalems alt; hochgewachsen, ihre Wipfel exponiert. Oft ist es ein Blitz, der ihr langes Leben beendet – nicht auf einen Schlag, denn die Riesen sind zäh: Nach dem Stromschlag sterben die Lärchen während bis zu 20 Jahren langsam ab.
Der Lärchenwald ist licht, unter den Bäumen herrscht ein mediterranes Klima, davon zeugt die reiche Flora. Pink, gelb, weiss, blau, rosa, violett – leuchtende Blüten in allen Farben. Lichtnelken, Sonnenröschen, Alpenveilchen. Oder Gamswurz, «das Generikum von Arnika», scherzt Hans-Christian Leiggener. Denn die goldgelben Blüten sind der Heilpflanze Arnika so ähnlich wie ein Generikum dem originalen Medikament.
Die Höhenspezialistin
Über der Baumgrenze blühen Berganemonen in Pastellfarben, der grosse und kleine Enzian leuchtet blau. Bald werden die Alpenrosen ihre roten Blüten öffnen, das Edelweiss seine flaumigen Sterne. Es ist indes eine eher unscheinbare Pflanze, die grössten Respekt verdient: der Gletscher-Hahnenfuss mit seinen weissen, roten oder rosa Rosetten und gelbem Stempel. Die zarte Blume überlebt bis in Höhen von 4000 Meter über Meer. Der Trick der Höhenspezialistin: Sie wächst im Schutz von Eisüberhängen, die sie wie ein Treibhaus schützen.
Unsere Blicke gleiten oberhalb der Baumgrenze über kilometerweite, steile Hänge, zu stotzig für Kühe. Das kurze Gras und die Kräuter rupfen berggängige Schwarzhalsziegen und Schwarznasenschafe. Hier erkennen wir zum zweiten Mal, weshalb Hans-Chrstian Leiggener, seinen Hausberg «Wiwanni» als schönsten aller 3000er bezeichnet. Nein, nicht aus Lokalpatriotismus, (der Bergführer ist in Ausserberg aufgewachsen). Sondern weil diese imposante Bergwelt frei ist von jeglichen Spuren der Moderne. Keine Stromleitungen, Ferienhäuschen, Strässchen, nirgends Skilifte, Gondel- oder Zahnradbahnen. Hier ist die Zeit während der letzten tausend Jahre stehen geblieben. Nichts verändert sich.
Tatsächlich? Während einer Wärmeperiode im 13. und 14. Jahrhundert zogen sich die Gletscher noch weiter zurück als heute; auch der Wiwannigletscher schmolz rasant. Das Gletscherwasser, das die Suonen der Dörfer Raaft und Leiggern speiste, floss immer spärlicher. Die Weiden bei den Dörfern vertrockneten. Es war dieses Klimaphänomen, das zu einer Untat führte, die nie vergessen wurde.
Legende oder Wahrheit?
Weil durch die Suonen immer weniger Wasser floss, schickten die Dorfbewohner zwei Brüder zum Wiwannihorn ambrüf (Walliser-Dialekt für hinauf), um zum Rechten zu sehen. Der eine Bruder war für die Suone nach Raaft verantwortlich, der andere hatte eine Leiggrerin geheiratet, er war zuständig für die zweite. Heute sind wir vor Ort, weil es Spuren dieser Tragödie geben soll. «Hier», ruft Hans-Christian Leiggner plötzlich auf der Hochebene in der Nähe der Wiwannihütte. «Seht Ihr es?»
700 bis Jahre nach dem Drama erwarte ich: nichts. Wie soll eine uralte Walliser Sage Sichtbares hinterlassen?
Monique und ich, wir wollen uns indes nicht vor dem Bergführer blamieren, wir schärfen unsere Blicke. Und tatsächlich! Vom «Wiwanni» herkommend, zeichnet sich schwach ein Graben im raspelkurzen Gras ab. An dessen Rändern ein paar flache Steine, geometrisch aufgereiht. Etwas weiter unten verzweigt sich der Graben in zwei knapp sichtbare Spuren. Die eine Spur führt nach rechts, die andere nach links. Die ehemaligen Suonen nach Raaft und Leiggen? Hans-Christian Leiggener nickt.
Hier also standen vor 700 Jahren die beiden Brüder von Raaft und Leiggern. Hier stritten sie um das spärliche Gletscherwasser. Hatten die Brüder ein hitziges Temperament? Standen sie wegen des knappen Wassers unter Druck? Schwelte zwischen ihnen seit Langem ein Bruderzwist? Fragen, auf die es keine Antwort mehr gibt.
Ein Wort der Brüder gab das andere. Die Stimmen wurden lauter, die Blicke drohend, die Brüder steigerten sich in eine hitzige Wut. Schliesslich griffen beide gleichzeitig zu den Suonenbeilen, einem Werkzeug zum Bearbeiten der Wasserleitungen. Beide Brüder – rasend vor Zorn – schlugen zu.
Als die Brüder nicht heimkehrten, stiegen besorgte Männer zu den Suonen hoch. Die Brüder lagen tot neben den versiegenden Wassergräben.
Die Strafe Gottes
Damit ist diese Legende nicht zu Ende. Zur Strafe für den Brudermord liess Gott die Suonen komplett versiegen. Das Wasser trat in der Folge durch das «Nasenloch» aus: Aus der Höhle in einer Felswand im Bietschtal, links vom Wiwannihorn (das BT berichtete). Zweigeteilt – so wie die beiden Suonen am «Wiwanni»: In der Mitte des Höhlenausgangs trennt ein Fels, geformt wie die Nasenscheide, das Wasser.
Ist dieser Teil der Legende der Gottesfurcht einer tiefgläubigen Bevölkerung zuzuordnen? Mit Bestimmtheit weiss dies niemand. Doch vermutlich war es die kurze Warmzeit im Mittelalter, die die beiden Suonen versiegen liess. Und der Brudermord? Dieser ist mit grosser Wahrscheinlichkeit der wahre Kern der Legende.
Nachdem die Wiwanni-Leitungen versiegt waren, wurde die Suone Niwärch gebaut – eine kühne Linienführung im Baltschiedertal, an Felswände gehängt. Nach Tragödien mit vielen Toten sprengten die Walliser schliesslich einen anderthalb Kilometer langen Wassertunnel durch den Fels.
Nachdenklich wandern wir zur Wiwannihütte, wo uns Hüttenwartin Barbara Squineboe ein währschaftes Nachtessen serviert. Bei einem Gläschen Genepi, ein Digestiv aus Wermut und anderen Alpenkräutern (Genepi schmeckt ab 2000 Meter über Meer fantastisch), erzählt Barbara, dass sie zehn Jahre lang Lehrerin war. Dann suchte sie eine Arbeit, «bei der ich von zufriedenen Leuten umgeben bin». Die Wiwanni-Hütte ist so ein Ort, hier fühlt sich die Waliserin aus dem Aostatal zu Hause.
Rumpeln – ein Geist?
Während sich Monique im Massenlager schlafen legt, freue ich mich auf mein Privileg. Denn als Massenlager-Phobikerin bekomme ich – vorerst einen Schreck! Als ich um die Ecke der Wiwannihütte biegen will, höre ich Scharren, Trampeln, ein Poltern; kurz: unheimliche Geräusche. Die Geister der beiden Brüder? In diesem Moment schiesst ein Murmeltier in gestrecktem Galopp um die Ecke. Schmunzelnd krieche ich in mein Lager. Ein Zelt aus Metall. Darin eine Matratze, eine Militärdecke und ein Dachbett mit rot-weiss kariertem Duvet. Näher an dieser urtümlichen Natur könnte ich nicht schlafen.
Drei junge Steinböcke, direkt vor der Hütte, versüssen Morgenmuffeln das Aufstehen. Selbstsichere Tiere, die Flechten von Felsblöcken knabbern. Hans-Christian Leiggener signalisiert uns, dass es jetzt ambrüf geht. Bergauf, in das Klettergebiet. Ein sehr grosses Klettergebiet: 150 Kletterrouten in Klettergärten, am Wiwanni- und dem benachbarten Augstkummenhorn. So genannt, weil dort der letzte Schnee erst im August schmilzt.
Heute sind fast alle Kletterrouten im Plaisirstil eingerichtet: Es gibt reichlich Bohrhaken, damit sich die Kletterer sichern können. Doch das war nicht immer so; auf dem Augstkummenhorn gab es vor 20 Jahren beängstigend wenige Sicherungsmöglichkeiten. Zwei prominente Bieler Bergführer (deren Namen wir der Ehre halber verschweigen), nannten den Berg deshalb «Angst- und Kummerhorn».
Berg- und Lampenfieber
Ambrüf. Erst über eine Geröllhalde, danach über ein Schneefeld. Ambrüf, bis wir vor der grauen Felswand des Wiwannihorns stehen. Vor uns etwa 300 Höhenmeter Kletterei. Die Wand senkrecht. So habe ich mir das nicht vorgestellt! Doch wer hier weiter will, hat wirklich nur eine Möglichkeit: Ambrüf! Nervös krame ich im Rucksack nach Helm und Klettergurt. Schwankend zwischen Berg- und Lampenfieber.
Stemmen, Ziehen, hinauf mit den Füssen; aufstehen, den nächsten Griff mit den Händen packen. Meter für Meter im griffigen Gneis. Die Kraxelei über die Normalroute, von unten steil und furchterregend, erweist sich dank des stark erodierten Gneis‘ als überraschend einfach. Staunend entdecke ich Leben und Farben in der grauen Wand. Auf dem Fels wachsen hellgrüne, schwarze, graue und orange Flechten. In Felsritzen krallen sich Polsterblumen fest, sie locken mit pinken und weissen Blümchen Insekten an.
Wenn meine Bewegungen stocken, zieht unser Bergführer kräftig am Seil – für ihn ist diese Route buchstäblich ein Kinderspiel. Als Vierjähriger hat Hans-Christian Leiggener das Wiwannihorn zum ersten Mal bestiegen; am Seil seines Vaters. Als junger Spitzenkletterer eröffnete er bei der Wiwannihütte eine überhängende 8a – ein Schwierigkeitsgrad, den kein Hobby-Kletterer schafft.
Eine Wand bis zum Himmel?
«Gniff» nennt Leiggener seine Route. Ein Wortspiel aus «Griff» und «Kniff»? Oder entfährt Kletterern am Limit, hängend an einem Finger, ein ersticktes «gnff»? Falsch, lacht der Chef des Unesco-Weltnaturerbes: «Gniff bezeichnet hauchdünnen Frost am Fels.»
Zu meinem Glück hat es am «Wiwanni» heute keinen Gniff. Stattdessen beschleicht mich das Gefühl, dass der Berg bis zum Himmel reicht. Ambrüf, immer weiter ambrüf. Müsste nicht irgendwann ein Ende kommen? Mir wird unheimlich – hier im Wallis, im Reich der Sagen, Legenden, Verdammten und verlorenen Seelen, scheint alles möglich. Selbst Felsen, die in den Himmel wachsen.
Irgendwann hat aber auch diese Wand ein Ende. Zu meiner Überraschung stehen wir nicht auf einem Gipfel. Auf 3001 Meter über Meer, vor dem Gipfelkreuz, dehnt sich eine Art Krater aus. Diese Form ist der Namensgeber für den Berg: «Wiwanni» ist abgeleitet von «Wanne».
Der Blick schwebt wie ein Steinadler über weite Teile des Unesco-Weltnaturerbes Jungfrau-Aletsch. Das abgeschiedene Baltschiedertal trifft sich hinter dem Wiwannihorn mit dem felsigen Bietschtal. Dahinter das wuchtige Bietschhorn. Der Blick reicht zu rund 30 Gipfeln, die mehr als 4000 Meter hoch sind. Die Augen schweifen über vier Klimazonen, von Tälern über bewaldete Hänge bis zur vereisten, hochalpinen Welt.
Ganze 824 Quadratkilometer gross ist das Unesco-Weltnaturerbe. Es ist eine Fundgrube für Geologen, Glaziologen, Botaniker und Biologen. Faltung, Form und Schichtung der Felsen erzählen, wie sich dieses Gebirge während Jahrmillionen gebildet hat. In den Gletschern zeichnet sich der Klimawandel so deutlich ab wie nirgendwo sonst. Hier leben Tiere, die endemisch sind, Gleiches gilt für Pflanzen. Auch Künstler zieht diese Gebirgsformation seit Generationen an: Maler, Poeten, Schriftsteller.
Es sind diese Merkmale, die diese Gebirgsregion für das Unesco-Weltnaturerbe prädestiniert haben. Rund um das Jungfrau- und das Aletschgebiet auf Walliser und Berner Boden existiert eine Welt voller Schönheit, Furchterregendem; manchmal ruppig, manchmal romantisch; eine Welt in der sich Vergangenheit und Gegenwart begegnen, eine Welt voller Geschichten, eine Wundertüte. Oder ein Mosaik, das für mich mit jedem Besuch grösser und farbiger wird.
Ein Grund zur Panik?
Monique reisst mich abrupt aus meinem Gedanken: «Du, wir müssen da wieder runter.» Ambri? Hinunter? Oh, das hatte ich ganz vergessen! Konzentration verdrängt die Euphorie. Hans-Christan Leiggener wählt für den Abstieg den Westgrat. Der erste Teil führt über «Gehgelände», wie Bergsteiger so sagen. Oder Gufer, wie ich dieses Zeug nenne, dieses Gewirr aus gespaltenem, herumgespicktem Gestein. Während Hans-Christian Leiggener geschickt über das Durcheinander balanciert, muss ich immer wieder in die Knie gehen, mich mit den Händen abstützen, um nicht umzukippen – wie ein Kleinkind, das eben erst das Laufen lernt.
Im Wiwanni-Kletterführer steht, der Westgrat sei «etwas ausgesetzt». Etwas ausgesetzt? Wenn der Grat schmal wird, fällt der Blick senkrecht mehrere hundert Meter in die Tiefe, bevor er auf den Boden knallt. Einen kurzen Moment überlege ich, ob diese Tiefsicht ein Grund zur Panik sei. Doch hinter mir steht der Bergführer, der zuverlässig sichert – ein biologischer Tranquilizer, besser als jeder chemische. Wir kraxeln an grauen Zacken vorbei, an bizarr erodierten Felsformationen, an Platten entlang, überklettern Türmchen.
Die Lügen der Bergführer
«Kennt Ihr die drei Lügen der Bergführer?», scherzt Hans-Christian plötzlich: «Die erste lautet: Du machst das gut.» Monique dreht sich erschrocken um – kurz zuvor hatte Leiggener sie für ihre Kletterkünste gelobt. «Die Zweite: Wir sind in der Zeit.» Beschämt ziehe ich den Kopf ein – ich bin die Bremserin der Dreier-Seilschaft. «Und die dritte Lüge?», fragt Monique. «Wir haben das Ziel bald erreicht», tönt es vergnügt hinter uns.
Erreichen wir unser nächstes Ziel, eine grosse Felsplatte, tatsächlich bald? Ich schätze: Nein. Der Bergführer hat zu dritten Mal geflunkert. Irgendwann ist die Platte dann aber doch greifbar. Die letzten 50 Meter dürfen wir bequem über die Platte abseilen. In den Klettergurt lehnen, rückwärtsgehen, eine paar Minuten später stecken meine Schuhe wieder im Schneefeld – die «Wiwanni»-Überschreitung ist geschafft. Nachdem mich der Grat buchstäblich zur Schnecke gemacht hat. Jetzt will ich zeigen, was ich draufhabe. Hinsetzen auf das steile Schneefeld, Füsse in die Luft. Achtung! Schon sause ich auf dem Hintern an Hans-Christian Leiggener vorbei.
Die vierte Lüge
Nach einem Stück (formidablen) Kuchen in der Wiwannihütte, geht es zurück zum Fuxtritt. Meine Beine ächzen unter der Belastung. Mit jedem Schritt wird ihr Protest ärger. Nach der Kraxelei und insgesamt 1200 Höhenmeter Abstieg, drohen die Beine mit Totalausfall. Humpelnd erreiche ich Hans-Christian Leiggeners Auto. Der Bergführer – so frisch, wie vor der Tour – sagt tröstend: «Ich spüre auch etwas in den Beinen.»
Et voilà. Die vierte Lüge der Bergführer!