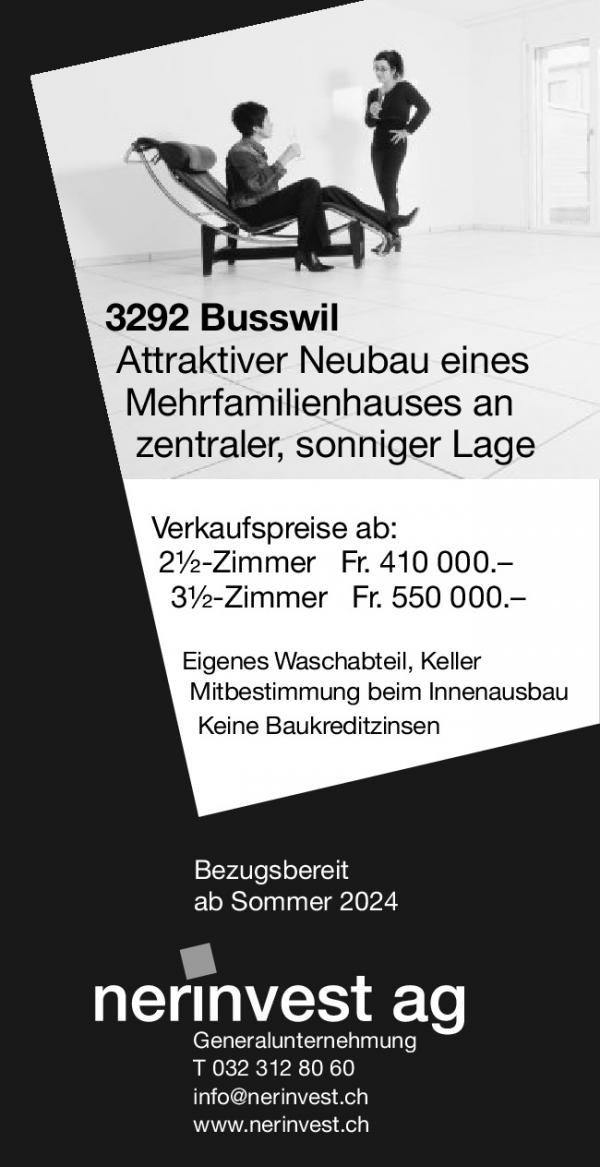Raphaela Birrer
Sie helfen Patienten in schwierigen Lebenssituationen – jetzt suchen sie selber Hilfe: Zurzeit stehen in diversen Schweizer Städten Psychologen auf der Strasse. Sie sammeln Unterschriften für eine Petition, die den Bundesrat auffordert, «die Zugangshürden zur Psychotherapie zu beseitigen». Bereits 50 000 Personen haben die Petition seit Mitte November unterzeichnet, wie Philipp Thüler, Sprecher des Psychologenverbands, sagt. Anfang März soll sie der Bundeskanzlei übergeben werden.
Zugangshürden bestehen nach Ansicht der Berufsverbände, weil die Psychologen nicht eigenständig zuhanden der Grundversicherung abrechnen dürfen. Nur wenn sie «delegiert» arbeiten, wenn sie also bei einem Psychiater mit medizinischer Ausbildung angestellt sind, bezahlen die Krankenkassen die Psychotherapie. Der Arzt verordnet und beaufsichtigt die Behandlung, erhält die Prämiengelder und entlöhnt die Psychologen. Weil es zu wenige Psychiater gebe, die den maximal vier in ihrer Praxis tätigen Psychologen Patienten zuweisen, müssten besonders Kinder und Jugendliche sowie Erkrankte in ländlichen Gebieten monatelang auf eine Behandlung warten, sagt Thüler – «ein unhaltbarer Zustand».
Die Haus- und Kinderärzte bestätigen den Engpass: «Wir können viele Patienten nicht an Fachpersonen weiterleiten», sagt Verbandspräsident Philippe Luchsinger. Die delegierte Arbeitsweise sei zudem zu kompliziert und mit grossem administrativem Aufwand verbunden.
Druck aus dem Parlament
Bei den Psychiatern hingegen sorgen diese Argumente für Unmut. «Wir unterstützen die Petition nicht. In grösseren Städten gibt es kaum Wartezeiten. Und auf dem Land fehlt es nicht nur an Psychiatern, sondern auch an Psychologen», sagt Pierre Vallon, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie. Zudem könnten Psychiater nicht einfach durch Psychologen ersetzt werden. Letztere seien bezüglich der klinischen Kompetenzen zu wenig ausgebildet, um Patienten mit schweren psychiatrischen, psychosomatischen oder Suchterkrankungen zu behandeln, sagt Vallon. Skeptisch waren bis vor kurzem auch die Krankenkassen. Doch nun heisst es beim Verband Santésuisse, man favorisiere kein bestimmtes Modell, sofern die Qualität der Behandlungen stimme. Zudem müsse eine rasche Intervention möglich sein, falls sich die Kosten negativ entwickelten, um die Prämienzahler nicht stärker zu belasten. Eine direkte Abrechnung ohne Anordnung von dafür qualifizierten Ärzten komme deshalb nicht infrage.
Dem öffentlichen Hilferuf der Psychologen geht ein jahrelanger Streit voraus: Von Ruth Dreifuss über Didier Burkhalter bis Alain Berset haben mehrere Gesundheitsminister den Psychotherapeuten einen Systemwechsel in Aussicht gestellt. Sobald in der Aus- und Weiterbildung ein national einheitlicher Standard gelte, würden sie als selbstständige Leistungserbringer mit den Krankenkassen abrechnen dürfen, hiess es. Konkret sollte ein Anordnungsmodell wie bei den Physiotherapeuten etabliert werden. Diese dürfen nach einer ärztlichen Verordnung eigenständig behandeln und abrechnen. Allein: Geschehen ist bis heute nichts – obwohl die Bildungsfragen mittlerweile seit bald sechs Jahren im Psychologieberufegesetz geregelt sind. Deshalb erhöht sich jetzt auch der Druck aus dem Parlament: Vertreter von Mitte-links haben in den letzten Monaten sieben Vorstösse eingereicht; die aktuellsten stammen aus der Wintersession. «Den bundesrätlichen Versprechen müssen jetzt Taten folgen», sagt etwa die grüne Nationalrätin Irène Kälin. «Der Bundesrat muss nach jahrelanger Diskussion endlich einen Verordnungsentwurf für einen Systemwechsel vorlegen», fordert auch CVP-Nationalrätin Géraldine Marchand-Balet. Mit dem Anordnungsmodell gelinge es besser, psychisch Erkrankte rasch zu behandeln. Das sei im Interesse der Wirtschaft, da die Arbeitsausfälle reduziert würden. Werde die Versorgungslücke geschlossen, verhindere das nicht nur Leid, sondern auch höhere Folgekosten, sagt GLP-Nationalrat Thomas Weibel: «Es wären weniger stationäre Behandlungen nötig, und die Zahl der IV-Renten könnte reduziert werden.»
Bundesrat ist skeptisch
Doch der Bundesrat beurteilt die Kostenfrage anders. In seinen Antworten auf die Vorstösse räumt er zwar ein, dass die psychiatrische Versorgung verbessert werden müsse – gerade bei Kindern und Jugendlichen. Die aktuelle Regelung sei «nicht mehr angemessen». Gleichzeitig fürchtet er sich aber angesichts des Kostendrucks in der Grundversicherung vor einer «unnötigen Mengenausweitung». Aus diesem Grund hätten Bersets Fachleute im März 2018 die Gespräche mit den Psychologen abgebrochen, sagt Verbandssprecher Thüler. Davon will man beim Bundesamt für Gesundheit allerdings nichts wissen: «Die Arbeiten für alternative Modelle wurden 2018 weitergeführt», sagt ein Sprecher. Nächste Schritte seien für das laufende Jahr geplant.
Tatsächlich liegt dem Vernehmen nach mittlerweile ein Verordnungsentwurf bei der Psychologieberufekommission, die den Bundesrat berät. Sie nimmt noch keine Stellung zur konkreten Ausgestaltung, doch ihre Grundsatzempfehlung ist eindeutig: «Wir sind der Meinung, dass möglichst bald ein neues Modell etabliert werden sollte. Die Schwelle ist für die Patienten tiefer, wenn sie auch über Hausärzte oder Gynäkologen zur Psychotherapie kommen», sagt Kommissionsmitglied Gabriela Rüttimann.
Eine schnelle Lösung scheint jedoch wegen der divergierenden Interessen nicht in Sicht. Der Psychologenverband behält sich deshalb vor, eine Volksinitiative zu lancieren. Nach der Sammelaktion für die Petition ist Thüler überzeugt: «Die Unterschriften hätten wir rasch beisammen.»
*****************************************************
Sie fordern mehr Anerkennung für ihren Beruf
«Haben Sie kurz Zeit?», fragt Esther Maria Brütsch die Passanten, die am Stand in Bern vorbeigehen. Weil sie den Moment für ein neues Modell für längst gekommen halten, stehen die Psychotherapeutin und ihre Berufskolleginnen derzeit an Wochenenden auf der Strasse und sammeln Unterschriften. Zu viel Zeit sei mit der Suche nach einer neuen Regelung vergangen, nun wollen sie mit der Petition Druck machen. Viele Passanten bleiben in der Kälte stehen und lassen sich von den Psychotherapeutinnen die Sachlage erklären.
Esther Maria Brütsch ist als Fachpsychologin für Psychotherapie selbstständig tätig. Sie begleitet und behandelt zum Beispiel Patienten mit Depressionen oder nach einem Trauma. Haben diese keine entsprechende Zusatzversicherung, müssen sie die Behandlung selber bezahlen. Eine Therapiesitzung im Raum Bern kann 150 Franken oder mehr kosten, «das können nicht alle aufbringen», sagt Brütsch. Wer auf die Grundversicherung angewiesen ist, sucht deshalb die Praxis einer Psychiaterin oder eines Psychiaters auf, wo es oft längere Wartezeiten gibt.
Auf der Strasse stossen Brütsch und ihre Kolleginnen einerseits auf Verständnis und andererseits auf den Einwand: «Dann steigen die Krankenkassenprämien noch mehr.» Die Psychotherapeutinnen kennen diesen Einwand, doch Brütsch erwidert: «Mit einem besseren Zugang zur Therapie lassen sich auch Kosten vermeiden.» Sie verweist darauf, dass Patienten dank rascher Behandlung schneller zurück im Arbeitsprozess sind oder gar nicht aus diesem herausfallen. Ausserdem werde mit der Petition kein gänzlich freier Zugang zur Grundversicherung gefordert, sondern ein Anordnungsmodell, wie man es schon von der Physiotherapie her kenne.
Beim Stand des Verbands der Berner Psychologen und Psychologinnen stellen die Passanten auch viele Fragen – etwa: «Müsste man nicht viel früher ansetzen, damit psychische Krankheiten gar nicht erst entstehen?» Esther Maria Brütsch widerspricht nicht. Doch aktuell gehe es um einen niederschwelligen Zugang zur Behandlung, «weil Wartefristen den Zustand der Patienten sowie der Angehörigen verschlechtern können».
Nicht nur in Bern, sondern in mehreren Schweizer Städten gehen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten auf die Strasse. Noch bis Ende Februar sammeln sie Unterschriften. Mit der Aufnahme in die Grundversicherung geht es ihnen, die nach dem Studium eine eidgenössisch anerkannte Weiterbildung absolviert haben, auch um die Anerkennung ihres Berufsstandes; das heutige Delegationssystem bezeichnen sie als unwürdig. Brigitte Walser