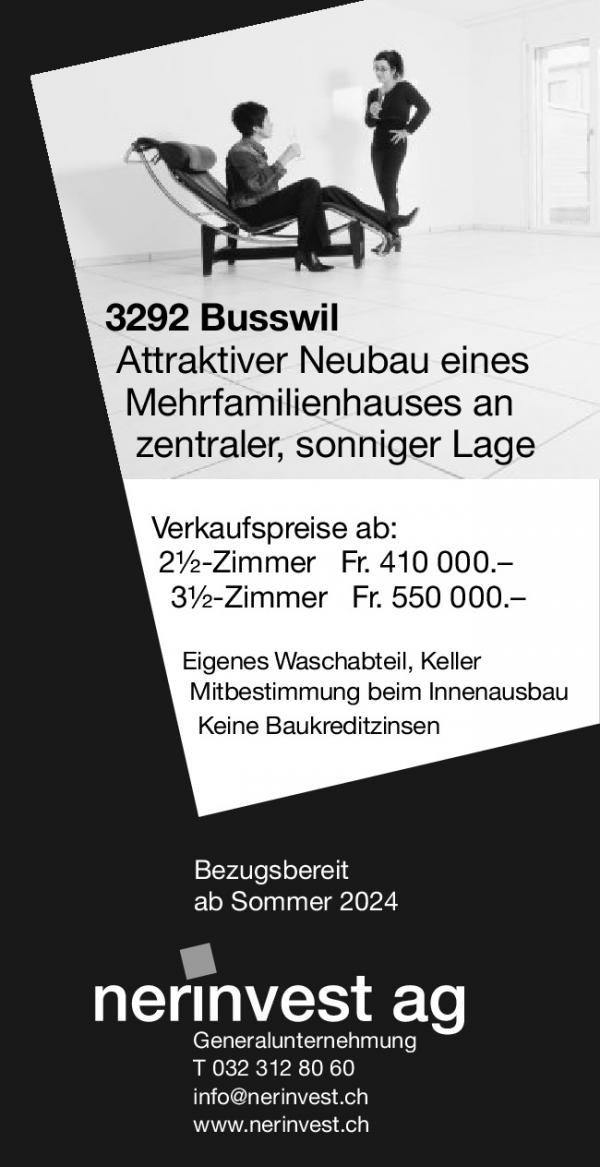-

1/5 «Self Portrait», Gouache on paper, von Louise Bourgeois (2008). Bild: zvg/christopher burke -

2/5 «Aurélie» von Gabriele Münter (1906). Bild: Gabriele Münter Stiftung 1957 © 2021, ProLitteris -

3/5 «Dame im Sessel, schreibend» von Gabriele Münter (1926). Bild: Gabriele Münter- und Johannes Eichner-Stiftung © 2021, ProLitteris -

4/5 «Drei Frauen im Sonntagsstaat», Marshall, Texas von Gabriele Münter, 1899/1900. Bild: Gabriele Münter- und Johannes Eichner-Stiftung © 2021, ProLitteris -

5/5 «Series I, No. 8» von Georgia O’Keeffe (1919). Bild: Städtische Galerie im Lenbach Haus und Kunstbau München
- Galerie
Helen Lagger
«Müssen Frauen nackt sein, um ins Met-Museum zu kommen?», das fragten 1989 die Guerilla Girls, eine anonyme Gruppe von feministischen Künstlerinnen, die mit Protestaktionen, Plakaten oder Büchern gegen den Sexismus in der Kunstwelt kämpfen. Und dieser hat eine lange und hartnäckige Tradition. Erst seit rund 100 Jahren dürfen Frauen an Kunsthochschulen studieren. Die Kunstgeschichte wurde vor allem von Männern geschrieben. Der Kunstmarkt ist noch immer sehr männerdominiert, die Werke von Frauen werden nach wie vor unterschiedlich bewertet. 2019 liess uns eine Studie der Universität Basel wissen, dass nur ein Viertel aller Einzelausstellungen in der Schweiz Frauen gewidmet sind.
Und doch tut sich etwas: Internationale Initiativen wie «ART+FEMINISM» decken die Missstände seit Jahren auf und setzen sich für die Sichtbarkeit von Künstlerinnen ein. Mit Folgen. Das Museum of Modern Art (Moma) in New York setzt seit 2019 explizit vermehrt auf Kunst von Frauen. Im Zentrum Paul Klee und im Kunstmuseum Bern haben sie unter der Leitung der Direktorin Nina Zimmer Teruko Yokoi (1924-2020) oder Lee Krasner (1908-1984) endlich Platz erhalten.
Im Hamburger Ernst-Barlach Haus wird zurzeit Mary Warburg (1866-1934), Frau des Kunsthistorikers Aby Warburg, die in seinem Schatten stand, gewürdigt. In der Schirn in Frankfurt wiederum ging gerade die Ausstellung zu Paula Modersohn-Becker (1876-1907) zu Ende. Wie nachhaltig dieses Engagement ist und wie es den Kanon der Kunstgeschichte verändern oder gar neu schreiben wird, ist noch abzuwarten. Wir haben Louise, Gabriele und Giorgia besucht. Es lohnt sich. Nicht weil sie Frauen sind, sondern weil sie gute Künstlerinnen sind.
Louise
Sie hat in ihrer Kunst ihre schmerzhafte Kindheit regelrecht exorziert: Louise Bourgeois, 1911 in Paris geboren und 2010 in New York verstorben, stellte ihre Mutter mit ihren «Mamans» in Form riesiger Skulpturen als Spinne dar oder schuf Installationen, die sogenannten Cells, in denen sie Objekte mit autobiografischer Bedeutung platzierte. Der Vater hatte sie als Kind verhöhnt und machte keinen Hehl daraus, dass ihm ein Junge an ihrer Stelle lieber gewesen wäre. Die Mutter erduldete seine zahlreichen Mätressen, die er unterhielt und auch in die Familie integrierte. Für Bourgeois ein Stoff, aus dem sie ein ebenso alptraumhaftes wie poetisches Werk schuf.
2011, ein Jahr nach ihrem Tod, wäre die Grande Dame 100 Jahre alt geworden. Die Fondation Beyeler widmete ihr damals eine eindrückliche Schau, in der man tief in die Abgründe der Künstlerin abtauchen konnte. Die aktuelle Ausstellung «Louise Bourgeois x Jenny Holzer. The Violence of Handwriting Across A Page» im Kunstmuseum Basel ist ganz anders, aber nicht minder sehenswert. Aufgezeigt wird nun die Wichtigkeit von Text im Werk der Künstlerin. Das erstaunt nicht, denn Kuratorin der Schau ist die 1950 geborene US-amerikanische Konzept- und Installationskünstlerin Jenny Holzer (in Kooperation mit Anita Haldemann), die vor allem für ihren subversiven Umgang mit Sprache bekannt ist. Holzer kombiniert in ihren Installationen schillernde, visuelle Effekte – oft in Form von LED-Leuchttafeln – wie man sie aus der Werbung kennt, mit verstörenden Textbotschaften. Seit den 70er-Jahren «schmuggelt» sie dabei sogenannte «Truisms» unter die Leute. Es sind allgemeingültige Bonmots wie «Fehlender Charme kann fatal sein», oder auch Statements und Aphorismen von bekannten Dichterinnen und Dichtern, die sie an unterschiedlichsten Orten anbringt.
Doch obwohl ihr Medium Text ist, besteht Holzer darauf, eine bildende Künstlerin zu sein, die von Malerei und Skulptur beeinflusst ist, von Künstlern wie Joseph Beuys, Bruce Naumann oder Donald Judd. Mit Louise Bourgeois verbindet sie das Interesse an menschlichen Emotionen, ebenso wie die Idee, dass aus Text Bild werden kann. Die Werke von Bourgeois verteilt Holzer in neun Räumen im Neubau des Kunstmuseums, ausserdem platziert sie die mechanische Arbeit «Twosome» (1991) in der Passage, die den Neubau mit dem Hauptbau verbindet. Es ist die Überleitung zum Hauptbau, wo Holzer vier Skulpturen und eine Zeichnung von Bourgeois Werken aus der Sammlung gegenüberstellt. Es ist Bourgeois Lieblingsfarbe Rot, die in dieser Schau dominiert. In der Farbe, die man gemeinhin mit Blut, Leidenschaft, Liebe oder Gefahr in Verbindung bringt, schuf die Künstlerin zahlreiche Gouachen, die in Basel dicht gehängt, einen ganzen Raum füllen.
Rot ist etwa das Selbstporträt von 2008 oder auch die Handschrift von Bourgeois, die das zur Ausstellung erschienene Künstlerbuch ziert: «Obsession or confusion» – Obsession oder Verwirrung. Beides ist in dieser Schau Programm, die Überforderung garantiert. Man taucht ein in ein Werk in dem Text und Bild eng verzahnt sind. «Ich will, dass die Leute Louise um sich herum sehen, hören, kichernd bestaunen, spüren», sagte Holzer anlässlich der Pressekonferenz.
Und tatsächlich hat man beim Betrachten der Werke oft das Gefühl, etwas sehr Intimem und doch Allgemeingültigem beizuwohnen. Textile Arbeiten kommen wie Votivgaben daher: «Delivrez – nous du mal» – «Befreit uns vor dem Bösen» stickte Bourgeois etwa auf ein mit einer Rose dekoriertes Stück Stoff. Die Kreatur, die an der Wand befestigt an eine Fledermaus erinnert, trägt ihr Übriges dazu bei, dass sich manche Pandemie Geschädigte von den hier gezeigten, teil apokalyptischen Worten und Bildern besonders angesprochen fühlen mögen.
Gabriele
Eine Frau malt. Eine Frau fährt Velo. Eine Frau reist. Na und? Es war nicht immer selbstverständlich und ist es in gewissen Teilen der Welt immer noch nicht. Doch Gabriele Münter (1877-1962) hatte Glück. Sie stammte aus guten Verhältnissen, hatte früh geerbt und war finanziell unabhängig. Sie gilt neben Paula Modersohn-Becker als bekannteste Vertreterin des deutschen Expressionismus, war Mitglied der Neuen Künstlervereinigung München und Mitbegründerin der Malergemeinschaft «Der Blaue Reiter» Lange Zeit wurde sie jedoch vor allem als Lebensgefährtin von Wassily Kandinsky (1866-1944) wahrgenommen und von ihrem eigenen, als progressiv geltenden Umfeld als naive und intuitiv arbeitende Künstlerin rezipiert. So wurde ihr Anteil an der Redaktion des Almanachs «Der Blaue Reiter» ausgeblendet und ihr Werk vor allem auf die gemeinsame Zeit mit Kandinsky für interessant befunden.
Die umfassende Retrospektive im Zentrum Paul Klee, die in Kooperation mit der Gabriele Münter- und Johannes Eichner Stiftung entstand, korrigiert diese Sichtweise und zeigt neben Gemälden, Zeichnungen und Drucken auch ihr fotografisches Werk, das Münters Reisen dokumentiert. Am stärksten ist Münter, wenn sie andere Frauen porträtiert hat. Insgesamt vier Fünftel der insgesamt 250 Porträts, die sie im Laufe ihres Lebens geschaffen hat, sind Frauendarstellungen.
Olga von Hartmann, deren Porträt Münter um 1910 schuf, ist zur würdigen Werbeträgerin der Ausstellung geworden. Wenn Kandinsky Blau für sich gepachtet hat, dann ist es bei Münter das Grün, das besonders besticht. Olga von Hartmann, die 1885 in Sankt Petersburg geboren wurde und aus einer kunstaffinen Familie der Oberschicht stammte, gehörte zum russisch-deutschen Kreis rund um Kandinsky und Münter. 1908 kam es in Murnau am Staffelsee für Kandinsky und Münter zur Zusammenarbeit mit Marianne von Werefkin und Alexej Jawlensky. Deren progressiver Einfluss führte Kandinsky und Münter letztlich zur expressionistischen Malerei.
Das Porträt, das Münter von Olga von Hartmann schuf, zeigt die junge Frau in rotem Kleid und hellgrüner Bluse vor Grünem Hintergrund. Dieser freie Umgang mit Farbe – auch im Haar der Porträtierten gibt es Grünanteile – sowie die Gestaltung – das mit markanten, wenigen Pinselstrichen erfasste Gesicht – zeichnen Münter als Pionierin des neuen Stils aus. Über das Genre des Portraits schrieb sie Folgendes: «Bildnismalen ist die kühnste und schwerste, die geistigste, die äusserste Aufgabe für den Künstler. Über das Portrait hinaus zu kommen, kann nur fordern, der noch nicht bis zu ihm vorgedrungen ist.»
Auch in Form von Farblinolschnitten porträtierte Münter Frauen. Mit «Aurélie» (1906) scheint die Künstlerin gar die Pop Art vorwegzunehmen, denn man muss unweigerlich an Andy Warhols Porträts berühmter Menschen denken. Sehr heutig wirkt ihre «Dame im Sessel, schreibend», von 1929, lässig, aber modisch gekleidet und in etwas scheinbar Wichtiges vertieft, könnte sie ebenso gut eine Frau des 21. Jahrhunderts sein.
Giorgia
Bevor man die Ausstellung betritt, geht man durch einen Korridor mit schwarzweissen Fotografien einer meist ernst blickenden Frau: Es ist die Künstlerin Giorgia O’Keeffe (1887-1986), aufgenommen von dem Galeristen und Fotografen Alfred Stieglitz, der die Künstlerin 1924 heiratete und insgesamt mehr als 300 Fotografien von ihr anfertigte.
Wie mit einer Kamera herangezoomt sind auch die Blumenbilder, die nebst Landschaften und Schädeln zum Berühmtesten gehören, was die Künstlerin schuf. Als erotisch wurden sie oft beschrieben, erinnern diese «Nahaufnahmen» doch auch an weibliche Genitalien.
Die Fondation Beyeler in Riehen widmet der Künstlerin nun eine Retrospektive mit 85 Werken aus öffentlichen und privaten Sammlungen, mehrheitlich aus den USA. Kuratorin Theodora Vischer zeigt Ölgemälde, Zeichnungen und Aquarelle, wobei ersichtlich wird, dass bei O’Keeffe die gegenständliche Malerei stets parallel zur abstrakten bestand. Die Schau beginnt mit einem Blick auf frühe Arbeiten. Bereits in diesen kleinformatigen Aquarellen – darunter Wolkenformationen und schneckenartige Gebilde – ahnt man die später folgenden Farbexplosionen.
Dabei war O’Keeffes Weg zu einer ganz Grossen nicht gerade selbstverständlich. Sie wurde als zweites von sieben Kindern in Wisconsin geboren. Ihre Eltern waren Milchbauern, die nach dem Verkauf der Farm mit der Familie nach Virginia zogen. Schon früh äusserte sie den Wunsch, Malerin zu werden. Ihre Mutter ermöglichte ihr noch im Kindesalter Unterricht bei einer Aquarellistin. Im Alter von 20 Jahren brach sie nach New York auf und studierte an der Art Students Leage in New York.
Dort traf sie auch ihren künftigen Ehemann Stieglitz, der in seiner Galerie 291 die europäische Moderne förderte. Stadtansichten wie das Ölgemälde «Strasse in New York mit Mond» (1925) sind eher eine Seltenheit. Das Bild fasziniert durch seine graphische Komposition, wobei eine Strassenlaterne, eine rote Ampel und der Mond als Lichtquellen fungieren. Menschen gibt es keine. Wichtiger als Urbanität war der Künstlerin stets die Natur. So malte sie am Lake George, einem See in der Nähe New Yorks das Wasser, Kastanienbäume und Blätter.
Im Sommer 1929 reiste sie nach New Mexico und zeigte sich tief beeindruckt von den dortigen Landschaften. Aufgestellte Büsserkreuze oder Tierschädel wurden hier zu ihren Motiven. Nach dem Tod ihres Mannes liess sich O’Keeffe dauerhaft in New Mexico nieder und verstarb im Alter von 98 Jahren in Santa Fe.
Im Gegensatz zu vielen anderen Künstlerinnen hatte O’Keeffe schon zu Lebzeiten grossen Erfolg gehabt. Mit Stieglitz hatte sie einen mächtigen Förderer und Mäzen an ihrer Seite. 1943 erhielt sie am Art Institute of Chicago ihre erste grosse Retrospektive. In Europa sind die Originale eher selten zu sehen. Ihre erste grosse Ausstellung erhielt sie in den 90er-Jahren in London. In der Schweiz war es die Kuratorin Bice Curiger, die Giorgia O’Keeffe 2003 ins Kunsthaus Zürich brachte.
Info: Ausstellungen – Gabriele Münter, bis 8. Mai, Zentrum Paul Klee, Bern; Giorgia O’Keefe, bis 22. Mai, Fondation Beyeler, Riehen; Louise Bourgeois x Jenny Holzer, bis 15.Mai, Kunstmuseum, Basel.
«Wir gingen damals auf die Barrikaden»
Annelise Zwez ist seit den 70er-Jahren als Kunstkritikerin tätig. ImGespräch erinnert sie sich an Zeiten, in denen Frauen in Ausstellungen übergangen wurden – und erzählt, wo sie beim Fördern von Frauen in der Kunstwelt noch Potenzial sieht.
Interview: Helen Lagger
Annelise Zwez, plötzlich zeigen alle grossen Institutionen Frauen. Ist das aus Ihrer Sicht ein kurzfristiger Trend oder ein Engagement, das anhalten wird?
Annelise Zwez: Für mich ist das Kalkül, denn aufgrund der breiten gesellschaftlichen Diskussion um die Vertretung von Frauen in jeglichen Gremien, können die grossen Kunst-Institutionen nun sicher sein, eine grosse Zahl von Besuchenden, auch bisherige Nichtmuseums-Gängerinnen, zu generieren. Spannender sind jene Häuser, die wirklich innovative Werke von Künstlerinnen zeigen. Ich denke, bei den kleineren Museen gibt es noch Potenzial auszuschöpfen, sie könnten noch vermehrt interessante Frauen zeigen. Die Gabriele Münter-Ausstellung im Zentrum Paul Klee empfinde ich eindeutig als ein Surplus, man hat ihr Werk bisher noch nicht in einem solchen Umfang gesehen.
Im Kunstmuseum Bern ging gerade die Meret Oppenheim-Ausstellung zu Ende. Auch sie war eine Künstlerin, die oft verkannt wurde …
Ich fand es besonders interessant, dass man alle Phasen der Künstlerin erleben konnte. In meiner Generation hat man immer gesagt: Sprecht nicht immer vom Frühwerk. Man hat stets die späte Oppenheim, jene ab den 50er-Jahren hervorgehoben.
Wenn das verstärkte Frauen-zeigen ein momentaner Hype ist – kann das auch kontraproduktiv sein?
Ich glaube es nicht. Das Gleichgewicht wird sich von selbst wieder ausbalancieren. Wir brauchen eine Balance zwischen Künstlerinnen und Künstlern, sonst überdrehen wir das Rad.
Wie gut steht Biel in punkto Parität da?
Felicity Lunn (ehemalige Direktorin des Kunsthaus Pasquart, Anmerkung der Redaktion) hat es in den letzten Jahren grossartig gemacht. Sie hat zahlreiche Künstlerinnen zum ersten Mal in der Schweiz oder zum ersten Mal mit einer Einzelausstellung präsentiert. Sie hat aufgezeigt, wie viel Potenzial vorhanden ist.
Wie sieht es in Biel bei den Galerien und Off-Spaces aus?
Ich habe beim Off Space Lokal-Int nachgeschaut und bin zum Schluss gekommen, dass dort Parität herrscht. Auch an den für Biel wichtigen Veranstaltungen wie dem «Joli mois de mai» sind Frauen gleich stark vertreten wie Männer. Es erstaunt auch nicht, da meines Wissens heute mehr Frauen an Kunsthochschulen studieren als Männer. Wo es vielleicht noch hapert, ist insbesondere bei den privaten Sammlungen, wo bisher Werke von Frauen seltener angekauft wurden. Möglicherweise hatten die bestimmenden Männer zu Kunst von Männern eher Zugang.
Welche Künstlerinnen aus der Region oder darüber hinaus sollten aus Ihrer Sicht schon lange eine Schau bekommen?
Das kann ich eigentlich klar sagen: Es fehlt noch immer eine Übersichtsausstellung, welche all jene Künstlerinnen zeigt, die spätestens um 1980, zum Teil schon früher, zu eigenem Kunstschaffen aufgebrochen sind, zu einer Kunst, die sich nicht mehr an den männlichen Traditionen orientierte, sondern das eigene weibliche Ich auf vielfältige Weise thematisierten. Das Spektrum reicht von Miriam Cahn und Monika Dillier bis hin zu Annette Barcelo, Ruth Berger und Ruth Himmelsbach. Von Heidi Bucher über Bignia Corradini bis zu Rosina Kuhn und Astrid Keller. Von Manon über Ilona Rüegg und Leiko Ikemura, sie lebte damals in der Schweiz, bis zu Lis Kocher. Auch eine Ausstellung, die der grossmehrheitlich von Frauen ausgeübten Kunst mit textilen Materialien, die so lange diskriminiert wurde, die retrospektiv Reverenz erweist, ist überfällig.
Was ist der Beitrag, den eine ausgewogene Berichterstattung leisten kann und soll?
Ich war in den 80er-Jahren notorisch dafür bekannt, dass ich bei jeder Ausstellung die Anzahl Frauen erwähnt habe, und zwar im positiven wie im negativen Sinne. Das hat nicht allen Kuratorinnen und Kuratoren gepasst, aber es war mir ein Anliegen.
Sie sind mit Ihren Belangen angeeckt?
Natürlich, das gehört zum Job einer Kritikerin dazu. Aber es ist natürlich auch so, dass man sich an Dispute eher erinnert. Einmal regelrecht auf die Barrikaden gegangen sind wir Frauen an einem Podiumsgespräch, weil die Frauen in der Sammlung vom Kunsthaus Zürich regelrecht Mangelware waren.
Wie selbstverständlich war Kunst von Frauen in den 80er-Jahren?
Es gab natürlich bereits viele gute Künstlerinnen. Ich erinnere mich an eine Ausstellung – ebenfalls im Kunsthaus Zürich – des Kurators Guido Magnaguagno zum Thema Camera Obscura respektive Fotografie ohne Kamera. Es wurden ausschliesslich Künstlerinnen, unter ihnen zum Beispiel Cécile Wick, präsentiert und so kamen auch ausschliesslich Kunstkritikerinnen an die Pressekonferenz. Magnaguagno sagte damals diplomatisch: Wer könnte besser als ihr über diese Schau schreiben?
Die Frage, ob es so etwas wie weibliche Kunst gibt, wurde oft gestellt. Wie stehen Sie dazu?
Am Anfang der feministischen Welle, als Aufbruchsstimmung herrschte, ging es häufig um weibliche Selbstfindung und Hinterfragung. Da hat man schon oft gedacht: Das muss Kunst von einer Frau sein. Heute würde ich das eher verneinen. Man findet noch einzelne Momente, aber insgesamt spielt das Geschlecht keine so grosse Rolle mehr. Momentan ist Transgender das grosse Thema. Ich habe nichts dagegen. Aber es ist schon auch ein Hype.
Welche Ausstellungen von Männern haben Sie in letzter Zeit gesehen und geschätzt?
Ich frage mich tatsächlich, wann und wo ich denn in letzter Zeit eine überzeugende Einzelausstellung eines Mannes gesehen habe. In Genf ein 70er-Jahr-Fluxus-Künstler vielleicht. Und, ach ja, den Francis Alys in Lausanne und Zürich und den Julian Charrière in Lugano und daselbst auch den Nicolas Party – doch es gibt sie noch!