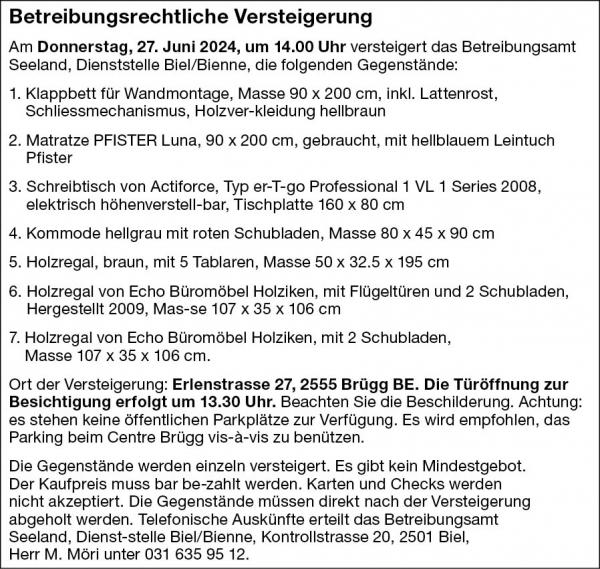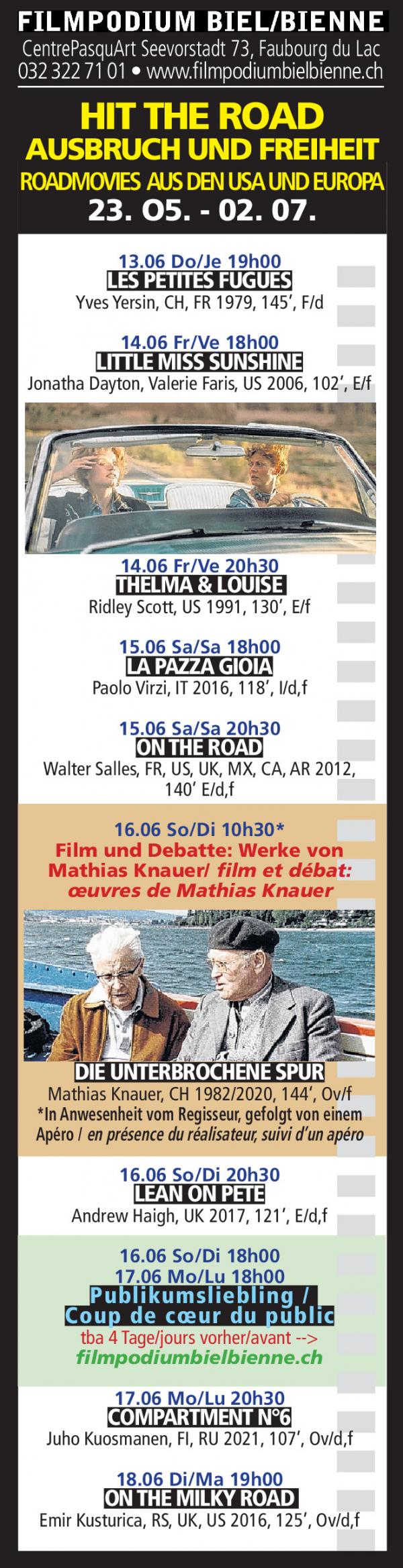- Dossier
Annelise Alder
«Schweigen ist schlecht», sagt Bruno Meyer, Produzent zahlreicher Jugendsendungen und -filme sowie Leiter der ehemaligen Fernsehsendung «Zischtigs-club». Meyer war als junger Mann politisch aktiv, er trat der POCH, der Progressiven Organisation der Schweiz, bei und ist einer von hundert Persönlichkeiten, die Ueli Mäder in seinem Buch «68 – was bleibt?» zu seinen damaligen Aktivitäten interviewt hat. Doch der Autor wollte von Meyer auch wissen, was er als Vater zweier Söhne der nächsten Generation raten würde. Meyer fordert statt Passivität Engagement und aktive Debatte. Sein Motto: «Was zählt, sind Erfahrungen».
Jürg Marquard, der damals die Zeitschrift «Pop» herausgab, rät der jungen Generation Ähnliches, wenn er sagt: «Geht euren Weg und tut es mit Leidenschaft». Sowohl Marquard wie Meyer haben vorgelebt, was sie dem Nachwuchs raten: Sie haben sich an den politischen Protesten und am Aufbruch im Jahre 1968 aktiv beteiligt. Jeder auf seine Art freilich, denn die Beteiligten hatten unterschiedliche Ziele im Visier.
Funken liessen Lage explodieren
Die 68er-Revolte, das wird in Ueli Mäders Buch früh deutlich, ist nicht eine einzige Bewegung und auch keine, die sich auf eine kurze Zeitspanne reduzieren lässt. Das illustriert auch die Methodik des Autors. Er lässt die damaligen Ereignisse aus der Perspektive zahlreicher Persönlichkeiten aus Schweizer Wirtschaft, Politik, Kultur oder Journalismus schildern. Der politische, gesellschaftliche und kulturelle Aufbruch, der in den grossen Protestbewegungen im Jahr 1968 gipfelte, hatte sich langsam angebahnt. Treibende Kräfte waren die Bürgerrechtsbewegung in den USA und der Vietnamkrieg. Dazu kamen die antikolonialen Bewegungen in Afrika, die Befreiungsbewegungen der indigenen Bevölkerung in Lateinamerika, der Nahost-Konflikt und die globale atomare Aufrüstung.
In der Schweiz prallten der wirtschaftliche Aufschwung und eine starre konservative Gesellschaft aufeinander, in der die Frau auf vielen Ebenen diskriminiert wurde. Das politische Klima war vom Kalten Krieg geprägt. Es wurde aufgerüstet, denn «die rote Gefahr» stand vor der Tür, was auch zur Folge hatte, dass der Staatsschutz kritische Personen in einer «Extremisten-Kartei» registrierte.
Es brauchte nur noch die sprichwörtlichen Funken, um die gespannte Lage zum Explodieren zu bringen. Dazu gehört die Ermordung von Che Guevara, Martin Luther King und Rudi Dutschke. Der Papst verbot die Pille, und der umstrittene Schah von Persien besuchte Berlin, was grosse Studentenproteste zur Folge hatte, die in der Ermordung des Studenten Benno Ohnesorg gipfelten. Doch auch der Prager Frühling, der von den Sowjets brutal niedergeschlagen wurde, löste in der Schweiz grosse Empörung aus.
Widerspruch provoziert Widerstand
Demonstrationen und Sit-ins gab es in Lugano, Zürich, Basel, Bern oder Biel. Die Protestierenden lehnten sich gegen das Unrecht in der Welt auf und forderten etwa an den Universitäten mehr Mitbestimmung und eine liberale Gesellschaft. Damals war nicht nur das Konkubinat verboten. Frauen brauchten die Einwilligung des Ehegatten, um einer berufliche Tätigkeit nachzugehen oder ein Bankkonto zu eröffnen. Viele Frauen kämpften auf der Strasse für das Recht auf Abtreibung oder für das Frauenstimmrecht.
Eine, die sich mit journalistischen Mitteln dafür einsetzte, war Regula Renschler. In der Zeitschrift «Neutralität» schrieb sie auch gegen die Diskriminierung von Schwarzen an und engagierte sich gegen den Neokolonialismus.
In Bern trafen sich politisch Interessierte und kulturell Engagierte im Café des Pyrenées oder im Diskussionskeller Junkere 37. Mit dabei: Sergius Golowin, Peter Bichsel Kurt Marti, Harald Szeemann oder Reynold Tschäppät. Ziel war, wie Peter Vollmer sagt, «die Überwindung der Enge der bürgerlichen Gesellschaft». Und er ergänzt: «Der Widerspruch zwischen der Mondlandung und ihren unbegrenzten Möglichkeiten und den Millionen von Menschen, die hungerten mobilisierte Widerspruch». Auch die Kunst war betroffen: «Kunst musste plötzlich gesellschaftlich und politisch relevant sein», sagt der Filmemacher Fredi Murer.
Gemeinsam war allen Personen und damaligen Organisationen, so Mäder, «das systemkritisch Nonkonforme, das demokratische Prozesse ausweiten will, neue Freiheiten für alle anstrebt und sich kulturell unkonventionell ausdrückt.»
Es bleibt viel zu tun
«Was bleibt?», heisst der Untertitel des 367 Seiten starken Buches. Die Einschätzungen der befragten Personen fallen so unterschiedlich aus wie ihre Biografien. Die vielfältigen Meinungen bilden zudem die Krux des Buches: Zwar ist es interessant, Einblick in die Lebensläufe der einzelnen Persönlichkeiten, die teils heute noch im öffentlichen Fokus stehen, zu erhalten. Doch sie lenken in ihrer detailreichen Ausführung oft von einer stringenten Darstellung der vielschichtigen Ereignisse ab und stören den Erzählfluss.
Heute ist in Sachen liberaler Gesellschaftsordnung vieles erreicht worden, wofür damals gekämpft wurde. Aber auch dies: «Viele 68er wurden selbstgerecht und dienten nur noch dem Staat», meint Filippo Leutenegger, selbst einmal ein «autonomer Sponti» und heute FDP-Stadtrat in Zürich. Ein wichtiger Erfolg war in seinen Augen der erfolgreiche Widerstand gegen das Kernkraftwerk Kaiseraugst.
Helmut Hubacher, vormaliger SP-Präsident meint: «Der 68er-Aufbruch half vor allem Frauen, sich mehr durchzusetzen». Doch die 68er-Bewegung hatte auch grossen Einfluss auf seine Partei, die er präsidierte: Die SP mutierte von einer autoritär geführten Arbeiterpartei zu einer linken Volkspartei. Und Ruth Gurny sagt: «Die Akzeptanz von gesellschaftlicher Vielfalt nahm sicher zu».
Doch auch Ueli Mäder konstatiert, dass viele, die sich damals engagierten, sich bald für den Gang durch die Institutionen entschieden, der Beruf klar vor die Politik gestellt, das öffentliche Engagement zugunsten eines privaten Strebens eingetauscht wurde. Und er folgert daraus: «Die strukturelle Demokratisierung lässt auf sich warten. Es bleibt wohl viel zu tun».
Was auch deutlich wird und was die verschiedenen Einzelschicksale verbindet: Nur indem man sich einmischt, zur Debatte anregt und sich «einer Organisation oder einer Gruppierung anschliesst», kann man auf ein Anliegen aufmerksam machen und etwas bewirken. Die 68er haben vorgemacht, wie man sich gegen Ungerechtigkeit auflehnt und gezeigt, dass - gewaltfreies - politisches und gesellschaftliches Engagement durchaus zum Erfolg führen kann.
Info: Ueli Mäder, 68 – was bleibt?, Zürich: Rotpunktverlag, 367 Seiten, 48 Franken.