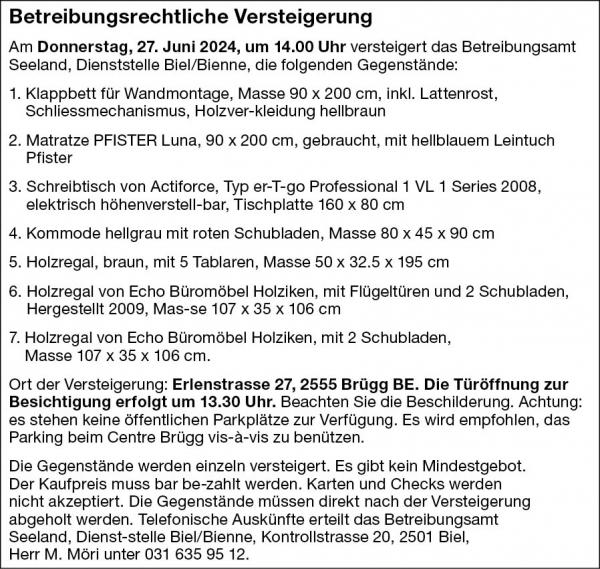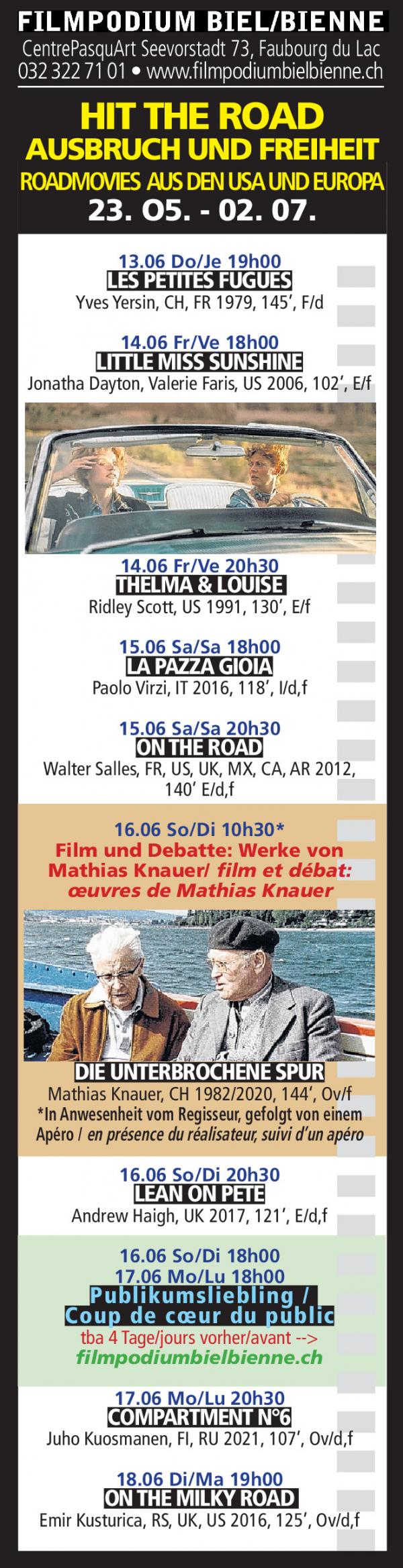Tobias Graden
Plötzlich sagt Thomas Hirschhorn: «Ich mache jetzt Werbung. Weil ich das darf.» Er hält den Flyer des Crowdfundings für die Robert-Walser-Sculpture in die Höhe und erläutert, wie man die sich im Aufbau befindende Plastikausstellung unterstützen kann.
Ja, Thomas Hirschhorn darf das an diesem Mittwochabend, einfach so unvermittelt Werbung machen. Der Künstler hat sich in der Bieler Stadtbibliothek eingefunden, um mit dem Bieler Musiker und Komponisten Urs Peter Schneider zu diskutieren. Besser gesagt: ein Zwiegespräch zu führen. Auf dem Tischchen vor den beiden steht eine Sanduhr. Nach etwa dreieinhalb Minuten ist sie jeweils abgelaufen, so lange haben Schneider und Hirschhorn jeweils Zeit, ihre Gedanken auszuführen, dann geht das Wort ans Gegenüber. Schneider hat sich diese Form ausgedacht: Ein Hin und Her wäre weniger interessant, sagt er, man wolle keine Kampfsituation schaffen, sondern ein paritätisches Gespräch führen.
Es ist diesen beiden Künstlern halt auch ganz wohl, wenn ihre Rede nicht durch Gegenfragen unterbrochen wird, stellt der Zuhörer im Lauf der 66 Minuten fest. Am interessantesten wäre dieses Konzept ja, wenn der Eine den Gedanken des Andern weiterspinnen würde, doch das ist hier nur bedingt der Fall – was aber überhaupt nicht heissen muss, dass wenig Interessantes und Ergiebiges herauskommt, im Gegenteil.
Theoretisches, Anekdotisches
Naheliegend, dass das Zwiegespräch mit Robert Walser beginnt. Nicht nur Hirschhorn hat zu ihm eine enge Beziehung, sondern auch Schneider – in einem kürzlich erschienen Leserbrief liess er es sich nicht nehmen, darauf hinzuweisen, dass er «als Walser-Komponist und Walser-Spezialist ersten Ranges bezeichnet werde, und zwar aufgrund von Kompetenz, von Leistungen wie etwa Aufführung oder Expertisen». Damit sei er, wie er sagt, in den 70er-Jahren in Biel eine Randerscheinung gewesen: «Ich war wohl einer von drei, die ihn kannten.» Damals erarbeitete Schneider für das Radio eine von Walser ausgehende Komposition, in der er die Struktur eines Spaziergangs mit den Mitteln der Musik abbildete: Was dem Spaziergänger nah ist, geht rasch vorbei, was er entfernt sieht, klingt länger nach.
Solche kompositionstheoretischen Überlegungen kontrastiert Hirschhorn mit Anekdotischem. Mit dem für Walser so wichtigen Spazieren habe er wenig anfangen können, so Hirschhorn, zu viel habe er in seiner Jugend in Davos wandern müssen: «Ich war gut darin, aber ich hasste es.» Das verbindende Element macht er vielmehr im Umstand fest, dass er wie Walser ein Adoptivkind war – im Nachhinein betrachtet er dies als wichtigen Baustein auf dem Weg zum Künstler: «Es ist eine Chance. So muss man sich selbst erfinden.» Und wie seine Familie ihn adoptiert habe, so habe er dann später die Kunstwelt adoptiert.
Schneider mag noch nicht vom Spazieren lassen. Dieses sei bei Walser eine Metapher für sein ganzes Leben gewesen: «Am Schluss ist alles wie zerbrochen, er ist wie gar nicht mehr da», sagt Schneider und zitiert aus der «Hinrichtungsgeschichte»: «Wie ein schwaches Licht aus weiter Ferne schaute ihn sein ihm bereits fremd gewordenes Dasein an.»
«Man kann ja von Grazie reden», ergänzt Hirschhorn, «das muss man erst mal schaffen, an einem 25. Dezember auf einem Spaziergang im Schnee zu sterben.» Und so erst noch ikonisch fotografiert zu werden: «Wie viele Fotos toter berühmter Menschen gibt es? Nicht viele!»
Seine Musik will Zumutung sein
Doch wozu allzu viel von Walser reden, wenn man selber Vita und Werk vorweisen kann? Schneider erzählt vom Spannungsfeld zwischen verheissungsvollen Karriereaussichten, dem Wunsch zu komponieren und der Leidenschaft zu lehren, das im Credo mündete, stets Avantgarde zu sein: «Ich will etwas tun, das andere noch nicht gemacht haben. Da war Kreativität gefragt, doch davon hatte ich genug.» Er erzählt von Stockhausen, bei dem er gelernt hat, von Cage, mit dem er gearbeitet hat, und von der Minimal Music: «Kann man schon brauchen, ist aber zu oberflächlich.»
Bei Hirschhorn führte der Weg zum Künstler über den Misserfolg. Der romantische Wunsch, Teil eines kommunistischen Grafikerkollektivs in Paris zu werden, zerschellte rasch an den realen Verhältnissen in dieser Gruppe. Eine mögliche Erklärung: «Weil ich zu kreativ war.» Es folgten Jahre, in denen Hirschhorn selbständig grafische Arbeiten ohne Auftraggeber anfertigte, «Grafik von mir aus», bis ihn sein Umfeld nach acht Jahren aufwachen hiess: «Mit 33 habe ich meine Arbeit in das Feld der Kunst gestellt, ich habe in die Kunstgeschichte eingegriffen, und von da an war alles einfacher.» Hirschhorn nennt diese Selbstermächtigung «den emanzipatorischen Weg der Kunst».
Doch Kunst braucht auch ein Publikum, einen Widerhall, eine Reaktion. Auch wenn viele Menschen ihre Komfortzone nur ungern verlassen, wie Schneider feststellen musste. Seine Musik aber solle gerade nicht verführen wie ein Popsong, so Schneider, sie wolle Zumutung sein, man möge sie sich doch zur Brust nehmen, auch wenn man sie nicht verstehe.
«Oberfläche ergibt Kontakt»
Damit Kunst entsteht, braucht es aber schlicht auch... Geld. Bei Schneider hat die Lehrtätigkeit dazu beigetragen, einen «Fundus an Geld» anäufnen zu können; «und wenn ich mehr einnehme als ich ausgeben muss, dann mache ich ein Projekt». Schneider kann sich also Grosszügigkeit leisten: Bisweilen verschenkt er CDs und Bücher, auf dass sich die Beschenkten von seiner Kunst eben gerade nicht den Ärmel reinnehmen lassen.
Und Hirschhorn? «Meine Arbeit ist in Kontakt mit der Realität, und die Frage des Geldes gehört zu dieser Realität, in der ich lebe, ich lehne sie nicht ab. Geschenkt werde einem nichts, doch er sei bereit zu kämpfen. Ob sein Schlusswort eine Replik auf Schneiders Kunstbegriff ist? Hirschhorn erzählt von seiner Faszination für Andy Warhol, obwohl diesem Oberflächlichkeit vorgeworfen worden sei: «Ich mag Warhol, gerade weil da Oberfläche ist. Oberfläche ergibt Kontakt. Wenn nur Tiefe da ist, gibt es keinen Kontakt. Und Kontakt ist Begegnung.»