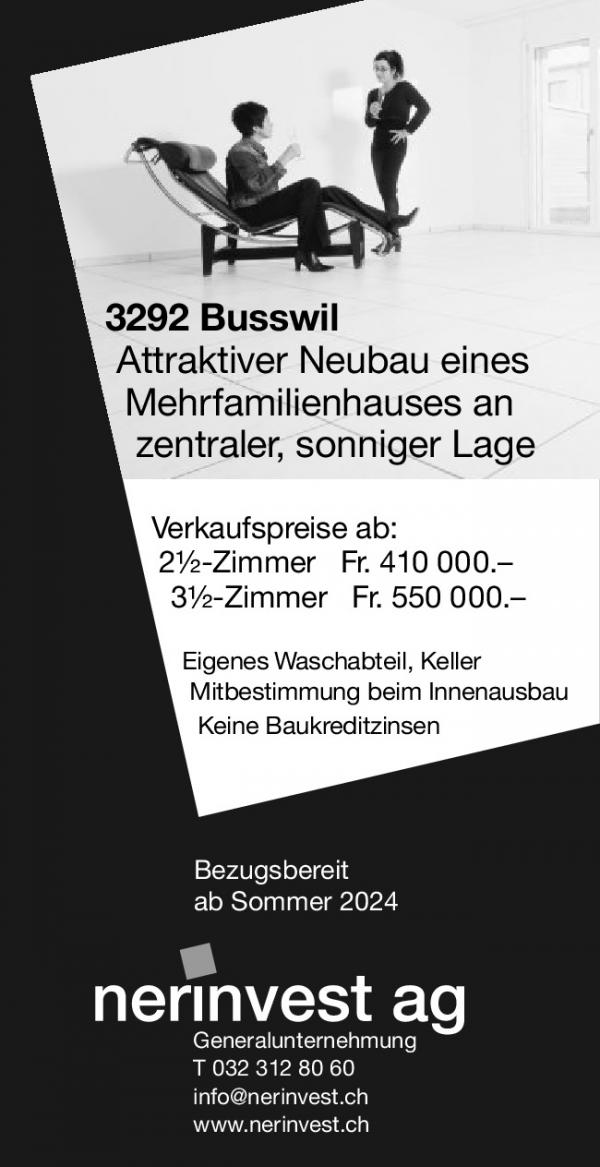Helen Lagger
Eine Studie behauptet: Wenn wir uns mit Freunden zusammen ablichten lassen, wirken wir attraktiver, als wenn wir allein auf einem Bild zu sehen sind. Zu zweit, zu dritt oder zu viert – gemeinsam ist irgendwie immer besser als von allen guten Geistern verlassen. Seit dem Ausbruch von Corona ist das soziale Leben stark eingeschränkt. Viele sitzen zuhause und fühlen sich einsam. Psychologen und Ärzte wissen es schon lange: Das kann auf Dauer krank machen.
Doch nicht immer war der Begriff so negativ besetzt wie heute. So richtig frostig und ausweglos wurde die Einsamkeit erst mit dem Einsetzen der Moderne bewertet. Der französische Dichter Charles Baudelaire (1821-1867), der als Wegbereiter der Moderne gilt, schrieb in seinem Hauptwerk «Die Blumen des Bösen» über den Grossstadtmenschen und dessen «Ennui», einer grundsätzlichen Entfremdung gegenüber dem Dasein. Verdruss und Langeweile betrachtete Baudelaire als die grössten Herausforderungen des modernen Menschen.
Eine kleine Erzählung des Dichters dreht sich um das, was viele von uns im Moment tun: Die Zeit totschlagen. In Baudelaires Episode fährt ein galanter Herr in weiblicher Begleitung mit der Kutsche in einen Pariser Park aus – eine für die Zeit typische bürgerliche Freizeitbeschäftigung. Doch dem Gelangweilten reicht das nicht. Er begibt sich schliesslich an einen Schiessstand und will dort auf die Zeit selbst schiessen.
Eine Möglichkeit,die Welt zu verstehen
Heute erscheint uns das in den Park Fahren mit einer Kutsche als geradezu verwegenes, romantisches Abenteuer. Der Mensch des 21. Jahrhunderts greift zum Smartphone, schaut Netflix oder liest ein Buch über Achtsamkeit, die ihm scheinbar abhanden gekommen ist, wenn er Zeit totschlagen will. Durch die aktuelle Krise sind viele zu unfreiwilligen Eremiten geworden, die nur noch durch einen Bildschirm hindurch Einblick in fremde Stuben, Klassenzimmer, Museen oder Gotteshäuser haben.
Je länger der Lockdown dauert, desto mehr wächst unsere Sehnsucht nach echten Begegnungen, nach echter Unterhaltung, nach einem Draussen, das uns stimuliert. Der «Spleen baudelairien» hat viele von uns fest im Griff. Die Frage, wie man diese unfreiwillige Isolation positiv nützen könnte, treibt uns um. Möglicherweise hilft ein Blick in die Vergangenheit, als das Gefühl der Einsamkeit noch nicht so negativ wie heute konnotiert war.
In der Antike war Einsamkeit eine Möglichkeit, die Welt zu verstehen. Abgeschiedenheit galt als Chance, sich auf sich selbst zu besinnen. «Wenn ich allein bin, bin ich am wenigsten allein», soll der Konsul und Schriftsteller Marcus Tullius Cicero gesagt haben.
Im Mittelalter wurde die Einsamkeit mit Religion verquickt. Die Isolation sollte es erlauben, Gott zu finden und sich von den sündhaften, weltlichen Verlockungen fernzuhalten. In der darauf folgenden Renaissance kam man zum Schluss, dass Seelenfrieden auch ohne Religion zu erreichen sei. Zunehmend zogen sich Dichter und Denker zurück, um ihre persönliche Entwicklung voranzutreiben.
Der Welt entfliehen,um Grosses zu schaffen
Im 18. Jahrhundert und 19. Jahrhundert wurde die Einsamkeit regelrecht zum Kult. Dichter und Künstler entflohen bewusst der Welt, um Grosses zu Schaffen. Wochenschriften wie «Der Einsame» oder «Der Einsiedler» erscheinen und Komponisten wie Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) huldigten dem als erhaben empfundenen Gefühl des Alleinseins. «O Einsamkeit! Wie sanft erquickst du mich, wenn meine Kräfte früh ermatten! Mit heisser Sehnsucht such’ ich dich: So sucht ein Wandrer, matt, den Schatten», heisst es in Mozarts Lied «An die Einsamkeit».
Die Romantiker trieben die Verklärung noch weiter voran. Der Dichter Ludwig Tieck baute in sein Kunstmärchen «Der blonde Eckbert» (1797) das Fragment «Waldeinsamkeit» ein. Der Wald galt ihm und seinen Zeitgenossen als Symbol eines unschuldigen Idylls.
Das widerspiegelt sich auch in der Malerei jener Zeit. Der deutsche Maler Caspar David Friedrich (1774-1840) schuf mit dem um 1818 entstanden Gemälde «Der Wanderer im Nebelmeer» das vielleicht berühmteste Bild einer selbst gewählten Abgeschiedenheit. Ein Mann von hinten steht aufrecht auf einem Felsen und blickt auf dichten Nebel. Mit dieser anonym bleibenden Rückenfigur sollen wir uns identifizieren können. Seine Kleidung verweist nicht auf einen Bergsteiger, sondern vielmehr auf einen städtischen Ausflügler.
Allein ist man im Wald nicht – schön ist es allemal
Solche gibt es im Moment vermehrt. Ein Virus treibt viele Städterinnen und Städter in die Natur. Die Kaffees sind geschlossen, die Boutiquen auch, Freunde sollte man nicht besuchen. Plötzliche gehen alle spazieren und stellen fest: Allein ist man im Wald zwar nicht unbedingt – schön ist es allemal. Und zum Glück haben wir ein Smartphone dabei, um schnell zu checken, ob jemand unsere selbst fotografierte, auf Instagram gepostete Waldidylle geliked hat. Wir rufen in den Wald und sind froh, dass es heraus schallt: «Du bist nicht allein. Da draussen sind ein paar andere digitale Eremiten.»