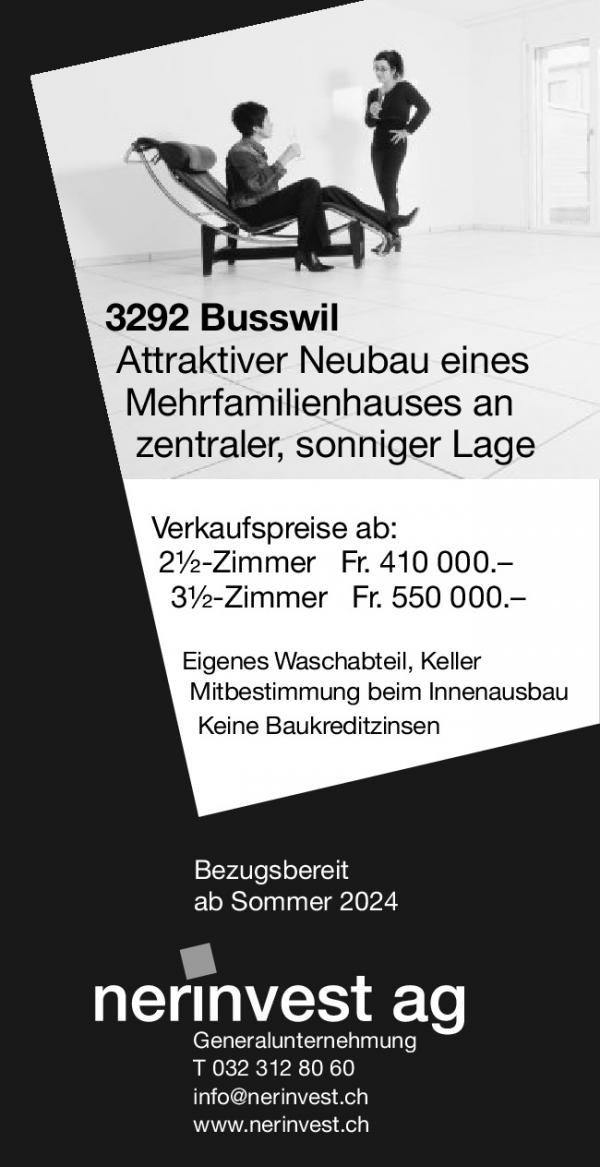Interview: Tobias Graden
Felicity Lunn, warum haben Sie genug von Biel?
Felicity Lunn: Es ist nicht so, dass ich genug von Biel hätte! Ich war nun zehn Jahre als Direktorin des Kunsthauses Pasquart hier tätig, und für mich persönlich ist es ein guter Zeitpunkt, um weiterzuziehen.
Sie haben diese Woche zum letzten Mal die neuen Ausstellungen im Kunsthaus Pasquart eröffnet. Ist da auch ein bisschen Wehmut dabei?
Auf jeden Fall. Es ist schwierig, Biel und das Kunsthaus zu verlassen und die vielen Menschen, die ich hier kennengelernt habe. Ich bin ohnehin von Natur aus ziemlich sentimental – ich habe gewusst, dass es mir nicht leicht fallen würde.
Wie würden Sie mir als Laien, der mit Kunst nicht viel Mut hat, einen Besuch der aktuellen Ausstellungen nahelegen?
Ich würde Ihnen raten, sie intuitiv auf sich wirken zu lassen. Beide Ausstellungen sind sehr materialistisch, stimmungsvoll, installativ und auf unterschiedliche Art und Weise überraschend. Ich würde Ihnen also raten, sich zu fragen: Wie fühlen Sie sich dabei? Umgeben von diesen Vorhängen, diesem Holzbalken oder im monumentalen Raum der Salle Poma mit diesen Stangen? Wie wirken diese Textilien auf Sie? Welche Assoziationen kommen hoch bei Ihnen?
Was kann ich für mein Leben mitnehmen, wenn ich Ihrem Rat folge und mich darauf einlasse?
Sie werden vertraute Objekte sehen, aber in einer ganz anderen Form. Das kann für Sie ein Zauber sein, etwas Fantastisches, aber auch irritierend oder eine Provokation. Wenn ich dabei wäre, würde ich Ihnen gerne erzählen, was die Künstlerin und der Künstler im Sinn hatten. Stéphanie Saadé etwa kommt aus Beirut, sie erzählt die heftige Geschichte ihres Landes und davon, wie das Kollektive mit dem Persönlichen zusammenkommt. Das würde ich Ihnen gerne vermitteln.
Ich lerne also etwas, aber ich muss bereit sein, mich darauf einzulassen.
Wenn Sie zeitgenössische Kunst anschauen, ohne dass Sie bereit sind, sich darauf einzulassen, dann dürfte sie Ihnen verschlossen bleiben. Das gilt ja für viele andere Erlebnisse im Leben auch. Ich hoffe, dass die Besucher nicht einzig mit dem Ziel der Unterhaltung kommen. Sondern ich hoffe, dass sie neugierig sind, interessiert, und dass sie auch bereit sind, nicht alles zu verstehen. Das finde ich ganz wichtig: Dass man von zeitgenössischer Kunst nicht erwartet, alles zu verstehen, denn es geht nicht allein um Verständnis – sondern um Gefühle, Emotionen, Wirkung.
Und dann darf ich mich auch ärgern oder sagen, das finde ich nun nicht gut?
Natürlich. Ich würde es allerdings schade finden – und es würde mich interessieren, warum Sie zu dieser Meinung kommen.
Ist es Ihnen wichtig, dass das Kunsthaus auch für ein Publikum zugänglich ist, das sich nicht sehr oft mit Kunst beschäftigt?
Natürlich. Ich wollte hier nie nur ein Publikum haben, das ohnehin schon immer da gewesen ist. Ich und mein Team haben immer versucht, nach draussen zu gehen, andere Publika anzusprechen, die Schwellenangst abzubauen.
Ist das in einer traditionellen Industrie- und Arbeiterstadt wie Biel schwieriger als anderswo?
Wir haben ein treues Kernpublikum, aber dieses ist in Biel sicherlich kleiner als etwa in Zürich, Basel oder Genf. Unsere Besucherzahlen sind aber Jahr für Jahr gestiegen, insofern haben wir Erfolg. Wir ziehen zunehmend auch Publikum aus der ganzen Schweiz an, auch von ausserhalb der Schweiz. Und ich weiss, dass wir auch neue Besuchende gewinnen konnten, auch aus Biel. Aber das ist durchaus der Bereich, in dem ich mehr hätte erreichen wollen. Damit bin ich allerdings nicht alleine, meine Kolleginnen und Kollegen in anderen Kunsthäusern oder Theatern dürften alle das gleiche sagen.
Was hat Ihnen persönlich die Kunst gegeben in Ihrem Leben bislang?
Extrem viel. Sie hat mir Welten eröffnet. Ich habe gesehen, wie Künstlerinnen und Künstler denken, was für sie wichtig ist, welche Risiken sie eingehen, wie sie sich aussetzen, indem sie Kunst machen. Sie hat mir andere Kulturen gezeigt, die ich zuvor wenig gekannt habe. Sie hat mir meinen Horizont erweitert und sie hat meine Fähigkeit gestärkt, meine eigenen Emotionen zu verstehen oder zu äussern. Kunst ist ein Kern meines Lebens.
Was war Ihre erste Begegnung mit Kunst?
Meine Eltern haben mich und meine Schwester zu klassischen Ausstellungen in London mitgenommen, zu Impressionisten oder anderen bekannten Strömungen der Kunstgeschichte. Ich bin nicht in London aufgewachsen, wir sind also zwei Stunden im Zug nach London gereist, um eine bestimmte Ausstellung anzuschauen. Zeitgenössische Kunst habe ich erst später kennengelernt.
Gibt es ein bestimmtes Kunstwerk, das Sie über das ganze Leben begleitet hat, zu dem Sie immer wieder zurückkehren können?
Es gibt ein Kunstwerk, das mir sehr stark in Erinnerung geblieben ist, weil ich auf meinem Weg zur Arbeit während etwa eines Jahres immer wieder daran vorbeigegangen bin. Dieses Werk existiert nicht mehr. Es ist von der britischen Künstlerin Rachel Whiteread und hiess «House». Sie ist bekannt dafür, dass sie Abgüsse aus Beton von Mobiliar oder Räumen gemacht hat. Mit «House» hat sie ein ganzes viktorianisches Haus abgegossen, bevor dieses abgerissen wurde. Man hat also alles verkehrt gesehen, das Werk war das Negativ des Hauses. Das war unglaublich beeindruckend, es war so mächtig, immer waren Leute da und haben es angeschaut.
War dieses Werk ein Stück Heimat oder hat es etwas in Ihnen ausgelöst, das geblieben ist?
Es war extrem berührend, weil es mit dem Ende von etwas zu tun hatte, so wie ein Mausoleum. Aber es bildete auch die Schichten von verschiedenen Leben ab, die sich in diesem Haus über die Jahre abgespielt hatten. Man hatte gehofft, dass das Werk bleiben könnte, aber die Gemeinde hatte entschieden, dass es wieder abgerissen werden müsse. Das hat diese melancholische Empfindung noch verstärkt.
Ich habe gehört, dass Sie sich vor allem stark für Malerei interessieren.
Das stimmt. Es ist ein Medium, das mich immer wieder berührt. Ich liebe diese zweidimensionale Fläche, auf der aber so viel geschieht – mit der Leinwand, mit der Farbe, aber auch als Fiktion. Es ist ein Medium, das nie komplett ausgelotet sein wird.
Es gibt heutzutage so viele Bilder, sie können digital so leicht erzeugt werden – ist es nicht erstaunlich, dass die Malerei überhaupt noch angestrebt wird?
Malerei findet in Wellen immer wieder neues Interesse. Im Moment sind wir gerade in einer solchen. Es gibt viele junge Schweizer Künstlerinnen und Künstler, die malen. In anderen Ländern ist das noch ausgeprägter, etwa in Deutschland. In Frankreich ist es extrem. Dexter Dalwood, der 2014 bei uns ausgestellt hat, hatte zuvor eine Ausstellung in Frankreich. Man sagte ihm, er sei der erste Maler seit 15 Jahren. Aber in den letzten beiden Jahren hat die junge Generation in Frankreich das Malen wieder entdeckt. Für sie ist es eine Nische, die sie besetzen können, weil ihre Vorgänger nicht malen. Ich hatte mir für Biel vorgenommen, mindestens einmal im Jahr eine grosse Einzelausstellung zu Malerei zu machen, auch weil es ungewöhnlich ist. Damit konnte man dem Kunsthaus Pasquart ein Profil geben, mit den Jahren sind wir dafür bekannt geworden.
Wie sehen Sie denn aktuelle Entwicklungen, etwa NFTs? (Non-Fungible Token, also ein nicht ersetzbares digital geschütztes Objekt, Anm. d. Red.) Man fragt sich ja, ob mehr hinter dem Hype steckt, als dem Kunstmarkt neue Anlagemöglichkeiten zu verschaffen.
Die Auktionshäuser haben nun angefangen, NFTs anzuerkennen, Galerien ziehen auch nach. Das Digitale, Virtuelle ist für den Kunstbetrieb auf jeden Fall wichtig. Es ist auch für uns wichtig, dass wir nicht nur traditionelle Medien zeigen, sondern dabei bleiben bei dem, was junge Künstlerinnen und Künstler tun. Ob NFTs den Ausstellungsbereich beeinflussen werden, lässt sich allerdings noch nicht beurteilen.
Für ein Museum dürfte es schwierig sein, NFTs dem Publikum zu vermitteln, schon nur, weil das Werk nicht physisch vorhanden ist.
Das sehe ich auch so. Es dürfte eher ein Thema für den Markt sein.
Apropos Markt: 2019 wurde an der Art Basel in Miami eine angeklebte Banane des Künstlers Maurizio Cattelan für 120000 US-Dollar verkauft. Fragen Sie sich in solchen Momenten auch, was das soll?
Man muss unterscheiden zwischen dem finanziellen Wert eines Kunstwerks und seinem inhaltlichen, ästhetischen Wert. Bei dieser Banane dachte ich auch: «Wow, das ist ganz viel Geld für eine Banane.» Aber als Idee, als Konzept ist das Werk durchaus interessant.
Vor Ihrem Engagement im Pasquart waren Sie Kuratorin für die Schweiz der Kunstsammlung der UBS. Warum war es mit knapp drei Jahren Ihre kürzeste Station?
Ich wollte unbedingt zurück in eine öffentliche Institution gehen. Ich bin froh, habe ich diese Arbeit bei der UBS gemacht, ich habe viel gelernt. Aber ich fand es schwierig, im Kontext einer Grossbank Kunst zu vertreten.
Was tut denn eine Grossbank wie die UBS mit ihrer Kunst?
Die Sammlung diente dazu, Kunst für die eigenen Räume zu haben, für die Mitarbeiterbüros und die Kundenzimmer. Wie bei Firmensammlungen oft üblich, ging es natürlich auch um Status. Die Sammlung hatte den Glanz der Bank zu repräsentieren, Werte wie Erfolg, Vermögen, Luxus. Ich habe gerade während der Finanzkrise angefangen, und da hat sich die UBS überlegt, die Sammlung zu verkaufen. Aber verglichen mit den sonstigen Verlusten wäre das Peanuts gewesen.
Aus künstlerischer Sicht ist es wohl nicht das Interessanteste, eine solche Sammlung zu betreuen.
Vor der Krise hat die UBS damit Ausstellungen gemacht, dann nicht mehr. Es ist sicherlich gerade für die Künstlerinnen und Künstler weniger interessant, wenn ihre Werke in Kundenzimmern einer Bank gezeigt werden und nicht in öffentlich zugänglichen Ausstellungen. Anderseits gibt es in der Schweiz durchaus interessante Sammlungen von Unternehmen, die Zürcher Kantonalbank beispielsweise. Da sind viele Kunstschaffende glücklich, wenn ihre Arbeiten von solchen Sammlungen gekauft werden – allerdings vor allem dann, wenn über die Jahre eine Sammlung ihrer Arbeiten entwickelt wird, wenn wirklich Interesse daran besteht.
Was hat Sie dann bewogen, nach Biel zu kommen?
Ich kannte das Kunsthaus Pasquart bereits zuvor, es ist in der Schweizer Kunstszene seit Langem ein Begriff. Ich wollte wieder ein Haus leiten und fand die Konstellation hier mit den Partnerorganisationen spannend, ebenso die Situation mit der Zweisprachigkeit. Es gibt viele Elemente, die dieses Haus einzigartig machen.
Wenn man Ihre Stationen überblickt – London, Freiburg im Breisgau, Biel –, dann könnte man zum Schluss kommen, es sei ein Abstieg vom Zentrum in die Peripherie.
(lacht herzhaft)
Sie sehen das nicht so?
Es ist mir auch aufgefallen. Aber nach London hätte ich wohl einzig nach New York gehen können, um in einer noch grösseren Stadt zu sein. Im Ernst: Das hat mit meinem Privatleben zu tun. Ich bin vor 20 Jahren in die Schweiz gekommen mit meiner «alten» Familie, also meinem Ex-Mann und den Kindern, die damals noch klein waren. Und hier hat es nun mal keine Grossstädte, die man mit London oder Paris vergleichen kann – auch Zürich ist relativ klein. Aber ich mag kleinere Städte, deswegen habe ich auch in Freiburg gearbeitet.
Haben Sie denn in Biel die Resonanz gefunden, die Sie sich wünschen?
In vieler Hinsicht ja. Jene Leute, die ich kenne hier, sind sehr offen und neugierig, das habe ich sehr geschätzt. Ich wollte überraschen, ich wollte nicht die gängigen Kunstschaffenden zeigen, die gerade an der letzten Biennale in Venedig waren. Sondern ich wollte Künstlerinnen und Künstler nach Biel bringen, die in ihrem Herkunftsland schon bekannt waren, die ein Werk vorweisen konnten, aber noch keine Einzelausstellung in der Schweiz gehabt haben. Da gab es eine Offenheit, eine Bereitschaft, solche Künstler zu besprechen.
Sie haben Biel auf die internationale Kunst-Landkarte gesetzt, das ist ein Urteil, das über Ihr Wirken in der Kulturszene gefällt wird. War das bewusst ein Ziel von Ihnen?
Natürlich. Es ist ein tolles Haus, und ich wollte natürlich, dass unsere Ausstellungen im Ausland bekannter werden, dass das Kunsthaus Pasquart ein Begriff ist. Das ist einerseits durch die Kunstschaffenden selber geschehen, anderseits aber auch durch Kooperationen mit Kunsthäusern in anderen Ländern.
Als Kehrseite wird allerdings oft gesagt, das Pasquart sei zu wenig mit Biel verbunden, auch was die Ausstellungen betrifft. Es gibt die Cantonale und die eine geforderte Ausstellung pro Jahr, die regionsbezogen sein muss, aber darüber hinaus hat man offenbar das Gefühl: Hier ist Biel, und da ist das Kunsthaus. Kann man diese Gratwanderung – das Pasquart auf die internationale Landkarte setzen und gleichzeitig ein Haus für Biel sein – gar nicht zur Zufriedenheit aller meistern?
Doch, man kann das. Es ist wichtig, dass man jongliert. Dass man das Lokale, das Nationale und das Internationale balanciert. Ich finde, dass wir hier das gut machen. Ich kenne diese Kritik. Aber ich würde sagen, es ist eine Minderheit der Menschen in Biel, die das sagen. Und: Ich finde, sie hat nicht recht.
Warum?
Wir machen hier mehr mit lokalen Kunstschaffenden als die meisten Häuser einer solchen Grösse. Es ist heute recht ungewöhnlich für ein Haus dieser Grösse, dass es einmal im Jahr eine grosse Ausstellung mit einer lokalen Position veranstaltet. Und das steht übrigens nirgends in den Statuten, sondern ich habe das von meiner Vorgängerin übernommen, weil ich es wichtig finde, dass wir auch für die lokale Szene da sind. Bei der Cantonale achten wir darauf, dass etwa ein Drittel der Kunstschaffenden aus Biel kommt. Und wir haben das Projekt auf der Wiese, das ist auch eine wichtige Struktur. Und es gibt weitere Formate, an denen lokale Kunstschaffende beteiligt sind. Nicht zu vergessen die Kooperationen, die wir angestrebt haben: So gab es beispielsweise 2018 eine grosse Ausstellung zum Thema «Zeitspuren» zusammen mit dem Neuen Museum Biel und dem Photoforum Pasquart. Und wenn nicht Corona ist, gibt es das Pasquartfest, das wir hier zusammen feiern. Ich finde zudem, es braucht in Biel nicht noch eine weitere Institution für die lokale Szene. Es gibt etwa das Lokal-int, und nun gibt es Die Krone/La Couronne, die vor allem für das hiesige Schaffen da ist.
Es scheint, als treffe Sie diese Kritik.
Ich bin nicht die einzige Kuratorin, die dieses Thema kennt. Es gibt genug Kollegen – nicht nur in der Schweiz –, die von der lokalen Kunstszene dieselbe Kritik zu hören bekommen. Ich bin offen für Kritik, aber mich nervt, wenn sie nicht auf Fakten basiert.
Wie haben Sie denn das Kulturleben in Biel wahrgenommen?
Es ist sehr reich. Für eine mittelgrosse Stadt geschieht hier wirklich viel. Es ist eine gute Mischung von etablierten Häusern und vielen kleineren Sachen. Ich habe das Musikfestival Ear We Are miterlebt, ich bin begeistert vom FFFH. Bekannt ist Biel wohl vor allem für die Musik.
Biel gefällt sich, gerade was die Kulturszene betrifft, in einer gewissen Rebellen-Rolle, es gibt eine starke Alternativszene.
Ja, und darin gibt es einige Leute, die aus Prinzip nicht ins Kunsthaus kommen, weil wir das Establishment repräsentieren.
Tatsächlich?
Ich habe das so gehört.
Hat diese Alternativszene für Ihre Arbeit auch eine Rolle gespielt?
Ja, wir haben beispielsweise eine Beziehung mit dem Lokal-int gepflegt. Das ist zwar ein kleiner Raum, aber mit einer grossen Wirkung. Aber was heisst schon «alternativ»? Im Herbst haben wir im Pasquart eine Ausstellung eines Künstlers, den man vor allem über das Lokal-int kennt (Laurent Güdel, Anm. d. Red.). In Biel sind die Grenzen sehr fliessend, mir käme es nie in den Sinn zu sagen: Diese Leute gehören in die alternative Szene, diese nicht. Die Szene in Biel ist eh immer ein bisschen alternativ.
Welche von Ihren Ausstellungen ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben und warum?
Ich habe meine Favoriten. Katie Paterson etwa, eine schottische Künstlerin. Sie hat einen sehr konzeptuellen Ansatz, sie arbeitet mit Nuklearphysikern, Astronauten oder Geologen. Sie vermittelt sehr komplexe Ideen, über den Tod der Sterne beispielsweise, oder die Geschichte der Sonnenfinsternisse. Aber sie tut dies mit sehr zugänglichen, vertrauten Materialien wie einer Discokugel oder Glühbirnen. Das ist ein gutes Beispiel für eine Arbeit, die sehr konzeptuell ist, gleichzeitig aber sehr sinnlich.
Gab es auch Ausstellungen, mit denen Sie letztlich nicht ganz zufrieden waren?
Oh, dazu sage ich nichts (lacht herzlich).
Sie könnten ja jetzt, es besteht kein Druck mehr.
Ich habe meine Ausstellungen genug reflektiert, sodass ich mir sicher war, wenn ich jemanden eingeladen habe. Doch natürlich gibt es ein paar wenige Ausstellungen, bei denen ich von gewissen Aspekten nicht absolut überzeugt war. Aber das sind Ausnahmen.
Sie haben viele internationale Künstlerinnen und Künstler nach Biel gebracht, nicht zuletzt aus dem englischsprachigen Raum. Viele von ihnen dürften erst mal gesagt haben: Biel – wo ist das?
Fast alle haben Biel vorher gar nicht gekannt. Aber wie gesagt: Das Gleichgewicht war mir wichtig. Aus dem englischsprachigen Raum gab es übrigens viel weniger Kunstschaffende, als man meinen könnte. Es leben zwar viele in London, aber sie sind ursprünglich nicht englischsprachig. Ich habe gezählt: In den zehn Jahren waren es «bloss» neun britische Kunstschaffende.
Was hat sie überzeugt, nach Biel zu kommen?
Manche habe ich schon vorher gekannt, sie gehören zu meinem Netzwerk, das hilft natürlich. Viele aber nicht. Sie habe ich entdeckt oder ihre Arbeit kennengelernt. Niemand war skeptisch gegenüber Biel. Es war ja auch meine Aufgabe, sie zu überzeugen. Ich habe Ihnen die Räume beschrieben, Pläne geschickt, sie haben unsere Website angeschaut und nachgesehen, wer vor ihnen hier schon ausgestellt hat.
Spielen für die Kunstschaffenden dabei auch Marktüberlegungen eine Rolle; denken sie sich: In der Schweiz bekannt zu werden, das kann nicht schaden?
Nein, ich glaube nicht. Galeristen denken vielleicht so, aber die Kunstschaffenden selber weniger. Für sie ist es wichtig, in einem tollen Gebäude auszustellen, wo ihre Arbeit ernst genommen und gut gezeigt wird und wo sie Vertrauen zur Kuratorin haben.
Apropos Gebäude: Wie haben Sie das Pasquart als Ort wahrgenommen? Es ist sicherlich nicht einfach, diese Mischung aus altem Spital und Neubau.
Ich finde, es war ein riesiges Privileg, in diesem Gebäude Ausstellungen zu kuratieren. Es ist so flexibel, und die Böden sind fantastisch im Vergleich zu anderen Schweizer Kunstmuseen.
Warum sind gerade die Böden so wichtig?
Die Böden sind wichtig für das Dreidimensionale, aber das ist ein Detail. Ich finde diese Kombination aus altem Spital und Anbau wirklich grossartig. Das Gefüge zwischen den beiden Teilen ist sehr gut gelöst. Die Künstlerinnen und Künstler haben es sehr geschätzt, ihre Arbeiten in beiden Teilen ausstellen zu können, denn man kann so eine Arbeit auf sehr unterschiedliche Weise zeigen.
Vermutlich hat kaum ein Haus in der Schweiz in den letzten zehn Jahren so viele Frauen ausgestellt wie das Pasquart. War Ihnen dies besonders wichtig?
Wenn das so wahrgenommen wird, dann bin ich sehr glücklich. Ich habe das absichtlich nie an die grosse Glocke gehängt. Doch als ich angefangen habe, war es für mich klar, zumindest 50 Prozent Frauen zu zeigen. Das ist dann zu einer Art Konzept geworden.
Warum?
Aus zwei Gründen. Es gibt viele fantastische Künstlerinnen in allen Medien. Und zweitens sind wir dafür bekannt geworden. Es gibt viele tolle Kunstmuseen in der Schweiz, da ist es wichtig, ein Profil zu entwickeln, eine Identität. Nicht dass ich die Kunstschaffenden oder ihre Kunst instrumentalisieren möchte, aber dass wir viele Frauen zeigten, hat unser Profil schon geschärft.
Gibt es Dinge, die Sie gerne realisiert hätten, die aber mit dem zur Verfügung stehenden Budget nicht möglich waren?
Wir haben es geschafft, ab 2016 mehr Subventionen zu erhalten, das war eine grosse Errungenschaft, es brauchte viel Lobbyarbeit. Zuvor waren wir unterfinanziert. Nun, man passt sich an. Klar, es gibt Künstlerinnen, die ich sehr schätze, und wenn ich in einer anderen Stadt, einem anderen Haus, mit einem anderen Budget gearbeitet hätte, hätte ich sie eingeladen. Aber hier habe ich an jene Künstler gedacht, die für Biel und diese Architektur und unser Budget realistisch waren. Sowieso: Es geht nicht nur um meinen Geschmack und meine Vorlieben. Ich habe zwar nur Leute eingeladen, die ich sehr schätze und bei denen ich viel Potenzial gesehen habe, doch es ging natürlich auch darum, dass ihre Arbeit für unser Publikum interessant sein könnte, dass sie etwas zeigen, das man hier noch nicht gesehen hat. Ich wollte überraschen, auch mal provozieren. Ich wusste beispielsweise, dass die Ästhetik von Emma Talbot für die Schweiz ungewohnt sein würde.
Kulturbudgets sind gerade in einer Stadt wie Biel auch immer unter Druck. Was wäre, wenn das Kunsthaus Pasquart sparen müsste?
Das wäre sehr schwierig. Viel abspecken geht wirklich nicht. Wir schauen sehr zum Geld, sind sehr bescheiden und sparsam. Und wir machen viel mit einem im Vergleich zu anderen Kunsthäusern in anderen Städten bescheidenen Budget. Und: Wir haben hier viel Raum – das kostet.
Sie wechseln nun als Leiterin des Fachbereichs Gestaltung und Kunst an die Hochschule der Künste Bern. Was reizt Sie an dieser Aufgabe?
Mich reizt, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die am Anfang ihrer künstlerischen Karriere stehen. Es ist ein Privileg, in meiner Position und meinem Alter etwas davon zurückgeben zu können, was ich aus meiner Erfahrung, aus meiner Arbeit mit Kunstschaffenden gewonnen habe.
Sind Sie künftig also Talentspäherin?
Klar habe ich die Fähigkeit entwickelt, Kunst einzuschätzen, zu analysieren. Aber ich bin an der HKB nicht in der Rolle des Scouts. Sondern ich werde den Fachbereich leiten und mit vielen Spezialisten zusammenarbeiten.
Werden Sie an der HKB das direkte Gestalten nicht vermissen?
Ich werde sicherlich das Kuratieren vermissen, die Gestaltung von Ausstellungen. Das nehme ich in Kauf. Ich werde auch das Publikum vermissen. Die Stelle ist aber mit 80 Prozent dotiert, und ich habe vor, auch weiterhin als unabhängige Kuratorin tätig zu sein.
Bleiben Sie mit Biel verbunden?
Natürlich! Ich habe Freunde hier, ich werde an Vernissagen kommen, in eine Ecke stehen und alle beobachten und schauen, wie es ist, auf der anderen Seite zu sein. Ich denke, man kann nicht zehn Jahre in Biel gelebt haben, ohne eine grosse Zuneigung für die Stadt entwickelt zu haben.