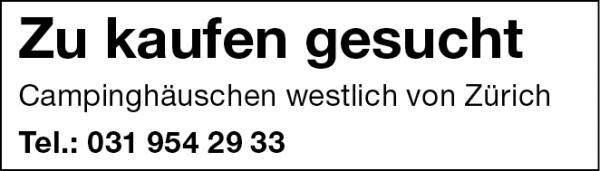In ungefähr jährlichen Perioden treten die Wandersterne wieder in die gleiche alte Bahn ein, was die spätmittelalterlichen Astronomen als «revolutio» (Zurückdrehen, Zurückwälzen) bezeichneten. Als dieser Begriff im 18. Jahrhundert in den Bereich des Politischen übertragen wurde, war damit zunächst gemeint, dass eine Macht bekämpft werden musste, welche die «natürliche» gesellschaftliche Ordnung pervertiert hatte. Eine Revolution war das Zurückdrehen der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse zum vermeintlich ursprünglichen Zustand, der, weil der natürlichen Ordnung entsprechend, der bessere war. Das entsprach dem naturrechtlichen Denken der Aufklärungszeit. Die amerikanische Revolution war ein Aufstand gegen den englischen König, der als Despot angesehen wurde, weil er die ursprünglichen Rechte und Freiheiten der amerikanischen Kolonisten verletzt habe. Diese Rechte wieder herzustellen, war das deklarierte Ziel der Aufständischen. Dass die Revolution dann effektiv etwas Neues oder «Fortschrittliches» hervorbrachte, konstatierte man erst im Nachhinein.
Im 19. Jahrhundert nahm der Begriff der Revolution die Idee des Fortschritts in sich auf. Der Gang der Geschichte schien sich zu beschleunigen. Wissenschaftliche Entdeckungen, technische Innovationen, Wachstum der Städte wurden als grandiose Fortschritte der Menschheitsentwicklung empfunden. Man sprach von industrieller Revolution. Wo die gesellschaftlichen und politischen Strukturen den Fortschritt hemmten, entstanden politische Bewegungen, die die Hemmnisse beseitigen wollten. Manchmal schien dies nur möglich zu sein, wenn die politische Herrschaft gestürzt wurde. So geschah es in den Jahren 1830/31 im Kanton Bern: Die Oberschicht in den bernischen Landstädten und Landgemeinden empfand die selbstherrliche Regierung der Patrizier der Stadt Bern nachgerade als unerträglich. Durch eine Verfassungsänderung sollte sie beseitigt werden. Es gab aber damals statt einer ausführlichen Verfassung nur eine sogenannte «Urkundliche Erklärung», in der die Regierung ein paar Grundsätze ihrer Herrschaft darlegte. Eine Revision war nicht vorgesehen. Wer sich für eine Änderung einsetzte, begab sich in die Illegalität und konnte schnell als Hochverräter abgeurteilt werden. Deshalb war ein harmonischer Übergang zum neuen, besseren Zustand unmöglich. Der Rahmen der Legalität musste gesprengt werden.
Die revolutionäre Bewegung war getragen von Männern wie den Gebrüdern Schnell in Burgdorf, den Bloesch und Neuhaus in Biel und Stockmar im Jura. Sie wollten mehr Rechte für die Landstädte und Landgemeinden, mehr Freiheit für «das Volk». Sie wurden als Liberale bezeichnet. Ihre konservativen Gegner hiessen «Aristokraten». An mehreren grossen Volksversammlungen wurde der Umsturz vorbereitet. Bewaffnete Garden wurden aufgestellt. Die patrizische Regierung musste abdanken. Der Weg war frei für die Wahl eines Verfassungsrats, der die liberale Verfassung von 1831 schuf. Damit war noch keine Demokratie im heutigen Sinn geschaffen, aber die Voraussetzungen dafür waren besser. 1846 kam die nächste Verfassungsrevision, die nun ganz in legalen Bahnen ablief und die Volksrechte stärkte. Weitere Etappen folgten. Der Weg zur modernen Demokratie, die alle Volksschichten einschloss, war lang und voller Konflikte. Daran sollten wir uns erinnern, wenn wir die Revolutionen in arabischen und afrikanischen Ländern oder in der Ukraine betrachten, die nicht auf einen Schlag verwirklicht haben, was sich viele davon erhofften.
Info: Tobias Kaestli ist freischaffender Historiker und lebt in Magglingen.
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden oder Registrieren.