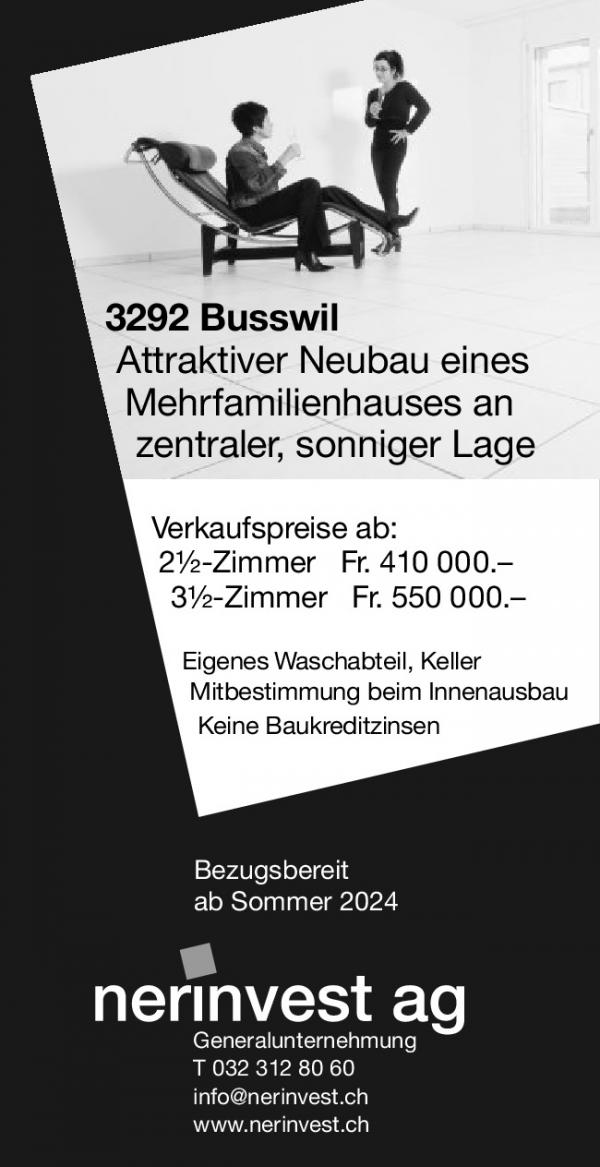Interview: Tobias Graden
Aymo Brunetti, im Bericht der Expertengruppe, die Sie geleitet haben, fordern Sie strengere Kapitalvorschriften für die Grossbanken. Schärfere Regulierungen stossen aber bei den Banken nur bedingt auf Verständnis. Wird sich dies mit Tidjane Thiam ändern, dem neuen CS-Chef?
Aymo Brunetti: In der Expertengruppe waren auch die Grossbanken vertreten. Die Empfehlungen zu «Too big to fail», die der Bundesrat übernommen hat, wurden im Konsens erarbeitet, sie werden also auch von den Grossbanken mitgetragen. Sie haben nur eine einzige Fussnote angebracht, in der sie als Minderheitenposition eine gewisse Einschränkung wollen. Ich gehe deshalb nicht davon aus, dass der Chefwechsel grosse Auswirkungen haben wird.
Ist der Eindruck also falsch, wonach sich die Banken politisch gegen schärfere Regulierungen wehren?
Sie haben natürlich nicht Freude an zusätzlichen Kapitalanforderungen. Aber die Sichtweise der Expertengruppe war eine gesamtwirtschaftliche. Und in diesem Blickwinkel ist klar, dass die Grossbanken nach wie vor «Too big to fail» sind und deshalb weitere Massnahmen nötig sind. Die Expertengruppe hat im Konsens neun Empfehlungen formuliert. Die Banken teilen die Einsicht, in welche Richtung es gehen muss.
Sie haben schon 2013 empfohlen, den automatischen Informationsaustausch einzuführen. Rechte Kreise kritisierten stets das «Einknicken» vor dem ausländischen Druck – und jetzt hat eine der systemrelevanten Grossbanken einen schwarzen, muslimischen Ivorer zum Chef. Was sagt dies aus?
Ich würde das nicht politisch interpretieren. Es sagt in erster Linie aus, dass Grossbanken global tätige Unternehmen sind, die auf dem Markt die weltweit besten Kräfte haben wollen. Der Schweizer Finanzplatz kann nicht globale Bedeutung haben wollen und sich gleichzeitig gegen globale Entwicklungen und Regeln stemmen. Das ist ja gerade der Grund, warum man etwa beim Informationsaustausch in die international akzeptierte Richtung geht: Dass man ermöglichen will, aus der Schweiz heraus nachhaltig globale Finanzmärkte beliefern zu können. Mit einer Inselstrategie wäre das rasch vorbei.
Sie haben im Dezember 2012 gesagt, in zwei bis drei Jahren werde die Schweiz wieder aus dem Franken-Euro-Mindestkurs aussteigen müssen. So gesehen war also der Januar 2015 ein guter Zeitpunkt.
(lächelt) Der Zeitpunkt kam auch für mich total überraschend, ich kann keine prognostischen Fähigkeiten in Anspruch nehmen.
War es ein guter Zeitpunkt?
Das ist eine Frage, die nicht mehr interessant ist, denn es gibt kein Zurück mehr. Die Möglichkeit eines solchen Mindestkurses gibt es für die nächsten Jahre, wohl gar Jahrzehnte nicht mehr. Nun müssen wir schauen, wie wir im neuen System zurechtkommen.
Sie haben früher einen schrittweisen Ausstieg aus dem Mindestkurs als Möglichkeit erwähnt. Dies ist nicht passiert.
Das war unter der Annahme, dass der Franken bei 1.20 mit der Zeit nicht mehr überbewertet gewesen wäre. Zum heutigen Zeitpunkt, mit diesen Turbulenzen im Euroraum, glaube ich nicht mehr, dass ein schrittweiser Ausstieg möglich gewesen wäre. Die Finanzmärkte hätten die schrittweisen Grenzwerte sofort attackiert und es hätte extreme Interventionen gebraucht.
Zurzeit pendelt der Kurs um 1.07 – wird das so bleiben?
Wenn ich das wüsste, wäre ich reich… In erster Linie hängt der Kurs vom weiteren Verlauf der Eurokrise ab. Ein Austritt Griechenlands etwa würde die Risiken bedeutend erhöhen.
Was ist aus Ihrer Sicht der wahrscheinlichste Verlauf der nächsten Monate?
Was man zumindest vermuten kann: Wenn keine zusätzlichen grossen Schocks kommen, gibt es kaum weiteren starken Aufwertungsdruck. Aber das ist ein grosses «wenn».
Wie beurteilen Sie die Situation um Griechenland? Die neue griechische Regierung hat in der EU für Irritation gesorgt.
Ich habe seit drei Jahren befürchtet, dass in Griechenland – und längerfristig auch in anderen Krisenländern – eine populistische Regierung an die Macht kommen könnte, die sich um die verlangten Reformen foutiert. Und das ist sehr besorgniserregend.
Finanzminister Varoufakis spricht doch schlicht die Wahrheit aus, wenn er sagt, das Programm habe bislang Griechenland mehr geschadet als genützt, weswegen der Einsatz anderer Mittel sinnvoll sei.
Für sich allein und kurzfristig gesehen ist diese Aussage zweifellos richtig. Bloss: Griechenland kann sich nicht mehr allein finanzieren, also braucht es Geldgeber. Ich habe volles Verständnis für Deutschland, dass es nicht gewillt ist, einen Zustand des Reformstaus auf immer weiter zu finanzieren. Und ohne Geldgeber bliebe nur der W eg eines chaotischen Austritts aus der Eurozone.
Dieser Tage scheint die griechische Regierung einzulenken.
Das ist schwer zu sagen. Jeden Tag liest man wieder etwas anderes. Gerade habe ich gelesen, dass Varoufakis gesagt hat, Griechenland werde seine Schulden nie zahlen können.
Was auch nur die Wahrheit ist.
Gewiss. Aber er ist nicht mehr Wirtschaftsprofessor, sondern Finanzminister, und in dieser Funktion ist eine solche Aussage höchst problematisch.
Ist der Kurs von 1.07 ein Niveau, mit dem die Schweizer Wirtschaft mittelfristig leben kann?
Mit dem Aufwertungsdruck musste die Schweizer Exportwirtschaft schon immer umgehen können. Die Frage ist, was bei einer schockartigen Aufwertung passiert. Da besteht die Gefahr eines forcierten Strukturwandels. So werden Jobs vernichtet, die an sich wettbewerbsfähig wären. Gesunde Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb bestehen können, leiden so wegen eines durch die Kapitalströme künstlich überteuerten Wechselkurses. Das ist störend.
Braucht es abgesehen von Kurzarbeit weitere wirtschaftspolitische Massnahmen, um die Exportwirtschaft zu stützen?
Es gibt – ausser der Geldpolitik – keine konjunkturpolitischen Massnahmen, die der Exportwirtschaft kurzfristig und direkt nützen. Es ist verlorene Liebesmühe, Subventionsmodelle oder temporäre Steuerentlastungen anzudenken. Es gibt nichts anderes, als noch produktiver zu werden und die Wirtschaftspolitik weiter zu verbessern.
In den letzten Tagen ist auch der Ruf nach einer Erweiterung des SNB-Direktoriums laut geworden, mithin nach mehr politischem Einfluss auf die Nationalbank. Was sagen Sie dazu?
Das sehe ich sehr skeptisch. Da sägt man an einem Erfolgsfaktor der Schweiz. Alle Zentralbanken haben während der Krise unterstützend gewirkt. Aber sie müssen aussteigen können, wenn sich die Situation dazu bietet. Weil das ihre Popularität nicht gerade fördert, brauchen sie umso mehr die Unabhängigkeit – innerhalb ihres Mandates. Die Zentralbanken machen ja nicht einfach irgendetwas, sondern sie verfolgen eine Geldpolitik innerhalb ihres Mandates. Die Verpolitisierung der Geldpolitik ist ein sicherer Weg in eine schlechte Wirtschaftspolitik.
Wäre denn eine Erweiterung des Mandates oder eine andere Gewichtung innerhalb des Mandates sinnvoll?
Das sehe ich nicht so. Das Mandat ist gut: Preisstabilität unter Berücksichtigung der Konjunkturlage sowie Finanzstabilität. Damit sind alle Aufgaben hinreichend umschrieben.
Und die Erweiterung des Direktoriums?
Entscheidend ist nicht die Zahl der Mitglieder, sondern die Frage, welche das sein sollen und wer sie bestimmt. Von politischen Erwägungen bei der Ernennung oder der Idee, «Praktiker» hineinzubringen, halte ich gar nichts.
Wir haben in der Schweiz die Situation, dass neben der plötzlichen Aufwertung auch die bislang konjunkturstimulierende Personenfreizügigkeit infrage gestellt ist. Das ist eine höchst unsichere Lage.
Zweifellos. Die Zukunft des Bilateralismus ist eine ganz wichtige strukturelle Frage, die momentan ungelöst ist. Sofern im Euroraum keine Katastrophe passiert, wird diese Frage die Wechselkursfreigabe an Bedeutung überstrahlen.
Der Wert der Bilateralen wird mittlerweile aber auch von einzelnen Wirtschaftsexponenten infrage gestellt.
Das verwundert mich sehr. Seit wir die Bilateralen haben, ist es für die Schweizer Wirtschaft viel leichter, in die EU zu exportieren. Dadurch ist sie wettbewerbsfähiger geworden. Wenn das wegfällt, haben sehr viele Exporteure plötzlich wieder nichttarifäre Handelshemmnisse, sie müssen in gewissen Fällen etwa für jedes Land wieder andere Spezifikationen berücksichtigen – das bedingte einen massiven ineffizienten Umbau der Wirtschaft, der mit Sicherheit einige Jahre mit sehr tiefem Wachstum bringen wird.
Jene Kreise, die einen solchen Weg propagieren, sind oder waren zum Teil selber Unternehmer, denkt man etwa an Blocher und die EMS-Chemie, und es sind auch jene, die stets gegen Bürokratie wetten. Das passt ja nicht zusammen.
Sie gewichten eben das politische Ziel höher als die wirtschaftlichen Kosten und reden diese dann klein. Die Schweiz hat die letzten zehn, 15 Jahre wirtschaftlich so gut absolviert wie kaum ein anderes Land in Europa, und ein Kernelement dieses Wegs stellt man infrage. Ich hoffe immer noch, dass man für die Zuwanderung ein Konzept mit einer Schutzklausel findet. Dieses wird man der EU vermutlich vermitteln können. Aber mit Kontingenten wird das kaum funktionieren.
Das Motto des Entrepreneur Forums von nächster Woche lautet «Speed – eine Frage der Perspektive». Ganz allgemein gefragt: Ist es nicht so, dass die wirtschaftlichen Entwicklungen zu schnell verlaufen, als dass die Politik rasch genug reagieren könnte?
Ja, aber das ist nichts Neues. Das schweizerische politische System ist ein relativ langsames, das mit einer raschen Anpassung an die globalisierte Wirtschaft gelegentlich seine Probleme hat. Das kennen wir seit der Schaffung des europäischen Binnenmarktes. Die Schweiz hat eine Zeitlang gebraucht, bis sie sich mit den Bilateralen anpassen konnte.
Umso gefährlicher ist es, diese aufzugeben.
Ja. Man macht gerne den Vergleich mit dem EWR-Nein. Doch nach diesem hatte man eine Alternative, nämlich die Bilateralen. Wenn wir den Bilateralen Weg aufgeben, bleibt keine Alternative mehr. Dann gibt es nur die Isolation – und manche Leute träumen davon, die USA oder Japan würden die EU als Handelspartner ersetzen. Das wird nie passieren! Die EU wird immer unser wichtigster Handelspartner bleiben.
Sehen Sie auch Vorteile der Langsamkeit unseres Systems?
Die politische Stabilität, die Verlässlichkeit, die Vorhersehbarkeit, das ist ein grosser Nutzen. Wir kennen zwar das Instrument der Initiative, das eine gewisse Unvorhersehbarkeit bringt, aber bis vor kurzem zumindest hatte dieses eher eine Ventilfunktion, Initiativen hatten nur selten Erfolg. Wenn sich das ändert, kann sich das Kosten-Nutzen-Verhältnis verschlechtern.
Sehen Sie eine reelle Gefahr?
Ich habe da eine äusserst pragmatische Haltung. Die direkte Demokratie lässt sich nur über die direkte Demokratie ändern. Das heisst, sie wird sich kaum je ändern. Logisch wäre es ja, die Unterschriftenzahl zu erhöhen, das Sammeln ist in den letzten 30 Jahren deutlich einfacher geworden, und die Bevölkerung ist gewachsen. Aber jegliche Änderung ist politisch völlig chancenlos, das ist einfach ein Fakt.
Wie halten Sie’s persönlich mit der Geschwindigkeit; mögen Sie den Geschwindigkeitsrausch?
Überhaupt nicht. Ich nehm’s lieber geruhsam.
Zur Person
• geboren 1963
• Studium der Nationalökonomie in Basel, 1996 Habilitierung
• 1999 Eintritt ins Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement, 2003 bis 2012 Leitung der Direktion für Wirtschaftspolitik im Seco
• heute Professor für Wirtschaftspolitik und Regionalökonomie an der Universität Bern
• leitete die Expertengruppe zur Weiterentwicklung der Finanzmarktstrategie, die im Dezember 2014 den Schlussbericht vorlegte tg
Das Entrepreneur Forum
«Speed – eine Frage der Perspektive»: Unter diesem Motto steht das diesjährige Entrepreneur Forum (EFS) vom nächsten Mittwoch in Lyss. «Ist schneller wirklich immer besser?», fragen Andrea B. Roch und Adrian Tschanz, die Co-Präsidenten des Anlasses. Neben dem «Impuls-Referat»von Aymo Brunetti teilen weitere Referentinnen und Referenten ihre Gedanken zum Thema:Esther Gassler, Regierungsrätin des Kantons Solothurn, war lange auch Unternehmerin. Sina Trinkwalder hat in Deutschland das erste textile Social Business gegründet. Philipp Riederle ist Jungunternehmer und Autor und kennt die Welt der Digital Natives bestens. Zudem treten Anna Ravizza (Direktorin der Residenz Au Lac) und Adrian Ruhstaller (Gründer von R’adys AG)auf. Wieder verliehen wird zudem der Preis fürs «Entrepreneur-Lebenswerk»an eine Unternehmerpersönlichkeit der Region. Der Anlass wird moderiert von Sascha Ruefer. tg
Link: www.entrepreneurforum.ch
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden oder Registrieren.