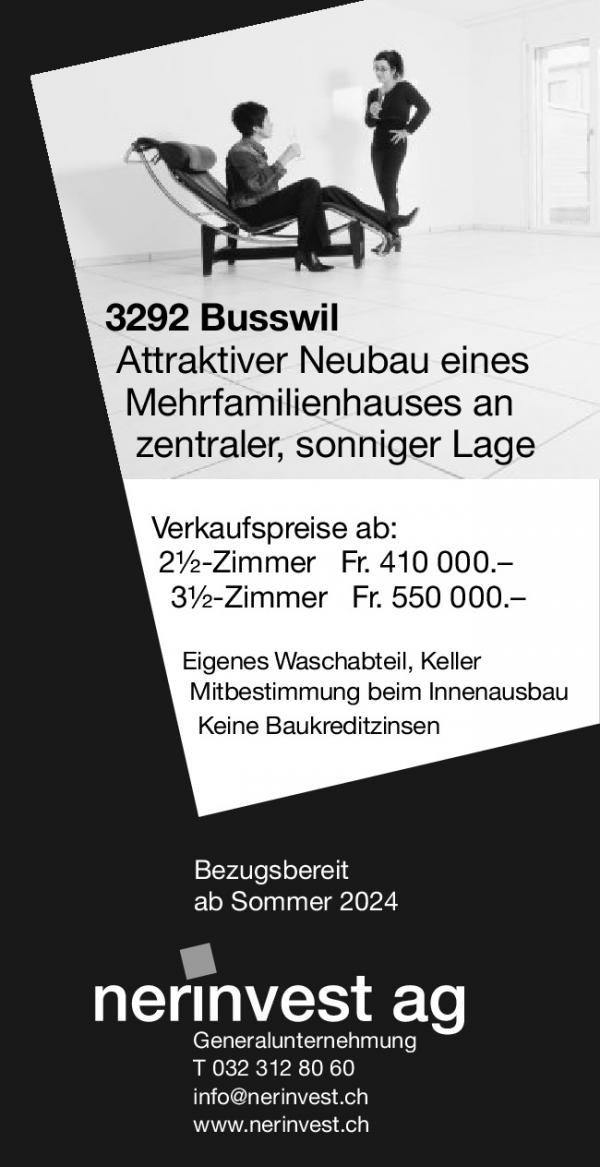Interview: Lukas Rau
Die Schweiz ist eine international stark vernetzte Volkswirtschaft mit vielen exportorientierten Unternehmen. Sie sprechen über Rezepte gegen das Diktat der Märkte. Was meinen Sie damit?
Oliver Fahrni: Das erste, praktischste und billigste Rezept wäre, den Schweizer Franken endlich in ein vernünftiges Verhältnis zum Euro zu bringen. In einer Grössenordnung von 1.35 bis 1.40. Das würde sehr viel Druck wegnehmen bei den exportierenden Unternehmen.
Wie kann sich eine derart kleine, aber stark vernetzte Volkswirtschaft überhaupt dem Diktat entziehen? Ist eine derartige Franken-Untergrenze durchsetzbar?
Als der Franken bei etwa 1.02 stand, hiess es, dass eine Franken-Untergrenze nicht machbar sei. Auch von den Leuten, die später gegen Philipp Hildebrand intrigiert haben. 1.20 ist dann eingeführt und sehr leicht verteidigt worden, quasi ohne Kosten. Es genügt, wenn die SNB zu erkennen gibt, dass sie den festen Willen hat, einen bestimmten Kurs zu halten.
Wie kann das reichen?
Märkte sind in erster Linie Akteure, den Markt an sich gibt es nicht. Diese Akteure sind Hedgefonds, Banken, Finanzkonzerne, grosse Versicherungen, etc. Die Akteure würden das Risiko scheuen, gegen die SNB zu spekulieren, wenn sie wissen, dass diese tatsächlich den festen Willen hat. Die SNB braucht nicht riesige Mengen Devisen zu kaufen oder Geld zu drucken. Es genügt, wenn sie immer wieder mit Interventionen, die nicht erwartet werden, eingreift. Dann entsteht eine Unsicherheit bei den Spekulanten. Diese Methode ist bisher auch angewandt worden, darum waren die Interventionen billig. Die Zahlen der SNB sprechen dafür.
Eine höhere Untergrenze könnte den Franken allerdings attraktiver machen für Spekulanten. Dann würden die Kosten explodieren.
Der Franken ist für die Spekulanten grundsätzlich sehr attraktiv. Einerseits natürlich, weil der Euro unter Druck steht. Die Schweiz ist aber auch eine Steueroase und ein Fluchtort für internationales Kapital. Die Schweiz hat auch Holding-Gesetze, die viele Firmensitze angezogen haben. Die Attraktivität des Frankens ist somit zum Teil hausgemacht.
Und die Spekulation?
Dagegen müssen wir mehr tun. Das geht zum Teil mit nationalen Massnahmen, die Schweiz müsste aber auch internationale Massnahmen vorschlagen. Bei den eigenen Banken könnte man anfangen.
Wie genau?
Der Grund, warum die SNB nicht schon längst auf 1.30 oder 1.40 gestellt hat, ist, dass die Banken, auch die Schweizer Banken, sehr stark in diese Spekulationen involviert sind. Sie halten Derivate in grossen Mengen auf einen Frankenkurs von 1.20. Solange diese Derivate bei den Banken anstehen, wird sich die SNB schwertun, auf 1.40 zu gehen. Sonst entstehen erneut Verluste, die wieder das «Too-big-to-fail-Problem» stellen.
Warum greift der Bund Ihrer Ansicht nach nicht ein?
In der Schweiz wird derzeit keine Wirtschaftspolitik, sondern nur Finanzplatzpolitik gemacht. Gemessen an der Bedeutung des Bankenplatzes, der weniger zum BIP beiträgt als die Industrie, ist das unsinnig. Wir brauchen in diesem Land endlich eine Regulierung der Macht der Grossbanken. Und wir brauchen eine Wirtschaftspolitik, die diese ungeheuren Möglichkeiten, die im Wissen und Können der Schweizer Arbeitenden und der Fähigkeit zur Innovation liegen, endlich zum Ausdruck bringt.
In welche Richtung soll das denn gehen?
Zum ökologischen Umbau beispielsweise. Heute haben wir die Situation, dass die meisten Schweizer Erfindungen in diesem Bereich von ausländischen Konzernen angewendet werden. Wir haben hier im Land einfach keine entsprechende Politik, im Gegensatz zu allen umliegenden Ländern. Sogar das Deutschland der liberalen Bundeskanzlerin Merkel macht eine sehr aktive Industrie- und Wirtschaftspolitik.
Man kann ja nicht sagen, dass die in der Politik untervertreten wäre. Sie ist auch gut vernetzt in Verbänden.
Die an sich gibt es so nicht. Im Dachverband Economiesuisse gibt es erhebliche Differenzen. Vor nicht allzu langer Zeit wollte die Swissmem sogar austreten. Bei Economiesuisse haben die Grossbanken, die Chemiemultis und zwei, drei andere grosse Multis das Sagen. Und die bestimmen die Politik.
Aber ein Verband wie die Swissmem hat auch Gewicht.
Swissmem ordnet sich immer wieder unter. Als der heutige Bundesrat Johann Schneider-Ammann noch Swissmem-Chef war, hat er mehrmals Vorstösse gemacht zum Frankenkurs oder zu Kreditproblemen. Diese wurden dann jeweils wieder zurückgezogen. Das Gefühl bei den Industriellen ist, dass sie in der hiesigen Politik zu kurz kommen. Das sieht man, wenn die Swissmem Seminare abhält, wie man Arbeitsplätze ins Ausland verlagern kann.
Es gibt auch andere Bestrebungen, die Unternehmen gegen diesen Wechselkurs zu schützen. Der Bundesrat erlässt zum Beispiel bedrohten Branchen die Mehrwertsteuer.
Das mag für die eine oder andere Firma ein Punkt sein. Dass das Senken der Steuern kaum einen Einfluss auf die Wirtschaftsentwicklung hat, wurde aber in mehreren Studien nachgewiesen. Das ist nur eine Pflästerlipolitik, die dem Staat weitere Mittel entzieht und die Gewinne ansteigen lässt.
Welche Massnahmen würden Sie denn vorschlagen?
Wir müssten den ökologischen Umbau fördern. Derzeit machen wir mit der grünen Industrie nur ganz wenige Prozente des BIP. Während Länder wie Deutschland da längst in einer Grössenordnung sind, in der die Autoindustrie und andere grosse traditionelle Industrien abgelöst wurden. Der ökologische Umbau wird weltweit zum Treibelement der Wirtschaft. Die Schweiz ziert sich, weil das neoliberale Dogma keinen aktiven Staat will. Ein weiterer Punkt ist, dass wir in der Schweiz in der Lohn- und Produktivitätsfrage endlich eine offene Diskussion führen müssen.
So schlecht kann es ja nicht stehen: Viele Unternehmen kommunizieren momentan ihre Bilanzen. Der Uhrenindustrie geht es auch gut, wird da nicht zu schwarz gemalt?
Die Uhrenindustrie exportiert mit hoher Wertschöpfung. Wenn man aber alle börsenkotierten Unternehmen anschaut, stellt man fest, dass einige mehr Gewinn bei weniger Umsatz machen.
Warum soll dies schlecht sein?
Es zeigt unser Grundproblem. In den letzten 30 Jahren ist die Produktivität stark gestiegen. Früher hat man diese Produktivitätsfortschritte verteilt, in Form von höheren Löhnen oder kürzerer Arbeitszeit. Heute passiert das nicht mehr. Im Gegenteil. Der Durchschnittslohn ist sehr leicht gestiegen. Aber genau betrachtet haben nur die obersten Prozente der Lohnempfänger zugelegt. Alle anderen haben kaufkraftmässig stagniert.
Was bedeutet das?
Das ist eine wichtige Ursache für die Krise. Konzerne wie Novartis, die gerade 1100 Jobs in der Schweiz abbauen wollte, schwimmen im Geld. Die überschüssigen Gewinne fliessen nicht als Investitionen in die Industrie, sondern an die Finanzmärkte. So blähte sich die Blase auf, die dann geplatzt ist. Das Geld, das dann in die Bankenrettung gesteckt wurde, beläuft sich auf über 5000 Milliarden Franken. Da zeigt sich ein grundsätzliches Nichtfunktionieren der gegenwärtigen Wirtschaftsordnung.
KMU können aber im Gegensatz zu grossen Multis nicht einfach so höhere Löhne zahlen.
Mit einer entsprechenden Politik schon. Die Nachfrage und Kaufkraft würden steigen und es wäre wieder sinnvoll, zu investieren, statt an den Finanzmärkten zu spekulieren. Das Wachstum an der Börse und der Gewinne ist nicht mehr das Wachstum der Volkswirtschaft. Europa ist in einer Rezession, die Schweiz beinahe. Früher hiess es, die Gewinne von heute sind die Arbeitsplätze von morgen. Nun gilt: Die Gewinne von heute sind die Arbeitslosen von morgen.
Oliver Fahrni
- Der studierte Ökonom arbeitet als Wirtschafts- und Finanzjournalist für die Gewerkschaftszeitung der Unia, die «Workzeitung», bei der er auch stellvertretender Chefredaktor ist.
- Fahrni ist 56 Jahre alt und lebt in Bern.
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden oder Registrieren.