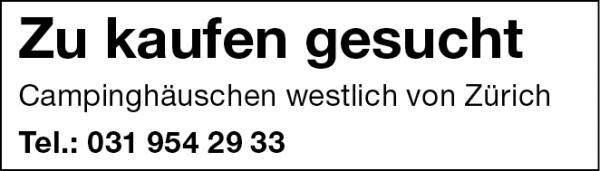Tobias Graden
Anfang September 2012 wurde Gwatt am Thunersee zum «Mekka der Laserprofis». So kündigte die Berner Fachhochschule Technik und Informatik (BFH TI) die «International Conference on Advanced Laser Technologies» an. Abgekürzt nennt sich die Konferenz für Lasertechnologie «ALT», die erste wurde 1993 vom renommierten Moskauer Institut für Physik und Technologie ins Leben gerufen. Das Treffen am Thunersee war das zwölfte, weswegen die Konferenz in Fachkreisen «ALT 12» genannt wurde. Forscher aus aller Welt waren zu Gast, als Organisatoren amteten jene der Berner Fachhochschule, des Instituts für «Applied Laser, Photonics and Surface Technologies ALPS» – einen deutschen Namen hat das Institut gar nicht. «Die internationale Vernetzung der Wissenschaft ist absolut zentral», sagt Lukas Rohr, Departementsleiter Technik und Informatik an der Berner Fachhochschule.
Elf Millionen Euro
Die von den Bernern organisierte Konferenz brachte aber nicht nur Renommée, sondern nützliche Kontakte. Etwa zu Gediminas Raciukaitis. Dieser leitet an der grössten technischen Universität Litauens das Departement für Lasertechnologie. Aus dem Kontakt entstand das Forschungsprojekt «Apollo». Insgesamt 21 Partner sind beteiligt, aus zahlreichen Ländern Europas, es sind Universitäten, Forschungsinstitute und Industriepartner, darunter eben die BFH TI. Ziel von «Apollo» ist es, Laserprozesse in der letzten Entwicklungsphase zur Industrialisierungsreife zu bringen. Als Schweizer Industriepartner dabei ist etwa die Firma Flisom. Sie entwickelt Maschinen zur Herstellung von polykristallinen Dünnschicht-Solarzellen und hat vor, die Lasertechnologie zur Strukturierung der einzelnen Schichten zu nutzen.
Die Projektleitung obliegt dem litauischen Institut. Dieses hat das Projekt beim EU-Programm «Framework 7» eingegeben, dem Vorgängerprogramm des in diesen Tagen vieldiskutierten und massiv umfangreicheren «Horizon 2020». Aus diesem Programm fliessen nun elf Millionen Euro in «Apollo». 43 Prozent davon gelangen in die Schweiz, wovon wiederum ein Viertel zur BFH TI kommt. Valerio Romano, Professor für Fotonik an der BFH TI, kann mit diesen ungefähr anderthalb Millionen Euro etwa drei Mitarbeiter über die gesamte Projektdauer von vier Jahren finanzieren. Gestartet ist «Apollo» am 1. September 2013.
Der Vorteil Europas
Insgesamt ist die BFH TI an drei solchen Projekten im Rahmen von «Framework 7» beteiligt. Sie hat in diesen zwar die Projektleitung nicht inne, doch wenn nun die Schweiz auf Dauer nur noch den Status eines Drittstaates in «Horizon 2020» haben sollte, wäre dies gar nicht mehr möglich.
Argumenten, wonach die Schweiz statt in europäische Forschungsprogramme «in die eigenen Unis» investieren solle, kann Lukas Rohr gar nichts abgewinnen. «Wenn wir in der Forschung nicht international mitwirken können, verlieren wir den Anschluss», ist er überzeugt.
Er sieht den globalen Wettbewerb der Wirtschafts- und Forschungsstandorte Amerika, Asien und Europa: «In Europa haben wir viele Kulturen und damit viele verschiedene Denkansätze. Wenn wir diese in der Forschung nutzen können, ist dies unser Vorteil gegenüber Asien und Amerika.»
Aufwendiger und teurer
Die BFH TI sei unmittelbar vom Auschluss der Schweiz vom Austauschprogramm «Erasmus+» betroffen, sagt Departementsleiter Lukas Rohr: «Mit ‹Erasmus› ist alles geregelt, es gibt Standardverträge, der Austausch ist unkompliziert.» Ohne ein solches Rahmenprogramm ist Austausch zwar nicht mehr unmöglich, doch muss ihn die BFH mit jeder anderen Universität individuell aushandeln. Was dabei herauskommt, sei offen: «Wir sind auf Goodwill angewiesen.» Das Rahmenprogramm betrifft zudem nicht nur Studierende, sondern auch Mitarbeiter und Dozenten der Hochschulen. Rohr: «Das ist ein befruchtendes Element, das auch zu gemeinsamen Forschungsprojekten führen kann.» Insgesamt machten an der BFH etwa 100 Studierende jährlich vom Erasmus-Austausch Gebrauch, davon 20 an der BFH TI. Die Schule will diesen Austausch weiterhin möglichst gut fördern.
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden oder Registrieren.