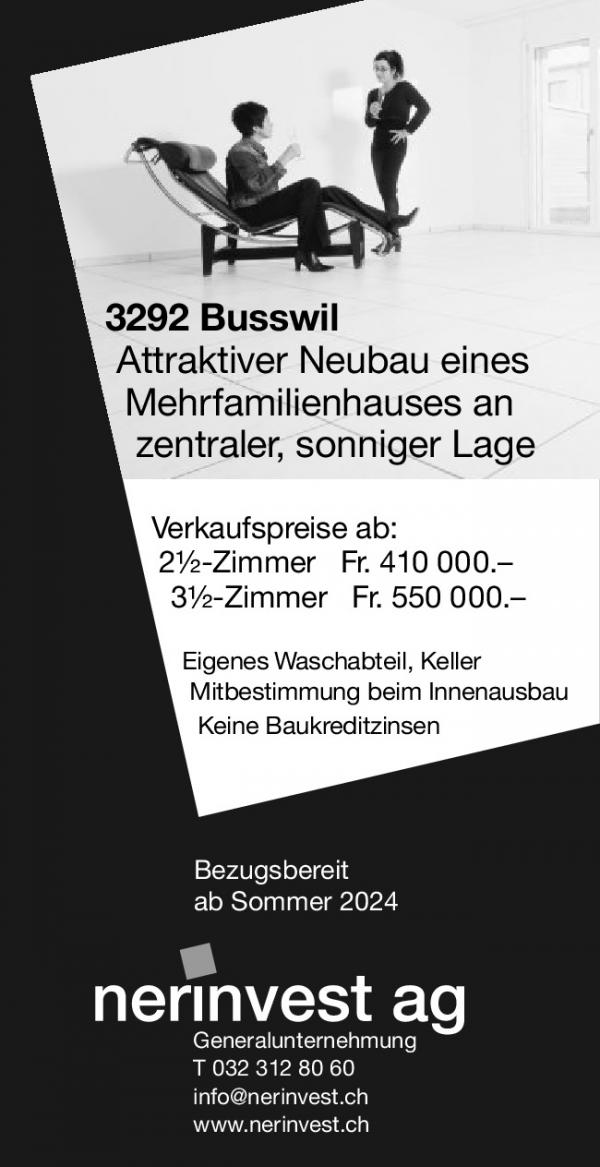-

1/8 Der Economiesuisse-Präsident Heinz Karrer sagt: «Wenn es nicht gelingt, die Bilateralen Verträge aufrecht zu erhalten, dann haben wir ein grösseres Problem.» Reto Probst -

2/8 Der Economiesuisse-Präsident Heinz Karrer sagt: «Wenn es nicht gelingt, die Bilateralen Verträge aufrecht zu erhalten, dann haben wir ein grösseres Problem.» Reto Probst -

3/8 Der Economiesuisse-Präsident Heinz Karrer sagt: «Wenn es nicht gelingt, die Bilateralen Verträge aufrecht zu erhalten, dann haben wir ein grösseres Problem.» Reto Probst -

4/8 Der Economiesuisse-Präsident Heinz Karrer sagt: «Wenn es nicht gelingt, die Bilateralen Verträge aufrecht zu erhalten, dann haben wir ein grösseres Problem.» Reto Probst -

5/8 Der Economiesuisse-Präsident Heinz Karrer sagt: «Wenn es nicht gelingt, die Bilateralen Verträge aufrecht zu erhalten, dann haben wir ein grösseres Problem.» Reto Probst -

6/8 Der Economiesuisse-Präsident Heinz Karrer sagt: «Wenn es nicht gelingt, die Bilateralen Verträge aufrecht zu erhalten, dann haben wir ein grösseres Problem.» Reto Probst -

7/8 Der Economiesuisse-Präsident Heinz Karrer sagt: «Wenn es nicht gelingt, die Bilateralen Verträge aufrecht zu erhalten, dann haben wir ein grösseres Problem.» Reto Probst -

8/8 Der Economiesuisse-Präsident Heinz Karrer sagt: «Wenn es nicht gelingt, die Bilateralen Verträge aufrecht zu erhalten, dann haben wir ein grösseres Problem.» Reto Probst
- Galerie
Interview: Tobias Graden
Heinz Karrer, kennen Sie Unternehmen aus der Region Biel-Seeland?
Heinz Karrer: Mir kommt als erstes die Uhrenbranche in den Sinn, und damit die Swatch Group, aber auch weitere Marken wie etwa Breitling. Ich kenne Feintool gut, Mikron und Heiniger Sport in Lyss – dies aus meiner Zeit bei Intersport.
Wie nehmen Sie Biel-Seeland als Wirtschaftsregion wahr?
Ich denke da an die Zweisprachigkeit. Und ich bringe Biel einerseits mit der Krise in den 70er-Jahren in Verbindung, anderseits ist es heute eine sehr innovative Region. Es ist ein grosser Wandel erfolgt wie vermutlich in keiner anderen Region der Schweiz.
Die Region Biel ist stark exportorientiert, die Unternehmen haben nach wie vor mit dem starken Franken zu kämpfen. Wie sehen Sie die Zeit nach dem Frankenschock im Rückblick?
Das muss man weiter zurückblicken. 2009 lag der Euro noch bei 1.60 – schon der Weg von diesem Wert auf 1.20 war eine riesige Herausforderung, insbesondere für die Exportindustrie. Dann kam der Schock, der Kurs hat sich nun um 1.10 eingependelt, also nochmals eine Aufwertung gegenüber dem Euro von etwa acht Prozent. Die Unternehmen haben extrem schnell reagiert, die meisten auch gut und erfolgreich. Aber für viele Unternehmen geht es ums Überleben. Vor allem aber stellt sich die Frage: Wie geht es weiter? Die Geldpolitik ist auf der ganzen Welt aus den Fugen geraten.
War denn die Aufhebung der Kursuntergrenze aus heutiger Sicht der richtige Schritt?
Man wusste stets: Diese Massnahme ist befristet, denn sonst verzichtet man auf eine eigenständige Geldpolitik. Die Frage war aber: Wann kommt die Aufhebung? Mich hätte es nicht überrascht, wenn sie ein halbes Jahr vorher erfolgt wäre, als sich der Franken etwas vom Mindestkurs wegbewegt hatte. Der tatsächliche Aufhebungszeitpunkt kam wohl für die meisten unerwartet.
Was entgegnen Sie einem Nick Hayek, der nicht müde wird, die SNB als «mutlos» und «führungsschwach» zu kritisieren?
Irgendwann musste die SNB zurück zu einer normalen Geldpolitik mit den herkömmlichen Mitteln finden wie der Zinspolitik oder gezielten Interventionen am Devisenmarkt. Eine Anbindung auf Dauer ist keine Lösung für die Schweiz. Das ist sicher die grossmehrheitliche Meinung unter Unternehmern.
Die Linke fordert eine breitere Auffassung des Auftrags der SNB, dieser solle auch die Sicherung von Arbeitsplätzen umfassen. Warum schliesst sich Economiesuisse einer solchen Forderung nicht an?
Es ist nicht sinnvoll, wenn die Politik die Geldpolitik macht oder diese zumindest stark beeinflusst, dafür gibt es zu viele unterschiedliche Vorstellungen. Eine nicht unabhängige SNB wäre auch für das internationale Ansehen der Schweiz nicht gut. Die Möglichkeiten innerhalb des heutigen gesetzlichen Auftrags genügen vollauf.
Wie stehen Sie denn zur Forderung nach einer aktiveren Industriepolitik, wie sie Corrado Pardini vertritt?
Wenn das bedeutet, dass die Industrie geschützt und subventioniert werden soll, wenn man staatliche Massnahmen fordert, wie man sie in Frankreich kennt, dann ist das keine gute Lösung. Das Resultat zeigt sich in Frankreich: Im Vergleich zur Schweiz hat das Land in Relation zum BIP etwa noch die Hälfte an Industrie. Das kann also nicht im Interesse der Arbeitnehmer sein. Wenn man aber darunter versteht, dass die Rahmenbedingungen für Unternehmen im internationalen Vergleich attraktiv bleiben sollen, dass der Arbeitsmarkt nicht zusätzlich reguliert wird, dass wir die Bilateralen Verträge sichern können, dass wir ein attraktiver Steuerstandort sind – dann ist das auf jeden Fall zu unterstützen.
Wie bewerten Sie die Schweizer Innovationspolitik? Es gibt angesichts des Swiss Innovation Parks bürgerliche Stimmen, die sagen, es sei nicht Aufgabe des Staates, eine solche Institution zu fördern.
Auch in der Innovationspolitik gibt es Grenzbereiche. Die KTI ist ja auch staatlich organisiert, wir betrachten sie aber als gutes Instrument, das vor allem KMU eine Brücke zur Innovation baut. Für den Innovationspark gilt das Gleiche. Solche Instrumente haben Fördercharakter und sind nicht interventionstische Industriepolitik, sie sind deshalb sinnvoll.
Wie bewerten Sie die Gefahr einer Desindustrialisierung der Schweiz?
Eine gewisse Gefahr begleitet uns seit Jahrzehnten, besonders intensiv während der Zeit 90er-Jahre. In der Boomphase in den 80er-Jahren betrug der BIP-Anteil der Industrie etwa 20 Prozent, heute liegt er immer noch bei 20 Prozent – mit anderen Worten: Die grosse Desindustrialisierung hat nicht stattgefunden. Dies dank der Innovationskraft der Unternehmen. Das heisst: Die Sorgen sind zwar berechtigt, die Lösung zur Verhinderung einer Desindustrialisierung heisst Innovation.
Ein neuer Mindestkurs ist nicht nötig?
Der Franken ist zwar nach wie vor überbewertet, doch ein neuer Mindestkurs wäre mit grossen Problemen und Fragezeichen verbunden. Dies insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Geldpolitik der EU. Der Mindestkurs würde vermutlich sofort wieder getestet, was eine immense Ausweitung der SNB-Bilanzsumme ohne nachhaltige Wirkung zur Folge hätte.
Das Verhältnis Schweiz-Europa ist ein weiterer Unsicherheitsfaktor, insbesondere die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative. Welchen Ausweg aus dem Dilemma sehen Sie?
Das ist in der Tat die grösste unmittelbare Herausforderung. Wir stützen uns auf die Wortwahl im MEI-Verfassungsartikel, die besagt, dass in der Umsetzung die Interessen der Wirtschaft zu berücksichtigen seien. Drei Elemente sind zentral. Erstens sollen Grenzgänger nicht betroffen sein.
Schon dieser Punkt dürfte bei den Initianten auf Widerstand stossen, der Wortlaut der Initiative sieht anderes vor.
Der Verfassungstext lässt Interpretationsspielraum zu und jede Gesetzgebung nach einer angenommenen Initiative ist verbunden mit Auslegungsdiskussionen. Wir bringen ein, was für eine wirtschaftsfreundliche Umsetzung zwingend notwendig ist, und in dieser Frage sind die Kantone und die meisten Parteien unserer Meinung.
Was sind die weiteren Punkte?
Wir fordern für Kurzaufenthalter eine Aufenthaltsfrist von neun statt vier Monaten. Viele Branchen sind stark saisonal geprägt: das Baugewerbe, Tourismus, Gastronomie und Hotellerie, aber auch die Landwirtschaft. Das Pièce de Résistance ist die Schutzklausel. Es ist aber ein Instrument, das man aus Verträgen innerhalb und mit der EU kennt, um speziellen Situationen befristet Rechnung zu tragen.
Es ist sehr fraglich, ob die EU eine solche Schutzklausel akzeptieren wird. Was halten Sie vom Inländervorrang, wie ihn Rudolf Strahm oder auch Philipp Müller vorgebracht haben?
Jeder konstruktive Lösungsvorschlag ist willkommen. Auch innerhalb der Schutzklausel muss man eine Lösung entwickeln, die festlegt, in welchem Fall die Schutzklausel wirksam wird.
Strahm sagt, es gehe auch um die Senkung der Arbeitslosigkeit. Er kritisiert, dass diese gerade in jenen Branchen hoch ist, die weiterhin vor allem im Ausland Arbeitskräfte rekrutieren will, auch in der Informatik.
Diese Beobachtung trifft zu, aber auch nicht überall. In der Informatik ist es so, dass auch ganz spezifische Fähigkeiten gefragt sind, die teilweise in der Schweiz nicht oder nicht genügend vorhanden sind. Man muss also die Arbeitsmarktsituation in jeder Region und in jeder Berufsgruppe genau analysieren.
In solchen Fällen liegt es doch in der Verantwortung der Branche, solche Fähigkeiten in der Schweiz eben auszubilden?
Ja. Die Wirtschaft tut das auch, doch die Anstrengungen müssen weitergehen.
Die Schweiz hat angesichts der Lage in Europa derzeit das Glück, auf Zeit spielen zu können, ohne grosse Nachteile befürchten zu müssen. Ist dies eine trügerische Ruhe?
Es kann geradesogut ein Nachteil sein. Wir hoffen ohnehin, dass Grossbritannien in der EU bleibt, denn andernfalls würde die Unsicherheit massiv zunehmen und die Möglichkeiten, mit der Schweiz eine Lösung zu finden, könnten stark eingeschränkt sein.
Die Migrationszahlen im ersten Quartal zeigen, dass die Einwanderung in die Schweiz abnimmt. Erledigt sich das Problem von selber?
Wir haben schon im Vorfeld der Abstimmung darauf hingewiesen, dass Einwanderung von der konjunkturellen Situation abhängt. Es wäre aber zu früh, schon nach einem Quartal das Fazit für eine längerfristige Entwicklung zu ziehen.
Es deutet aber darauf hin, dass der Standort Schweiz an Attraktivität verliert.
Die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz hat aus zwei Gründen gelitten. Einerseits wegen der Unklarheit im Zusammenhang mit den Bilateralen Verträgen, anderseits wegen der Währungssituation. Das äussert sich beispielsweise in einer deutlichen Abnahme der Anfragen nach einer Ansiedlung oder in Verlagerungen von Arbeitsplätzen in das Ausland.
Aller Voraussicht nach kommt es ohnehin zu einer Grundsatzabstimmung über unser Verhältnis zur EU. Wird sich Economiesuisse im Abstimmungskampf stark engagieren?
Derzeit sollte man sich auf die Umsetzung des Verfassungsartikels 121a konzentrieren. Wenn mit der EU eine Lösung gefunden werden kann, die von allen Seiten getragen wird, würde sich die Frage so nicht stellen. Darum gilt unsere Konzentration derzeit diesem Prozess.
Zu verdanken hat man die vertrackte Situation der SVP. Schadet die Partei dem Wirtschaftsstandort Schweiz?
Die SVP unterstützt in der grossen Mehrheit unsere wirtschaftspolitischen Anliegen – etwa in den Themen Arbeitsmarkt, Steuerpolitik, Finanzhaushalt. In der Europafrage aber haben wir nicht die gleiche Meinung.
Für eine kleine, vernetzte Volkswirtschaft mitten in Europa ist dies der zentrale Bereich.
Die SVP hat sich stets auf den Standpunkt gestellt, die Bilateralen Verträge könnten auch mit der MEI aufrechterhalten werden, es gelte eben zu verhandeln. Wenn dies nicht gelingt, haben wir in der Tat ein grösseres Problem. Ich gehe aber davon aus, dass sich die SVP als Regierungspartei ihrer Verantwortung für den Wirtschaftsstandort Schweiz bewusst ist.
Am 5. Juni folgt eine Abstimmung von grosser wirtschaftspolitischer Tragweite. Was halten Sie von der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens?
Ich hoffe, dass das Anliegen klar abgelehnt wird. Es wäre ein komplett falscher Anreiz. Ein Grundeinkommen zu erhalten, ohne dafür irgendwelche Anstrengungen unternehmen zu müssen, das ist unschweizerisch. Das BGE wäre ein sehr grosses Experiment. Ich sehe auch nicht, wie das finanziert werden könnte. Die Konsequenz wären mit Sicherheit massive Steuererhöhungen. Ich halte diese Initiative nicht für sinnvoll.
Können Sie sich nicht vorstellen, dass ein BGE auch eine stimulierende Wirkung haben könnte? Man kann es als Investition betrachten, welche die Verwirklichung von Geschäftsideen erleichtert.
Das kann ich mir zwar für einen Teil der Menschen durchaus vorstellen. Wenn ich mir aber vor Augen halte, wie unsere Gesellschaft funktioniert und wie wir unseren Wohlstand erarbeitet haben, denke ich, dass grösstenteils unerwünschte Effekte die Folge wären.
Das BGE wird auch als «Automatisierungsdividende» betrachtet – Automatisierung und Digitalisierung erhöhen die Arbeitslosigkeit, das BGE ermöglicht im Gegenzug der Allgemeinheit die Teilhabe an den Gewinnen. Welche Mittel schlagen Sie vor, um der drohenden steigenden Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken?
Zwei Dinge werden eine noch grössere Bedeutung erlangen. Erstens: Innovation – wenn es immer mehr Roboter gibt, müssen wir jene sein, die diese bauen. Zweitens: Die permanente Weiterbildung wird in Anbetracht der Schnellebigkeit und der Marktdynamiken nicht zuletzt aufgrund der Digitalisierung eine noch grössere Rolle spielen.
Auch wenn wir die Roboter bauen: Jene Jobs, welche die Roboter erledigen, braucht es dann nicht mehr. Und es kann nicht jeder ein Roboterbauer sein.
Wir können künftige Entwicklungen nur beschränkt voraussehen. Das war auch in der Vergangenheit so: Jede industrielle Revolution stiess zuerst auf Widerstand, hat aber der Menschheit schliesslich Vorteile gebracht. Jetzt schon zu sagen, dass wir in Zukunft viel weniger Arbeit haben werden, finde ich eine gewagte These und auch mutlos. Besser ist es zu sagen: Wir wollen die Zukunft mitgestalten und an qualitativen Verbesserungen für die Menschheit mitarbeiten.
Sie sind nicht zuletzt darum zum Präsidenten von Economiesuisse gewählt worden, weil der Wirtschaftsdachverband die Nähe zur Bevölkerung wiederherstellen wollte. Ist Ihnen das gelungen?
Wir haben auf jeden Fall grosse Anstrengungen unternommen, um den Dialog mit der Bevölkerung zu fördern. Wir stellen uns vielen Diskussionen, gehen an Messen, laden zu Kaffee und Gipfeli ein. Und an jedem Anlass nehmen viele Unternehmerinnen und Unternehmer teil. Ich denke, wir bewegen uns in die richtige Richtung. Aber es gibt noch viel zu tun.
Gleichzeitig hat man den Eindruck, dass Economiesuisse in Abstimmungskämpfen eher defensiver agiert als früher.
Dieser Eindruck täuscht. Wir haben uns bei allen wirtschaftspolitischen Vorlagen wie der 1:12-Initiative, den Abstimmungen zu Erbschaftssteuer und Mindestlohn sowie weiteren Initiativen engagiert und auch alle deutlich gewonnen. Wir haben die Allianzen ausgebaut und mit lokalen Stützpunkten wie den Handelskammern noch intensiver zusammengearbeitet. Ich denke, da haben wir uns positiv entwickelt.
Bei der Durchsetzungsinitiative kam aber Kritik an Economiesuisse auf. Das Anliegen hätte der Wirtschaft mutmasslich stark geschadet, man hat den Abstimmungskampf aber der so genannten «Zivilgesellschaft» überlassen.
Wir haben eine Parole gefasst und unsere Haltung klar kommuniziert, notabene als einziger Wirtschaftsdachverband. Wir haben uns auch persönlich engagiert, ich selber, aber auch viele Unternehmer. Wir haben zwar keine eigene Kampagne geführt, doch haben sich Verbände und Unternehmen auch finanziell engagiert.
Wünschten Sie sich mehr politische Einmischung von Unternehmerseite?
Ja. Im Milizsystem sollte sich in politische Prozesse in irgendeiner Form einbringen, wer unternehmerisch tätig ist. Auf Gemeindeebene funktioniert das recht gut. Sobald es aber zeitintensiver ist, wird es schwieriger. Bei den letzten nationalen Wahlen haben sich aber zahlreiche Unternehmer zur Wahl gestellt. Es geht in die richtige Richtung.
Oft ist aber eine gewisse Weigerung feststellbar, sich politisch zu äussern. Gegenbeispiele wie der Berner Druckunternehmer Peter Stämpfli sind selten.
Ich wünschte mir viel mehr Peter Stämpflis. Er ist Vollblutunternehmer, engagiert sich für die Zivilgesellschaft und ist auch bereit, sich zu exponieren. Man muss aber auch Verständnis haben, dass das nicht alle so tun können, wollen oder dürfen.
Sie selber sind im Zuge des Kuoni-Verkaufs in die Schlagzeilen gekommen. Selbst die «NZZ am Sonntag» hat implizit ihre Bezüge als Verwaltungsratspräsident kritisiert. Besteht dadurch eine Reputationsgefahr für Economiesuisse?
Die Bezüge des Kuoni-Verwaltungsrates bewegten sich immer innerhalb der Bandbreite vergleichbarer Unternehmen und sie wurden stets auch transparent ausgewiesen. Die Generalversammlung hat diese immer uneingeschränkt gutgeheissen. Mit Kritik muss man rechnen, aber ich glaube nicht, dass dadurch die Reputation beeinträchtigt ist.
Sie gehen zum Ausgleich gerne in die Berge, haben schon viele Viertausender bestiegen. Welche fehlen Ihnen noch?
In der Schweiz noch einer. Das Lauteraarhorn. Ich war letzten Sommer bereits beim Einstieg nach sechsstündigem Anmarsch. Es waren aber wohl die einzigen drei, vier Stunden letzten Sommer, in denen es geregnet hat… Wir mussten umkehren. Aber das Lauteraarhorn läuft ja nicht weg.
Sie könnten auch sagen: Es ist der einzige Viertausender, den ich in Ruhe lasse und nur anschaue.
Es war gar nie mein Ziel, alle Schweizer Viertausender zu besteigen. Es hat sich im Verlaufe der letzten 20 Jahre intensiver Kletterei einfach so ergeben. Jetzt, da nur noch einer fehlt, möchte ich schon noch gerne auf dem Gipfel des Lauteraarhorns stehen.
******************************
TTIP: Schweiz wäre unter Zugzwang
Wenn das Freihandelsabkommen TTIP zwischen den USA und der EU zustande kommt, dann hat das auch grosse Folgen für die Standortattraktivität der Schweiz. Auf diesen Umstand machte Heinz Karrer am gestrigen «Treffpunkt Wirtschaft» aufmerksam. Der von der Sektion Biel-Seeland des Handels- und Industrievereins sowie von der Wirtschaftskammer Biel-Seeland organisierte Anlass stand dieses Mal ganz im Zeichen des Präsidenten von Economiesuisse (vgl. Interview). Im Falle eines Abschlusses von TTIP also wäre die EU interessanter als Standort für Exporte in die USA, in die immerhin 13 Prozent aller Exporte aus der Schweiz gehen. Schweizer Unternehmen müssten sich also überlegen, ob sie einen Standort im EU-Raum eröffnen wollten. Und die Schweiz müsste entscheiden, ob sie sich ans Abkommen «anhängen» oder ob sie selber (allenfalls im Verbund mit Efta-Staaten) ein Freihandelsabkommen mit den USA aushandeln wollte.
Das internationale Umfeld könne die Schweiz kaum beeinflussen, sagte Karrer weiter. Er plädierte darum dafür, jene Entscheide, die in der Schweiz anstehen, möglichst unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftsfreundlichkeit zu betrachten. Sollte es etwa nicht gelingen, die Unternehmenssteuerreform III zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, bedeute dies weitere Jahre der Unsicherheit – «und Unsicherheit ist Gift für die Wirtschaft».
Karrer mag eine klare wirtschaftspolitische Linie vertreten, im Umgang gilt er aber als sehr freundlich. Ob er nicht auch mal auf den Tisch schlagen wolle?, fragte Moderator Urs Gredig. «Ich frage mich: Mit welchen Mitteln kann ich die Politik überzeugen», antwortete Karrer. «Ich zähle auf intensive, aber sachliche Diskussionen.» tg
*****************************
Zur Person
- geboren am 10. Mai 1959 in Winterthur
- kaufmännische Lehre bei der damaligen Bankgesellschaft, später Matura nachgeholt, das Wirtschaftsstudium an der HSG abgebrochen
- in jungen Jahren aktiver Spitzenhandballer, Teilnehmer als Nationalspieler an den Olympischen Spielen 1984
- zehn Jahre Tätigkeit in der Sportartikelbranche, zuletzt Geschäftsleiter und Verwaltungsratsdelegierter der Intersport Holding
- 1995 bis 1997 Leiter von Ringier Schweiz
- 1998 bis 2002 Mitglied der Konzernleitung der Swisscom
- 2002 bis 2014 CEO der Axpo Holding
- seit 1. September 2013 Präsident von Economiesuisse
- zuletzt auch Präsident von Kuoni, weitere Verwaltungsratsmandate
- passionierter Berggänger
- in zweiter Ehe verheiratet, drei erwachsene Söhne
- lebt in Münsingen BE tg
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden oder Registrieren.