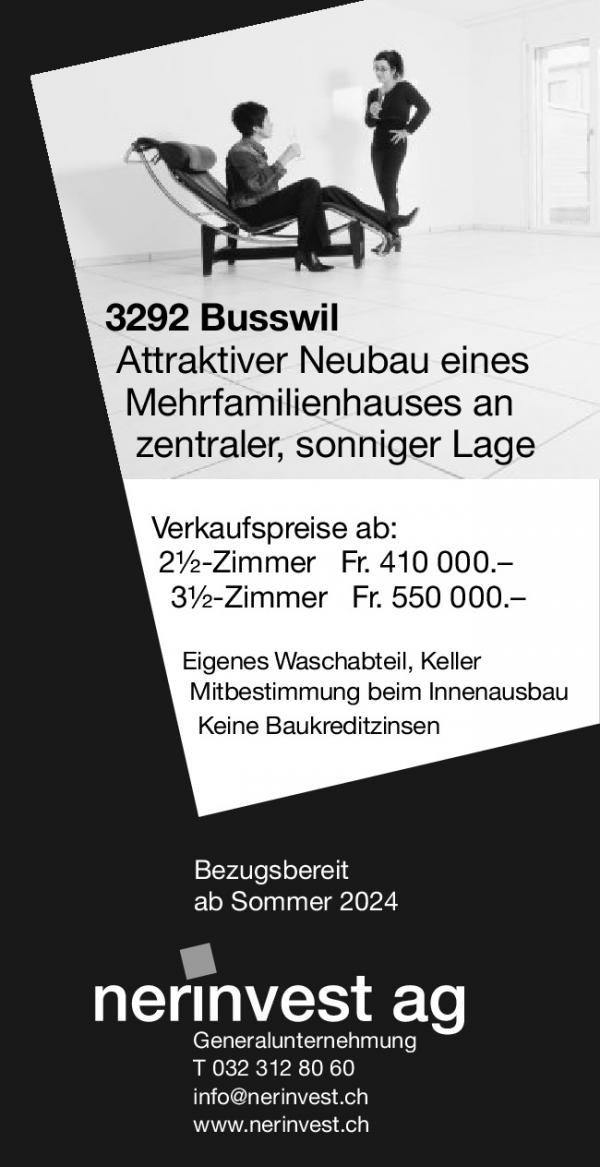Interview: Markus Diem Meier
Reza Moghadam, wie beurteilen Sie die aktuellen Entwicklungen der Weltwirtschaft und die Folgen des Coronavirus?
Reza Moghadam: seit einigen Monaten sehen wir eindeutig eine Aufhellung der Stimmung in der globalen Wirtschaft. Einerseits wegen des Interimshandelsabkommens zwischen China und den USA, aber auch wegen besserer ökonomischer und Sentiment-Daten in den entwickelten und aufstrebenden Volkswirtschaften. Natürlich stellt das Coronavirus ein Risiko dar, wie auch die anhaltenden geopolitischen Spannungen. Das Gesamtbild ist gegenüber 2019 aber besser geworden. Im Moment gehen Ökonomen und Märkte von einer raschen Erholung aus. Hoffen wir es.
Sie waren beim Internationalen Währungsfonds für Europa verantwortlich. Wie beurteilen Sie die Entwicklung seit der Eurokrise?
Viele gute Sachen wurden gemacht, um Europa zu stabilisieren. Zu Beginn der Krise, als der IWF geholt wurde, hatte Europa keinen eigenen finanziellen Rettungsmechanismus, um Geld bereitzustellen. Auf der Ebene der Kommission waren die Mittel sehr beschränkt. Das war einer der Gründe, den IWF einzuschalten. Doch dieser konnte im Vergleich zu den Bedürfnissen der EU nur wenig leihen. Es gab eine zentralisierte Geldpolitik, aber in jedem Land eine dezentrale Fiskalpolitik und ebenso eine Bankenaufsicht. Und weil die einzelnen Länder nicht mehr über eine Abwertung ihrer Währung ihre Lage verbessern konnten, mussten sie auf andere Weise jedes für sich die Wettbewerbsfähigkeit steigern. Das war extrem schwer – besonders mitten in einer Krise.
Vieles blieb doch Stückwerk?
Es wurde besser. Aber es ist tatsächlich noch immer ein weiter Weg, der beschritten werden muss. Die Bankenunion im Jahr 2012 war ein wirklich grosser Fortschritt. Dennoch ist sie noch nicht vollendet. Es gibt noch immer keine Einlagenversicherung und eine Bankenrettung über die Grenzen der einzelnen Länder hinaus.
Erachten Sie denn die Situation in Europa jetzt als stabil?
Die Lage ist besser, aber es gibt nach wie vor Mängel. Eine vollendete Bankenunion ist zwingend, um ein effektives Krisenmanagement zu schaffen. Dazu ist es aber auch zwingend notwendig, dass das Zentrum der Eurozone über deutlich grössere Mittel verfügt. Es braucht zentrale Fiskalkapazitäten, die Möglichkeit staatliche Gelder kollektiv einzusetzen. Es gibt aber keinen Mechanismus für ein solches kollektives Vorgehen aller Euroländer. Was bisher vorgeschlagen wurde, reicht nicht.
Es scheint, dass Europa in der neuen Weltordnung mit grossen Blöcken wie den USA und China schwach ist und kaum vorankommt.
Die Währungsunion ist ein sehr kompliziertes Unterfangen. Fortschritt kommt nur in kleinen Schritten und meist dann, wenn Druck dazu besteht. Während der Krise gab es viel Druck, und vieles wurde erreicht. Ohne Krise sehen die Leute keine Dringlichkeit darin, einen Teil ihrer Unabhängigkeit ans Zentrum abzugeben.
Halten Sie den Euro für eine gute Idee?
Ökonomen sind immer sehr skeptisch gegenüber einer Währungsunion. Denn es ist eine massive politische Übereinkunft und eine umfassende Infrastruktur dafür nötig. Aber wenn sie einmal eine Währungsunion geschaffen haben, können sie nicht mehr zurück. Die Folgen wären viel zu schlimm.
Sie waren beim IWF auch für die Schweiz verantwortlich. Was denken Sie über unsere Lage?
Mein Eindruck von den Schweizer Entscheidungsträgern ist sehr positiv. Sie gehen mit einem Mix aus Pragmatismus und Professionalität vor. Sie haben eine sehr schwierige Situation. Die Schweiz wird als sicherer Hafen wahrgenommen. Wenn es irgendwo Probleme auf der Welt gibt – ob in der Eurozone oder mit einem Virus –, ist die Schweiz davon durch eine Aufwertung des Frankens betroffen. Deswegen hat die Nationalbank interveniert und auch die Zinsen deutlich in den negativen Bereich gesenkt. Die Nachteile werden immer grösser, je länger die Negativzinsen bleiben. Aber man muss den Kontext dieser Politik berücksichtigen. Und die Konsequenzen der Negativzinsen unterscheiden sich stark von jenen in anderen Ländern, besonders jenen in der Eurozone.
Welche Unterschiede denn?
Die Schweizer Banken sind sehr gut kapitalisiert und haben eine gute Profitabilität. Wenn man auf den letzten Aufsichtsreport der Eurozone schaut, der vor einigen Wochen erschien, dann sieht man, dass die Profitabilität der Eurozonen-Banken weit auseinandergeht. Viele Banken sind noch immer zu wenig profitabel. Dieses Problem gibt es in der Schweiz nicht. In der Schweiz sorgt die Nationalbank auch dafür, dass die Banken mit grösseren Freigrenzen auf den Einlagen für die Folgen der Negativzinsen kompensiert werden.
Was denken Sie über die Politik in der Schweiz gegenüber der EU? Wir haben hier die Debatte über einen Rahmenvertrag mit der EU. Wie wichtig schätzen Sie diesen ein?
Ich habe diese Debatte nicht so eng verfolgt, um dazu eine Meinung abzugeben. Aber wir haben in Grossbritannien ja auch eine Debatte über die künftigen Beziehungen zur EU. Und auch innerhalb der EU gibt es die Diskussion über das angemessene Gleichgewicht zwischen nationaler Souveränität, ökonomischer Offenheit und der Delegation von Hoheitsrechten an ein Zentrum. Ich finde das Beispiel der Schweiz interessant, weil es dem Land gelungen ist, für lange Zeit ausserhalb der EU zu bleiben. Aber Probleme, die das mit sich bringt, bleiben wegen der Geografie erhalten.
Internationale Organisationen wie der IWF scheinen heute gefährdet zu sein?
Ich war mehr als 20 Jahre beim IWF. Ich kann mich an viele Episoden erinnern, als die Leute dachten, der Fonds spiele keine Rolle mehr. Lange dachte man auch, ein entwickeltes Land würde nie zum IWF kommen. Aber die Welt verändert sich immer, Kapital ist sehr beweglich, und das moderne Finanzsystem und Länder erleben Zyklen. Den IWF wird es deshalb auf die eine oder andere Art immer brauchen. Würde es ihn nicht geben, würde man ihn schaffen. Und schaut man sich die Geschichte des IWF an, war das immer eine sehr flinke Organisation. Sie hat sich immer wieder an neue Anforderungen angepasst.
Wir sehen Probleme auch bei anderen internationalen Organisationen wie der Welthandelsorganisation WTO.
Diese Herausforderungen sind nicht neu. Zwischen 2008 und 2011 leitete ich das Politikdepartement des IWF. Das war zu Beginn der Krise. Schon drei Jahre davor haben wir über Änderungen der IWF-Beitragsquoten diskutiert, damit diese die Änderungen in der Weltwirtschaft besser widerspiegeln – besonders in den Schwellenländern. Die Länder haben gesehen, dass die Institution sich über deren grössere Bedeutung Gedanken macht. Doch haben wir das Problem gelöst? Nein. Diese Länder sind noch immer unterrepräsentiert. Es ist jetzt wichtig, dass weitere solche Schritte folgen. Sie haben Recht: Wir gehen in der Weltwirtschaft durch eine Periode, in der die globale Zusammenarbeit nicht so gut ist, wie wir das einmal gesehen haben.
*****************
IWF Blick auf die Schweiz
Reza Moghadam (57) ist Brite iranischer Herkunft. Seit 2014 arbeitet er als Ökonom bei der US-Grossbank Morgan Stanley und ist zuständig für staatliche und öffentliche Institutionen. Während der Eurokrise war er beim Internationalen Währungsfonds (IWF) für Europa und damit auch für die Schweiz verantwortlich. Der IWF spielte bei der Bewältigung der Krise eine entscheidende Rolle. Insgesamt war Moghadam während 22 Jahren in führenden Positionen beim IWF tätig. mdm