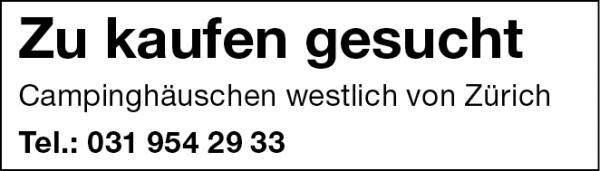WALTER MENGISEN
Der Alltag eines chinesischen Sportstudenten in Beijing beginnt in der Regel um 6 Uhr morgens. Je nach Studienjahr schlafen die Studierenden auf dem Campus geschlechtergetrennt in Sechserzimmern mit gemeinsamer Toilette auf dem Korridor und Dusche in separatem Gebäude. Wer es bis zum Doktoratsstudium bringt, muss sich das Zimmer nur noch mit einer Person teilen. Der ordentlichen Vorlesungen beginnen um 8 Uhr, aber die meisten üben, trainieren und lernen schon vorher. Wer es an die Sportuniversität Beijing nach einer Aufnahmeprüfung geschafft hat, gilt als privilegiert und von ihm erwartet man besondere Leistung. Um rund 6.30 Uhr ist nach Fakultät und Vertiefungsrichtung getrennt «Antreten» zum Morgenappell, bei dem Organisatorisches mitgeteilt und auch Lob und Tadel für die Studierenden ausgeteilt wird.
Dies erinnert mich stark an meine Militärzeit. Anschliessend essen die meisten ein kurzes Frühstück bestehend aus Suppe, Gemüse und gedämpftem Brot. Für europäische Magen etwas gewöhnungsbedürftig, aber sinnvoller als die Fastfood-Kultur, die auch in China Einzug gehalten hat, mit sehr sichtbaren Folgen, vor allem bei den Kindern. Übergewicht bei Kindern ist auch in China heute ein Thema. Kurz vor Vorlesungsbeginn ist ein Riesengedränge auf dem Campus, wenn sich 11 000 Studierende in ihre Vorlesungsräume und Trainingshallen begeben. 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn und in den Pausen ertönt aus Lautsprecher auf dem Campus Musik, meist klassische, europäische Musik. Die Hierarchie ist auch hier an der Universität nach wie vor gross. Was die Dozenten sagen und lehren gilt in der Regel als nicht diskutierbar. Einen akademischen Diskurs zu führen ist eher schwierig, und es trauen sich nur die Besten, eine Frage zu stellen oder gar kritisch etwas zu hinterfragen. Die Angst, einen Fehler zu machen und «das Gesicht zu verlieren», ist weit verbreitet. Ich muss meine Studierenden jeweils stark ermuntern, Fragen zu stellen, und sie waren erstaunt über meine These, dass Lernen primär auch bedeutet, Fehler zu machen. In der Zwischenzeit haben sie sich an meine europäische Eigenart gewöhnt, ich bin eben hier ein bisschen exotisch.
Die Zeit zum Mittagessen ist ziemlich unantastbar, wie generell Essen wichtig ist im chinesischen Alltag und sozialen Kontext. Die Mensa muss sehr leistungsfähig sein, um diese Menge an Studierenden zu verpflegen. Dass Dozierende und Studierende am gleichen Ort essen wie bei uns in Magglingen, ist hier schlichtweg undenkbar. Für die Dozierenden gibt es ein separates Restaurant. Was auffällt, ist der unheimliche Trainingseifer und der Fleiss der Studierenden. Auch wenn der reguläre Unterricht um 17.30 Uhr zu Ende ist, finden verschiedenste Vorlesungen und Trainings am Abend statt, und die Bibliothek ist vollbesetzt. Bis 22 Uhr ist immer voller Betrieb. Dies gilt übrigens auch für Samstag. Einzig am Sonntag wird es für chinesische Verhältnisse ein bisschen ruhiger, aber das heisst für uns nach wie vor Trubel.
Dieser Trainingsfleiss hat aber auch seine negativen Seiten, speziell im Spitzensport. Die Trainingsumfänge und -intensitäten sind bereits im Jugendalter sehr hoch und dadurch erzielen chinesische Sportlerinnen und Sportler oft bereits im jungen Alter Höchstleistungen. Der Preis dafür ist aber oft eine zu starke Belastung des Körpers und ein Ausscheiden wegen körperlicher Beschwerden bereits im jungen Erwachsenenalter. Das Problem ist auf Führungsebene erkannt, aber die Umsetzung mit den Trainern gestaltet sich noch recht schwierig. Unter anderem deshalb hat man sich für die aktuelle Vorbereitung der Olympischen Spiele Trainer aus Europa und den USA geholt. Nicht dass der Eindruck entsteht, alle chinesischen Studierenden wären nur fleissig. Während des Unterrichts haben chinesische Dozenten ebenfalls mit der Unsitte zu kämpfen, dass oft mit dem Handy gespielt wird, anstatt sich auf den Unterricht zu konzentrieren. Wie bei uns scheint das Handy bei chinesischen Studierenden ein unverzichtbarer Teil der jugendlichen Existenz zu sein.
In einem Monat werde ich wieder in die Schweiz zurückkommen mit vielen Eindrücken und Anregungen aus China. Das eine oder andere aus China wäre auch bedenkenswert für die Hochschule in Magglingen.
INFO: Walter Mengisen ist Rektor der Eidgenössischen Hochschule für Sport Magglingen EHSM und stellvertretender Direktor des Bundesamts für Sport Baspo, ausserdem Präsident des SC Lyss.
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden oder Registrieren.