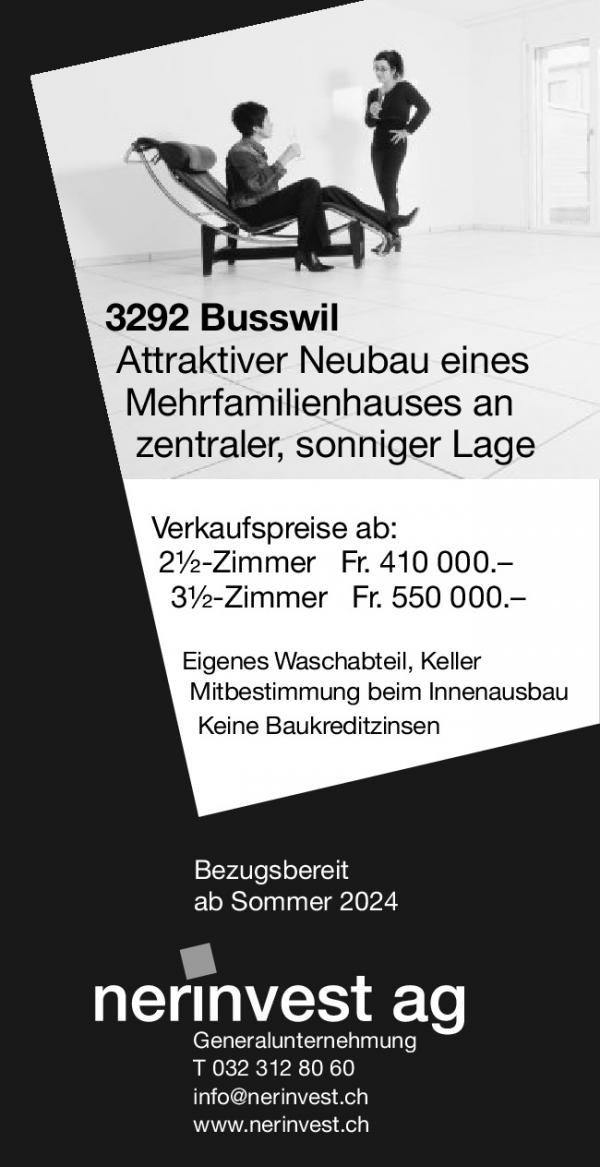Interview: Andrea Butorin
Rita Adam, persönliche Begegnungen sind in der Diplomatie unerlässlich. Wie sehr wirkt sich das Coronavirus auf die diplomatischen Gepflogenheiten aus?
Rita Adam: Es ist so, wir arbeiten natürlich nicht mehr gleich wie vorher. Lange fanden sämtliche Kontakte ausschliesslich mittels Video- oder Telefonkonferenzen statt. Wie in vielen anderen Berufen gab es auch bei uns einen Technologieschub, was positiv ist. Man merkte, dass nicht für alles eine Reise notwendig ist. Andererseits basiert unser Beruf auf Vertrauen und auf vertraulichen Gesprächen. Es ist kein Klischee, dass an Konferenzen die eigentlichen Lösungen oft ausserhalb der Sitzungszimmer gefunden werden. Sich mit jemandem hinzusetzen und versuchen zu verstehen, was sein eigentliches Problem ist, ist ein Schlüsselfaktor der Diplomatie. Deshalb besteht schon ein Interesse, sobald es die sanitäre Situation erlaubt, wieder zu einem gewissen Anteil an realen Begegnungen überzugehen.
Wie haben Sie den harten italienischen Lockdown erlebt?
Als Diplomatin ist man angehalten, die Regeln des Gastlandes zu respektieren. Deshalb habe ich fast acht Wochen lang mein Quartier nicht mehr verlassen, mein Radius beschränkte sich auf zirka einen Quadratkilometer. Abgesehen von gelegentlichen Spaziergängen ums Haus oder Einkäufen im Supermarkt oder dem täglichen Gang ins Büro auf der Botschaft war ich zuhause. Wer das Haus verliess, musste ein Dokument ausfüllen; es gab eine abschliessende Liste von Gründen, weshalb man sich draussen bewegen darf, und die Menschen haben sich sehr diszipliniert daran gehalten, das war beeindruckend.
Ist Ihnen da nicht die Decke auf den Kopf gefallen?
Es gab sicher bessere und schlechtere Momente. Die Situation war für alle anders: Wer Familie hatte, war im Vorteil nicht allein zu leben. Doch wenn man zum Beispiel in kleineren Wohnungen lebt, ist es nicht so einfach. Dazu kam der Faktor des Homeschooling, das meiner Beobachtung nach in Italien wie in der Schweiz für berufstätige Eltern eine erhebliche Herausforderung darstellte. Ich lebe allein und habe daher diese Probleme nicht. Aber nach einem Monat dauernd alleine zu essen begann es zu «gnüegele». Zum Glück konnte ich beispielsweise mit Freunden ab und zu verbunden über Skype essen, das hat geholfen. Als ich mich zum ersten Mal wieder frei bewegen konnte, habe ich das enorm genossen.
Hatten Sie Angst vor dem Virus?
Nein. Ich habe es ernst genommen, aber Angst hatte ich keine.
Wie sehr dominierte Corona Ihre tägliche Arbeit?
Was meine Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt beschäftigte, war die Rückholaktion für Schweizer Bürgerinnen und Bürger im Ausland. Diese gab es flächendeckend; insgesamt organisierte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) Rückreisen für 4200 Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger aus der ganzen Welt. Man sieht, dass die Schweizer mobil sind und viel reisen. Weiter musste ich sicherstellen, dass unser Betrieb weiterhin funktioniert und wie ich mein Personal schützen kann. Wir führten in der Botschaft eine rotierende Minimalpräsenz ein. Ich selber bin aber jeden Tag ins Büro gegangen, weil es bloss fünf Minuten Fussweg von zuhause entfernt ist und weil ich es sowohl für die Mitarbeitenden als auch für mich wichtig fand, dass wir uns gerade in dieser schwierigen Phase trotzdem einmal die Woche «real» sehen. Natürlich wahren wir gebührende Distanz. Da Italien ein Nachbarland ist, waren wir auch auf der Ebene der diplomatischen Arbeit sehr beschäftigt, Stichwort Grenze zum Beispiel, da hatten wir viele praktische Fragen zu lösen. Insofern muss ich sagen: Es war eine sehr intensive Zeit.
Die Grenzschliessungen zwischen der Schweiz und Italien waren ein grosses politisches Thema. Im Mai mussten Sie vor dem Parlament in Rom «antraben», wie der «Blick» schrieb, weil sich Italien über die langen Schlangen vor dem Zoll ärgerte. Im Juni herrschte gegenseitige Missstimmung, weil die Schweiz die Grenzen später öffnete, als Italien dies tat. Gelang es Ihnen, die Wogen zu glätten?
Wie gesagt: Wenn man eine gemeinsame Grenze hat, gibt es sehr rasch ganz konkrete Probleme zu lösen. Es war eine aussergewöhnliche Situation: Noch vor einem Jahr hätte sich niemand vorstellen können, dass wir in so kurzer Zeit plötzlich mit solchen Fragestellungen konfrontiert sein würden. Wir waren in dieser Phase in ständigem Kontakt mit Italien und pflegten den Dialog auf allen Ebenen: Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga telefonierte mehrmals mit dem italienischen Regierungschef Giuseppe Conte, Bundesrat Cassis sprach mehrmals mit dem italienischen Aussenminister Luigi Di Maio, Staatssekretär Roberto Balzaretti war sehr aktiv, ich ebenso auf meiner Stufe. Klar gab es regelmässig konkrete Probleme zu lösen, aber ich glaube, wir sind insgesamt gut durch diese Zeit gekommen. Man darf nicht vergessen, dass trotz aller Einschränkungen beispielsweise sämtliche 4000 Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die allein im Kanton Tessin im Gesundheitswesen arbeiten, stets einreisen konnten.
Allerdings unter teils massivst erschwerten Bedingungen.
Die zuständigen Behörden in der Schweiz und Italien haben sich dafür eingesetzt, die aus den Einreisebeschränkungen resultierenden Unannehmlichkeiten auf ein Minimum zu beschränken. Insgesamt hat es funktioniert, und die in essenziellen Sektoren wie dem Gesundheitswesen arbeitenden Grenzgänger konnten immer zur Arbeit kommen. Ich habe den Eindruck, dass dies auch für viele von ihnen wichtig war, weil sie sich stark mit ihrer Arbeit identifizieren.
Die Schweiz hat Coronapatienten aus Frankreich aufgenommen, als dort die Versorgungslage prekär wurde. Weshalb haben wir nicht auch Italien Hilfe angeboten und italienische Patientinnen aufgenommen, als sich die Lage dort zuspitzte und die Krankenhäuser überfüllt wurden?
Man kann nicht sagen, dass man Italien nicht geholfen hat. Italien hat kein solches Hilfsgesuch gestellt. Die Schweiz hat Italien aber von sich aus Unterstützung angeboten, und es gab verschiedene Solidaritätsaktionen. Wir haben beispielsweise Material geschickt, was Italien dankbar angenommen hat. Der italienische Aussenminister hat das spezifisch verdankt, als er im Juni auf Besuch in der Schweiz war. Zudem war auch für die italienische Seite wichtig, dass die Schweiz die Grenze nie vollständig geschlossen hat und die Grenzgänger weiterhin zur Arbeit gehen konnten.
In der Tat verlief das Treffen der Aussenminister sehr harmonisch, und Luigi Di Maio signalisierte, der Schweiz als Dankbarkeit bei ihr wichtigen Themen entgegenzukommen. Eines davon ist die Ratifizierung des Grenzgängerabkommens, auf das die Schweiz seit fünf Jahren wartet. In einem SRF-Beitrag über Sie hiess es: «Wenn Rita Adam dessen Ratifizierung schafft, kann sie sich als Botschafterin ein Denkmal setzen.» Steht der Sockel nun bereits?
Ich bin keine Person, die in Denkmallogik funktioniert, sondern versuche einfach, Probleme zu lösen. Das schafft man übrigens meines Erachtens immer nur durch einen Team-Effort. Es ist so: Wir haben mit Italien einen neuen Text ausgehandelt, weil der aktuell gültige von 1974 und damit aus einer Zeit stammt, als die Situation bezüglich Grenzgänger eine ganz andere war. Wir sind überzeugt, dass es Sinn macht, ein neues Abkommen abzuschliessen. Der Text steht seit 2015, und wie erwähnt war Italien bislang nicht bereit, diesen Text zu unterzeichnen und zu ratifizieren. Das sorgt natürlich insbesondere im Tessin für Frustration und Ungeduld, was ich gut verstehen kann. Dieses Problem zu lösen ist eine Priorität des Bundesrats. Im Juli besuchte der italienische Vize-Finanzminister Bern, dabei wurden die Gespräche lanciert. Es bleibt unser Ziel, dort nun rasch eine Lösung zu finden.
Sie persönlich haben noch zwei Jahre Zeit, um dieses Denkmal fertigzubauen. Wie lange braucht es, um ein solches Geschäft unter Dach und Fach zu bringen?
Ich würde mich nicht auf einen Zeitrahmen festlegen wollen. Klar ist für uns, dass es eine rasche Lösung braucht. Das ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit, was wir auch den italienischen Partnern signalisiert haben.
Kann die Schweiz auch bei den Verhandlungen zum Rahmenabkommen auf italienische Unterstützung zählen?
Die Schweizer Europapolitik ist ein regelmässiges Gesprächsthema in unseren Kontakten mit Italien. Wir legen unseren Partnern auch dar, was die Spezifitäten der Schweiz sind und wie bei uns die politischen Prozesse funktionieren. Da gibt es sicher Bereitschaft zuzuhören und zu verstehen, wieso es so ist, wo wir stehen, was unsere Probleme sind. Gleichzeitig müssen wir uns auch bewusst sein, dass Italien hinter der Position der EU-Kommission steht, die von der Schweiz eine rasche Antwort auf die offenen Fragen zum Entwurf für ein institutionelles Abkommen erwartet.
Vor der Abstimmung über die Begrenzungsinitiative wird es hierzu sicher keinen Durchbruch geben.
(unterbricht) Ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese beiden Themen auseinanderhalten. Diese Abstimmung ist die nächste Etappe.
Die Initiative kommt im September an die Urne. Wie wird sie in Italien wahrgenommen, dem Land, dessen Bewohnerinnen und Bewohner einst primär von der Schwarzenbach- Initiative angesprochen waren?
Die Iniatitive ist kein grosses Diskussionsthema in Italien. Aber Menschen, die sich mit den Beziehungen zwischen der Schweiz und Europa befassen, sprechen mich natürlich darauf an. Für die EU und auch für Italien ist die Personenfreizügigkeit etwas Fundamentales. Wir haben uns ja im Rahmen der Bilateralen I dafür entschieden, an der Personenfreizügigkeit teilzunehmen. Vergessen wir nicht, dass nebst den 70 000 italienischen Grenzgängerinnen, die jeden Tag zum Arbeiten in die Schweiz kommen, zum Beispiel auch rund 50 000 Schweizer in Italien leben. Ich möchte auch daran erinnern, dass die Bilateralen für uns essenziell sind, da sie den Marktzugang zu unserem nach wie vor wichtigsten Exportmarkt Europa sichern.
Macht die Abstimmung Sie nervös?
Nein. Aber Volksabstimmungen muss man immer ernst nehmen und eine seriöse Debatte zum Abstimungsgegenstand führen. Ich finde, das schulden wir uns gegenseitig als Bürgerinnen und Bürger. Wenn man wie ich länger im Ausland lebt, wird einem bewusst, welche Stärken wir mit unserem politischen System und der direkten Demokratie haben. Natürlich kann dies manchmal auch zu Knacknüssen für Bundesrat und Parlament führen. Aber es bietet der Bevölkerung die Gelegenheit, selber die Agenda der politischen Diskussionen mitzubestimmen, was ich sehr wertvoll finde.
Ein Thema, über das coronabedingt in letzter Zeit wenig gesprochen wurde, war die Flüchtlingskrise. Italien ist stark davon betroffen. Wie erleben Sie das in Rom?
In der innenpolitischen Debatte ist das Thema regelmässig präsent. Klar ist, dass Italien dringend eine Reform des Dublin-Systems wünscht, weil es aufgrund der geografischen Situation überdurchschnittlich exponiert ist. Wir unterstützen die Position Italiens und befürworten eine grundlegende Reform des Systems, um eine gerechtere Verteilung der Last, welche Länder Asylverfahren führen müssen, herzustellender Verantwortung zur Führung der Asylverfahren zu erreichen.
Die Schweiz ist also bereit, mehr zu helfen; mehr Flüchtlinge aufzunehmen?
Die Schweiz unterstützt eine grundlegende Dublin-Reform mit dem Ziel einer ausgewogeneren Lastenverteilung unter sämtlichen Teilnehmerstaaten. Ich möchte ergänzen, dass die bilaterale Migrationszusammenarbeit ein sehr wichtiger Teil unserer Beziehung zu Italien ist, der gut funktioniert. Wir tauschen uns regelmässig aus, die Umsetzung von Dublin sowie des Rücknahmeabkommens funktioniert gut. Wegen des Coronavirus war diese Zusammenarbeit eine Zeit lang sistiert, aber langsam beginnt sie wieder, unter Einhaltung der entsprechenden sanitären Sicherheitsmassnahmen. Italien ist für uns ein prioritärer Partner und ist stark interessiert am Dialog mit uns bei Themen, bei denen wir über besondere Erfahrung verfügen: Zum Beispiel die beschleunigten Asylverfahren interessieren, damit die Menschen rascher Bescheid und klare Perspektiven kriegen. Oder auch das Thema freiwillige Rückkehr von Asylsuchenden, die keine Aussicht auf einen positiven Entscheid haben.
Welche Themen beschäftigen Sie weiter?
Nächste Woche findet die Feier zur Eröffnung des Ceneri-Basistunnels statt. Das ist, nach dem Gotthard-Basistunnel 2016, der letzte Teil der Neat (neue Eisenbahn-Alpentransversale, die Red.), der eröffnet wird. Die ganze Eisenbahn-Verlagerungspolitik ist nicht nur für die Schweiz gedacht, sondern es ist ein substanzieller Beitrag an eine nachhaltigere europäische Verkehrspolitik im Rahmen des Korridors von Genua nach Rotterdam. Die bilaterale Zusammenarbeit mit Italien im Verkehrs- und Infrastrukturbereich funktioniert sehr gut.
Normalerweise wechselt man in der diplomatischen Laufbahn zwischen Posten im Ausland und in der Schweiz. Sie amteten vor Rom bereits vier Jahre als Botschafterin in Tunesien. Erwartet Sie anschliessend ein Posten in der Schweiz?
Das weiss ich noch nicht. Meistens kommen wir nach zwei, drei Stationen wieder in die Schweiz. Das ist sinnvoll, damit man im Land, das man vertritt, den Alltag wieder «lebt» und damit vertraut bleibt. Ich bin noch zwei Jahre in Rom und bin sehr zufrieden dort, es gibt auch noch einiges, das ich bewegen möchte.
In einem früheren Interview sagten Sie, dass das Diplomatenleben im Moment für Sie stimmt, sie wüssten aber nicht, ob Sie mit 55 immer noch Lust auf einen Posten im Ausland haben werden. Wie sehen Sie das heute, 51-jährig?
Ich ziehe regelmässig Bilanz, frage mich, was mir Befriedigung gibt, was schwierig ist und was überwiegt. Ich bin immer noch begeistert von meinem Beruf. Das Leben im Ausland bietet so viel, ich erhalte Einblick in so viele Dinge, denn an einem Ort zu leben ist nicht dasselbe wie zu reisen. Das hat halt, wie alles im Leben, seinen Preis.
Wie man aktuell zum Beispiel in Minsk oder in Beirut sieht, muss man in ihrem Beruf auf alles vorbereitet sein: auf Katastrophen oder Umstürze. Wie bereitet man sich mental auf so etwas vor?
Die Vorbereitung auf Krisenfälle ist in unserem Beruf Standard. Bevor ich nach Tunesien ging, absolvierte ich einen einwöchigen Kurs zum Umgang mit Krisenfällen, der extrem nützlich war. Im März 2015, ein gutes halbes Jahr nach meiner Ankunft, ereignete sich dann der Terroranschlag im Nationalmuseum von Bardo, drei Monate später jener am Strand von Sousse. Ich glaube, man kann schon sagen, dass das Schweizer Aussennetz in seiner Gesamtheit die aktuelle Krise sehr gut bewältigt hat. Die Schweizer Botschaften und Konsulate konnten den Betrieb jederzeit aufrechterhalten und die Leute unterstützen, und das hat damit zu tun, dass diese Ausbildung Teil unseres Berufes ist.
Zwar steigt der Frauenanteil im diplomatischen Dienst stetig, aber aktuell sind lediglich 30 von insgesamt 155 Botschaftern Frauen. Da gibt es Luft nach oben.
Ja sicher. Aber der Trend ist klar: Ich bin die zweite Botschafterin in Rom, aktuell weilt die erste Schweizer Botschafterin in Paris, und bald kommt auch eine Frau nach Moskau. In Italien ist die Frauenpräsenz zur Zeit besonders hoch: Ich habe eine Stellvertreterin, die Generalkonsulin in Mailand und deren Stellvertreterin sind Frauen, ebenso die Direktorin des Istituto Svizzero sowie der Schweizer Schule in Rom. Beide Institutionen gehören zwar nicht zur Bundesverwaltung, aber dennoch zum Gesicht der Schweiz. Das wird in Italien wahrgenommen. Bei der Aufnahme von jungen Diplomatinnen und Diplomaten beträgt der Frauenanteil rund 50 Prozent. Und von den Top-Positionen beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten in Bern gibt es gegenwärtig vier von sechs Direktorinnen.
Wie stehen Sie zu den Anliegen des Frauenstreiks? Hätten sie sich hier engagiert?
Ich habe es aus der Distanz verfolgt, und die starke Mobilisierung hat mich gefreut. Der Frauenstreik hat wirklich etwas ausgelöst – wie man bei den darauffolgenden eidgenössischen Wahlen hat beobachten können. Über den gestiegenen Frauenanteil im Parlament freue ich mich ebenso wie über die Tatsache, dass zurzeit drei Frauen im Bundesrat sind.
Haben Sie in ihrer Laufbahn jemals Diskriminierung erlebt?
Ich kann keinen bestimmten Fall abrufen. Im Gegenteil habe ich auch gezielte Unterstützung erhalten, denn in den letzten rund zehn Jahren merkte man, dass man nach guten Frauen Ausschau halten muss, dass Änderungsbedarf besteht. Zwar bin ich diesbezüglich nicht institutionell engagiert, aber es ist mir ein Anliegen, jüngere Frauen zu ermuntern und ermutigen. Zum Beispiel, indem man Frauen mit entsprechendem Profil dazu motiviert, auch mal ins kalte Wasser zu springen, ein grösseres Risiko eingehen und an sich zu glauben. Denn ohne allzu sehr verallgemeinern zu wollen, finde ich, dass wir Frauen manchmal zu hohe Ansprüche an uns selber stellen.
Sie selber brauchen sich diesbezüglich nichts vorwerfen zu lassen, Sie haben viel erreicht.
Aber ich habe auch erlebt, dass ich einen Anstoss von aussen brauchte, um mich auf eine Stelle zu bewerben.
Ihr Beruf hat eine konservative Note, gerade auch, was die Partnerinnen und Partner von Botschafterinnen und Botschaftern angeht.
Die Zeiten, als klar war, dass man den eigenen Beruf aufgibt und den Mann unterstützt, wenn man einen Diplomaten heiratet, sind zum Glück vorbei. Das entspricht nicht mehr unserer gesellschaftlichen Realität. Heute haben viele Partnerinnen und Partner von Diplomaten selber ein Unistudium absolviert und möchten sich beruflich auch in gewissem Umfang und möglichst kompatibel mit der beruflichen Laufbahn des Partners verwirklichen. Es gibt eine Diskussion, die ich recht lustig finde: Auf Französisch oder Italienisch werde ich oft gefragt, wie ich genannt werden möchte: «Che cosa preferisce: Signora L’Ambaschiatore o Signora L’Ambaschiatrice?» Als Letzteres wurde traditionell die Frau des Botschafters bezeichnet. Dafür gibt es natürlich kein männliches Äquivalent, weil es diese Position – Ehemann einer Botschafterin – lange gar nicht gab.
Welche Variante bevorzugen Sie?
Ich bevorzuge «L’Ambasciatrice», weil ich finde, dass er der gewandelten gesellschaftlichen Realität am besten Rechnung trägt.
Wie viele Sprachen sprechen Sie?
Meine Muttersprache ist Deutsch. Italienisch und Französisch kann ich sehr gut, in Englisch bin ich auch auf einem sehr soliden Niveau. Die Mehrsprachigkeit ist Voraussetzung für unseren Beruf. Von unserem letzten Interview (siehe Samstagsinterview vom 7. März 2015, die Red.) erinnern Sie sich vielleicht ...
... dass Sie zehn Prozent der arabischen Sprache verstehen lernen wollten.
Leider bin ich nicht auf die zehn Prozent gekommen. Die Zeit hat nicht gereicht, und die Sprache ist schwieriger, als ich dachte.
Wie kann man in Ihrem Beruf Freundschaften schliessen?
In meinem Beruf ist es wesentlich, in jeder Situation zu wissen, wen man bei einem Problem anrufen kann und wer einem weiterhelfen könnte. Somit muss ich überall, wo ich ankomme, rasch ein Netz aufspannen. Das kann auch anstrengend sein, ist aber existenziell. Dann muss man sich in meiner Position aber auch bewusst sein, dass viele Menschen den Kontakt zu mir suchen, weil sie meine Funktion und nicht mich als Rita Adam interessant finden. Das muss man auseinanderhalten können. Aber nichtsdestotrotz entstehen aus beruflichen Kontakten manchmal auch Freundschaften, bei denen kein Nutzen-Denken dahintersteckt. Ich lege grossen Wert auf langjährige Freundschaften und pflege diese sehr bewusst. Das sind grösstenteils Freundschaften, die nicht aus meinem beruflichen Umfeld entstanden sind, sondern vor meiner Zeit beim EDA. Diese Menschen ermöglichen mir eine andere Perspektive und behandeln mich zum Glück auch nicht als «Exzellenz».
Aber man möchte doch auch am neuen Ort mal spontan mit jemandem essen gehen oder eine Veranstaltung besuchen.
Das ist ein guter Punkt. Im Ausland sind die Kontakte zu gewissen engen persönlichen Bezugspersonen natürlich limitiert. Man kann zwar vieles über Skype machen, aber das ist nicht das Gleiche. Deshalb ist es für mich so wichtig, regelmässig in die Schweiz zu kommen. Meine Mutter beklagt sich dann manchmal ein bisschen, ich sei zu durchgetaktet. Aber wenn ich hier bin, möchte ich neben meiner Familie, die sehr wichtig ist für mich, auch meine Freunde sehen.
Ihre Strandferien liessen sich die Italiener nicht nehmen, hiess es. Haben auch Sie diesen Sommer dolce far niente an einem italienischen Strand genossen?
Meine Ferien habe ich grösstenteils in der Schweiz verbracht. Den August verbringen viele Botschafterinnen und Botschafter traditionell in der Schweiz. Ich bin mir bewusst, dieses Jahr privilegiert zu sein, weil viele meiner Kollegen aufgrund der Situation nicht reisen können. Ansonsten reise ich viel in Italien, beruflich und auch in der Freizeit. Gerade in der aktuellen Situation finde ich es wichtig, dass diejenigen, die die Möglichkeit haben, Geld ausgeben und den Tourismus unterstützen. Italien ist ein unglaublich diverses Land mit Realitäten, die von einem zum anderen Ort sehr unterschiedlich sein können.
Dieses Gespräch führen wir im Garten der «Villa Lindenegg» in Biel, wo Sie übernachteten. Wie fühlt es sich an, in seiner Heimatstadt Gast zu sein?
Dass ich im Hotel übernachtet habe, hat damit zu tun, dass meine Eltern von ihrem Alter her zu der Risikogruppe bezüglich Covid-19 gehören. Ich bin etwas von der Situation in Italien geprägt und möchte sie nicht unnötig gefährden. Wir essen aber jeden Tag zusammen, wenn möglich draussen. Es ist schön, hier in den Ferien zu sein. Regelmässig nach Biel zu kommen ist sehr wichtig für mich, ich habe hier Familie und Freunde, und es ist für mich zentral, eine Verankerung in der Schweiz zu haben, um diesen Beruf machen zu können.
Ist Biel der Ort, an den Sie irgendwann einmal zurückkommen möchten?
Ja, das kann ich mir absolut vorstellen.
*****************
Zur Person
- Rita Adam ist 1969 in Biel geboren
- Sie studierte Jura an der Universität Bern
- Anschliessend machte sie ein diplomatisches Stage bei der UNO in Genf und auf der Schweizer Botschaft in Pretoria, Südafrika
- 2005 - 2008: Chefin der Rechtsabteilung in der Schweizer Botschaft in Paris
- 2010 – 2014: Doppelmandat als Schweizer Botschafterin in Liechtenstein sowie als Vize- direktorin der Direktion für Völkerrecht im EDA
- 2014 – 2018: Schweizer Botschafterin in Tunis
- Seit November 2018: Schweizer Botschafterin in Rom
- In ihrer Freizeit liest und reist sie gern und macht «mit zunehmendem Alter» gern Sport. ab