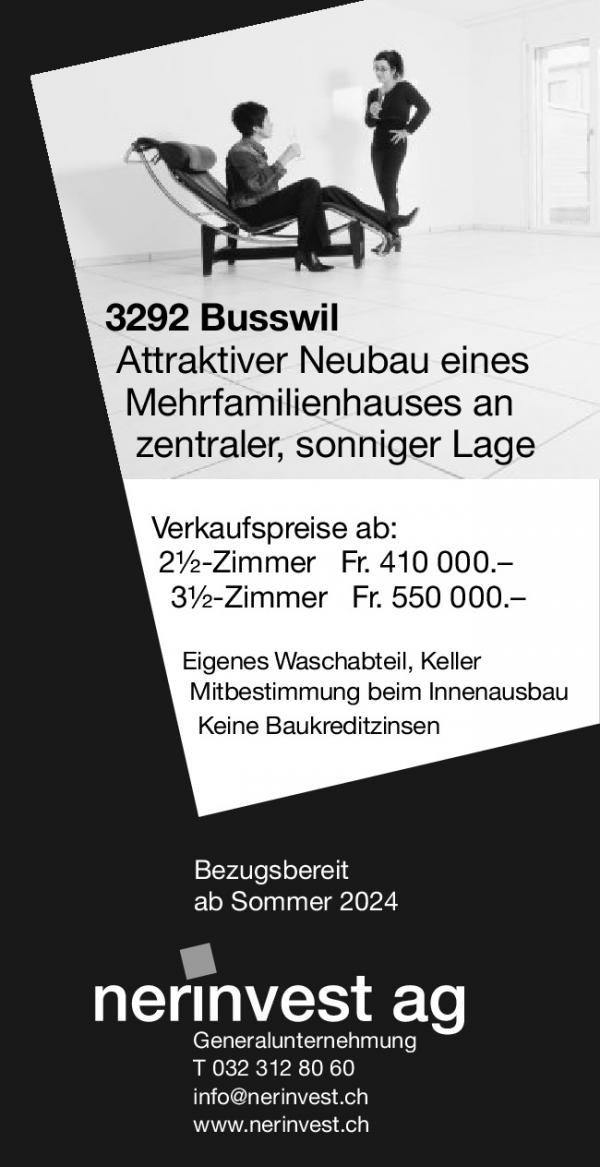Fabian Fellmann
Manoa würde jetzt nicht mit Holzfrüchten spielen. Er würde nicht mit seinem fröhlichen Geplapper das Wohnzimmer füllen und keinen Espresso im hölzernen Tässchen anbieten. Hätten sich seine Mütter nur nach Schweizer Gesetzen ausgerichtet, wäre Manoa gar nicht erst geboren worden.
Der Ausdauer seiner Mütter ist es zu verdanken, dass Manoa vor zwei Jahren trotzdem auf die Welt gekommen ist. Für ihr Familienglück haben Florine Némitz und Magali Chirizzi aus Biel einen Hindernislauf auf sich genommen, der vor vier Jahren begann und noch immer nicht zu Ende ist.
Die beiden Frauen haben getan, was jedes Jahr Hunderte von Paaren mit einem Kinderwunsch in der Schweiz machen. Sie reisen ins Ausland, um ein Kind zu kriegen, weil das hiesige Recht im europäischen Vergleich sehr streng ist und vielen die Fortpflanzungsmedizin verwehrt.
Es betrifft viele Fälle
Betroffen sind lesbische und alle unverheirateten Paare genauso wie alleinstehende Frauen, weil sie in der Schweiz keinen Zugang zu einer offiziellen Samenspende erhalten. Betroffen sind alle Frauen mit unfruchtbaren Eizellen. Betroffen sind unfruchtbare und schwule Paare sowie alleinstehende Männer, weil Leihmutterschaft sogar in der Bundesverfassung untersagt ist.
Erstmals haben Forscherinnen der Universität Bern nun ermittelt, was das in Zahlen bedeutet. Allein für das Jahr 2019 dokumentierten sie 516 Fälle, in denen Personen aus der Schweiz für ein Fortpflanzungsverfahren ins Ausland gereist sind.
Diese erste Zählung ist mit vielen Unsicherheiten behaftet. Die Forscherinnen versuchten auf verschiedenen Wegen, an Daten zu gelangen – unter anderem bei Samenbanken und Behandlungszentren im Ausland. Antworten erhielten sie nur wenige. Fachleute schätzen die wahre Anzahl der Behandlungen auf das Doppelte. Sieben Prozent der Fortpflanzungsverfahren fänden demnach im Ausland statt. Zur Einordnung: In der Schweiz wird jedes 40. Kind im Labor gezeugt, 2019 wurden 11 132 Behandlungszyklen mit 5990 Paaren gezählt.
«Gesteigertes Risiko»
Die rege Nachfrage zeigt, dass die strenge nationale Gesetzgebung viele Wunscheltern, wie sie in der Fachsprache heissen, geradezu dazu drängt, sich anderswo Hilfe zu holen. Das bedeutet für diese ein «gesteigertes Risiko», wie es in der Studie heisst. Das Kindergeschäft ist lukrativ, die Werbemaschinerie verleitet zu immer weiteren Eingriffen, die Wunscheltern begeben sich in eine verletzliche Position, wenn sie sich im Ausland und in einer fremden Sprache behandeln lassen. Häufig stossen sie auf Probleme, wenn sie ihre Elternrechte von den Schweizer Behörden anerkennen lassen wollen.
Die so gezeugten Kinder verlieren oft das Recht, ihre eigene Abstammung zu kennen – worauf das Schweizer Recht eigentlich besonderen Wert legt. Weil Studien belegen, dass die Kenntnis der eigenen Herkunft wichtig ist für die Entwicklung der Persönlichkeit, wird in der Schweiz der Samenspender registriert, seine Nachkommen erhalten mit 18 einen Anspruch, seine Identität zu erfahren. Bei anonymen Spenden im Ausland ist das nicht gegeben. In den nächsten Monaten wird der Bundesrat eine Reform dieses Abstammungsrechts prüfen, eine Expertenkommission erarbeitet derzeit Vorschläge dazu.
Viele Fallstricke
All die medizinischen und rechtlichen Fallstricke kennen Florine Némitz und Magali Chirizzi nur allzu gut. Für beide war schon eine geraume Weile klar, dass sie gemeinsam Kinder wollten. Rasch fiel die Wahl auf Spanien, das für Wunscheltern aus der Schweiz am attraktivsten ist, weil die Gesetzgebung liberal, das Angebot preiswert und das Land gut erreichbar ist.
Am liebsten hätten die Frauen ihr Kind mit einer Methode gekriegt, in der beide eine leibliche Mutterrolle spielen: Eine von ihnen hätte die Eizelle beigesteuert, ein Samenspender den männlichen Keim, die andere hätte das Kind ausgetragen. Als der Kostenvoranschlag der Klinik in Valencia 15 000 Euro überstieg, zogen sie die Notbremse und entschieden sich für eine gewöhnliche Samenspende.
Ein Riesenstress
Kostspielig wurde es trotzdem. «Unser Sohn hat uns 6000 Euro gekostet», sagt Florine Némitz. Dabei wurde sie schon im ersten Anlauf schwanger. Dass es auch schwieriger sein kann, erfahren sie jetzt bei den Versuchen für das zweite Kind. «Es ist eine Katastrophe», sagt Magali Chirizzi.
Sie muss sich in der Schweiz von der Gynäkologin per Ultraschall untersuchen lassen. Zeigt ihr Zyklus an, dass der richtige Moment gekommen ist, springt die ganze Familie am nächsten Tag ins Flugzeug nach Spanien. Schon dreimal haben sie das alles auf sich genommen, Corona-tests inklusive. «Wir waren drei Monate in Folge ständig weg. Das löst Stress aus», sagt Florine Némitz. Dabei kriegen Frauen, die schwanger werden wollen, stets zu hören: Stress vermeiden.
Erneut greift das Paar auf anonyme Samenspenden zurück. Es sei sonst ungerecht gegenüber Manoa, der seinen leiblichen Vater nie kennen wird. Die Mütter sind sich aber sehr bewusst, dass es wichtig ist für den Kleinen, über seine Herkunft Bescheid zu wissen. Sie erklären Manoa darum immer wieder, wie er zur Welt gekommen ist. Auf dem Bücherregal bilden Engel-Figürchen seine Familienkonstellation ab: Manoa, Mamma, Maman – und für den Samenspender ein Barbapapa.
Ehe für alle in der Schwebe
Die Ehe für alle wird lesbischen Paaren den Zugang zur Samenspende ermöglichen. Doch darauf wollen Florine Némitz und Magali Chirizzi nicht warten. Sie sind mit 32 und 33 Jahren schon jetzt nahe an der Grenze von 35 Jahren, ab der Frauen rasant an Fruchtbarkeit verlieren.
Zudem ist noch nicht sicher, ob die Ehe für alle wirklich am 1. Januar 2022 in Kraft treten wird. Rechtskonservative Kreise, darunter das Bistum Chur und evangelikale Gruppen, haben das Referendum ergriffen. Bislang sind etwas mehr als die Hälfte der nötigen 50 000 Unterschriften beisammen, wie Anian Liebrand sagt, der sich auch im Egerkinger Komitee engagiert. Mitte April läuft die Sammelfrist ab, es wird knapp.
Die Mütter von Manoa hoffen, dass das Referendum nicht zustande kommt. Dass sie ins Ausland reisen müssen, um Kinder zu kriegen, finden sie frustrierend. «Wir versuchen, nicht daran zu denken, wie ungerecht es eigentlich ist», sagt Magali Chirizzi. Wie ungerecht auch, dass sie hohe Hürden überwinden mussten, um ihre Familie vom Staat anerkennen zu lassen.
Schwierige Anerkennung
Florine Némitz trug schon während der Schwangerschaft schwer an dem Gedanken, was mit ihrem Sohn und ihrer Partnerin geschehen würde, falls sie im Wochenbett sterben sollte. Auf solche Fragen stossen auch heterosexuelle Eltern. Das Schweizer Recht betrachtet nur jene Frau als Mutter, die das Kind zur Welt bringt. Nicht einmal eine Eizellenspenderin hat in der Schweiz ein Recht auf Anerkennung ihrer Mutterschaft, geschweige denn eine genetisch nicht verwandte Partnerin der leiblichen Mutter. Ein Mann kann Kinder leichter anerkennen, seine Vaterschaft auch durch einen Gentest beweisen.
Als Némitz sich bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde erkundigte, wie sie Sohn und Partnerin rechtlich absichern könnte, erhielt sie keine Antwort. Umgehend aber eröffnete die Behörde ein Verfahren und prüfte, ob das Kind einen Beistand brauche.
«Rechtlich war ich niemand für mein Kind», sagt Magali Chirizzi. Erst zwei Jahre nach der Geburt konnte sie Manoa endlich als ihren Sohn eintragen lassen. «Wir mussten einen regelrechten Kampf austragen», sagt Chirizzi. «Man hat ständig versucht, Zweifel in uns zu wecken, ob wir wirklich zum Letzten bereit sind.»
Sie waren bereit, und sie sind es noch immer. Manoa soll viele Geschwister erhalten, sicher zwei. Oder vielleicht auch vier.