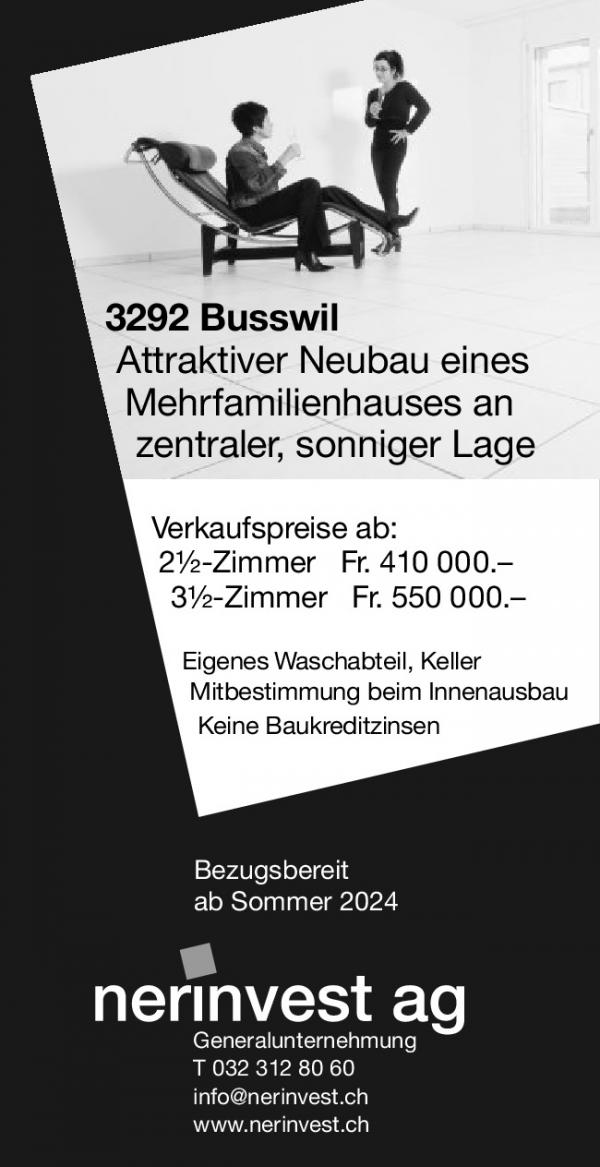Interview: Tobias Graden
Simon Küffer, in einem Interview mit Ihnen habe ich gelesen, dass Sie sich ganz gut über die herrschenden Verhältnisse, politischen Vorgänge und ihre mediale Begleitung aufregen können. Wie sehr haben Sie sich in den letzten Coronakrisenwochen enerviert?
Simon Küffer: Verhältnismässig wenig. Ich bin dem Thema manchmal bewusst aus dem Weg gegangen. Ich habe kleine Kinder, einen Job zu bewältigen, es ist eine anstrengende Zeit. Und ich habe versucht, eine gewisse Bescheidenheit beizubehalten. Wir haben es mit etwas Neuem zu tun, wissenschaftlich gesehen habe ich keine Ahnung von Viren und Pandemien. Mit ein, zwei Ausnahmen ist mir dies gelungen.
Welches waren die Ausnahmen?
Wenn Berechnungen angestellt werden, was ein Leben wert ist und was nicht. Und natürlich in Fragen wie: Was macht der Staat da genau? Wer erhält wie viel Geld, welche Argumente werden dafür angeführt? Und dann diese Zirkelvorgänge: Erst wird im Gesundheitswesen gespart, etwa aufgrund des Steuerwettbewerbs, und dann kommen jene Leute, die dafür verantwortlich sind, mit dem Argument, die Ressourcen seien knapp. Über solche Sachen rege ich mich immer wieder auf.
Wenn ich ganz generell frage, was wir in den letzten Wochen erlebten – haben Sie darauf eine Antwort?
Da bin ich sehr vorsichtig. Wir erleben eine ganz neue Situation. Was ich sagen kann: Dafür, dass es so neu ist, wurde ich bislang erstaunlich wenig überrascht.
Es ist doch recht viel Neues passiert – noch nie wurde in so kurzer Zeit so viel Geld ausgegeben, um so vielen Menschen und Akteuren zu helfen.
Ja, aber es hat eigentlich nichts eine Wendung genommen, die ich komplett nicht erwartet hätte. Es war zu erwarten, dass die Schweizer Regierung recht besonnen reagieren würde, dass vernünftigerweise wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle spielen, dass Gelder in grossem Mass gesprochen werden, um einen Zusammenbruch zu verhindern. Und ich war auch nicht überrascht, dass dieses Geld teils auf Umwegen in eine problematische Richtung fliesst.
Ich hätte von Ihnen eine heftigere Antwort erwartet, zumindest in der Terminologie. Dass Sie beispielsweise sagen, die herrschenden Verhältnisse würden weiter zementiert. Künstler würden mit Almosen abgespeist, Fluggesellschaften mit Milliarden gerettet.
Ich sage ja nichts anderes. Auf der positiven Seite hat es mich auch nicht überrascht zu sehen, dass die Bevölkerung sich recht solidarisch und vernünftig verhält.
Sie haben in dem eingangs erwähnten Interview, in dem es um die Berichterstattung rund um den G-20-Gipfel in Hamburg ging, den «staatsgläubigen Mainstreamjournalismus» kritisiert. Wie haben Sie die hiesige Berichterstattung in den letzten Wochen erlebt – auch als staatsgläubig?
Ja, das kann man so sagen. Die Schweiz hat ein sehr unproblematisches Verhältnis zum eigenen Staat. Es bildet sich gerade in solchen Situation rasch ein «Wir» – «wir Schweizer».
Ist das gut?
Nein, es ist sehr heikel. Man schaut die Tagesschau, und die Regierung, die Journalisten und die Zuschauer werden zu einem Wir. Da würde ich vom Journalismus schon erwarten, dass er diese drei Akteure unterscheidet und mir als Zuschauer ein kritisches Bild des Staates vermittelt.
Für diese staatskritische Perspektive mussten auch Linke eine Zeit lang NZZ und «Weltwoche» lesen.
So wird erkennbar, welche Breschen diese Berichterstattung offengelassen hat, und dass sich in diese springen lässt. Mittlerweile ist die Diskussion offener, aber am Anfang der Krise habe ich mich oft über die Berichterstattung in der Tagesschau genervt. Etwa wenn es um die Hilfe für das Gewerbe ging: Ständig wurde der Coiffeur gezeigt – und dabei unterschlagen, dass es auch darum geht, dass dieser Coiffeur mit seiner Miete die Renditen der Immobilienbranche sichert. Ich erwarte von einer Tagesschau, dass sie diese Zusammenhänge aufzeigt.
Letztlich geht es in den unterschiedlichen Standpunkten darum, welchen Wert man der Freiheit beimisst. Selbst Leute in der Kulturbranche fanden ihre Positionen plötzlich von der SVP vertreten.
Der Rechtspopulismus ist ein Populismus, weil er in der Lage ist, viele Positionen zu bedienen und unter anderem den Freiheitsbegriff besetzt. Allerdings meint er dann meist die Freiheit für sich selber, etwa die Unternehmensfreiheit, bestenfalls die Freiheit für die bessergestellten Schweizer – was gleichzeitig viele andere ausschliesst. Dabei müssten die SVP und manche Bürgerliche nach der Coronakrise doch einfach erst mal still sein, wie die UBS nach der Finanzkrise.
Warum denn?
Weil sie und die FDP es waren, die all die Sparmassnahmen durchgedrückt haben, die noch bis vor wenigen Monaten in den Kantonen Spitalschliessungen und Personalabbau propagiert haben. Man fährt im Gesundheitswesen schon im Normalbetrieb auf Sparflamme, in der Krisensituation droht dann sofort die Überlastung, also müssen alle zuhause bleiben – und dann kritisiert die Rechte die Massnahmen, die sie hauptsächlich verantwortet.
Eine unkontrollierte Pandemie würde noch jedes Gesundheitssystem an die Grenzen bringen. Wäre es darauf ausgerichtet, hätte man in 99 von 100 Jahren Überkapazitäten, die man sich schlicht nicht leisten kann.
Das stimmt schon, aber das Spektrum ist graduell. Die Pandemie ist jedoch nicht einfach als Naturphänomen zu betrachten. Ich habe in einem Interview ein passendes Bild dafür gelesen: Stellen Sie sich eine Person vor, die von hinten geschubst wird – das mag der Naturteil sein. Ob diese Person auf einen Steinboden plumpst, von anderen Menschen aufgefangen wird oder einen Abgrund hinunterfällt – das ist eine soziale und politische Frage.
Die letzten Wochen haben in der Schweiz jedoch auch eine grosse Solidarisierungsbewegung gezeigt – an jeder Haustüre klebt ein Zettel mit einem Hilfsangebot. Sind wir also gar nicht so sehr eine Ellbogengesellschaft, wie wir vielleicht meinen?
Was ist der Mensch? Ohne allzu vereinfachende Aussagen zu machen, lässt sich sicher feststellen: Wir sind soziale Wesen. Im Alltag verhält man sich solidarisch und kooperativ. Dieses ganze Konkurrenzding ist viel stärker ansozialisiert, als es uns die Neoliberalen weismachen wollen. Der Sozialanthropologe David Graeber nennt dies provokativ den «Alltagskommunismus». Im täglichen Miteinander verhält man sich nicht als Konkurrent. Und das hat man in dieser Krise gesehen.
Ist es nicht einer der positiven Aspekte dieser Krise, dass die breite Bevölkerung entdeckt hat, wie systemrelevant unterprivilegierte Berufe wie der Krankenpfleger, die Kita-Betreuerin, der Müllmann oder die Supermarktkassierin sind?
Gewiss, das System stützt sich auf diese Säulen. Doch eigentlich bräuchten wir ja ein anderes System.
Heisst das, die Angehörigen dieser Berufe hätten mal einen Tag streiken und damit an den Säulen ritzen sollen?
Nein. Respektive: Das ist eben die Unmöglichkeit, die den ganzen Skandal ausmacht – man zählt auf diese Leute in einer zynischen Art und Weise. Als Arbeitgeber, Aktionär oder Kapitalist weiss ich, dass diese Menschen ihre Arbeit auch aus innerem Antrieb verrichten, auch wenn ich schlechte Arbeitsbedingungen biete. Pflegerinnen und Betreuer hätten streiken können, um das Ausmass ihrer Lage deutlich zu machen – aber natürlich tun sie es nicht. Bourdieu hat dies die «anachronistischen Werte» genannt. Die Arbeitgeber können auf sie zählen, obwohl sie selber diese Werte gar nicht mehr vertreten.
So schlimm ist es mit den Arbeitsbedingungen nun auch wieder nicht. Wenn ich im Grossverteiler einkaufe, blicke ich jedenfalls nicht in leidende Gesichter von Ausgebeuteten.
Gerade in Jobs, die ein öffentliches Gesicht haben, gehört es zu den Bedingungen, dass das Ausgebeutetengesicht überschminkt wird. Klar sehe ich dann einer Verkäuferin im Laden nicht an, dass es ihr schlecht geht. Wie wollen Sie überhaupt wissen, wie es ihr geht?
Immerhin gelten Gesamtarbeitsverträge, die mit den Gewerkschaften ausgehandelt sind.
Zum Glück, ja. Jedenfalls kann man sich auf eine Ethik verlassen, von der man selber behauptet, sie existiere gar nicht.
Nun, da die Bevölkerung auf den Balkonen klatscht, könnte die Entwicklung aber durchaus in die von Ihnen gewünschte Richtung gehen.
Das hoffe ich. Aber es ist nicht das erste Mal, dass sich diese Chance bietet. Es ist ja nicht so, dass die Bevölkerung diese Veränderungen nicht möchte. Sondern es geht um die Frage, wie die politischen Prozesse geregelt sind, sodass tatsächlich eine Veränderung möglich wäre. Und da zeigen sich systematische strukturelle Probleme. Die letzten 20 Jahre, die ich politisch mitbekommen habe, waren doch frustrierend: Es gab Antikriegsdemos, Antiglobalisierungsdemos, Klimademos, Feminismusdemos, die Finanzkrise, Opposition gegen die Banker-Boni, Occupy Wallstreet… und all das hat wenig bewirkt. Es geht also um die Frage: Wie lässt sich das Klatschen in eine politische Veränderung übersetzen?
In einer Demokratie ist dies eine Frage der Mehrheiten. Aber so schlimm, wie Sie es darstellen, ist es in der Schweiz doch nicht. Wir achten auf eine gewisse Opfersymmetrie. In der Frage der Mieterlasse etwa wendet sich ein bürgerlich dominiertes Parlament gegen die Interessen der Hauseigentümer und schützt die Kleinen.
Klar ist es eine Frage der Mehrheiten. Aber es gibt viele Faktoren, die eine Rolle spielen. So ist das Parlament etwa überhaupt nicht repräsentativ für die Bevölkerung, was Bildung und Reichtum betrifft, um nur zwei Aspekte zu nennen.
Aber dieses Parlament hat jetzt gerade Politik für die ganze Bevölkerung gemacht, teils gegen die Interessen seiner Klientel.
Ich glaube auch, dass das theoretisch möglich ist. Aber die Mieterlasse sind ein Thema, das die Bürgerlichen entzweit – es ist auch Gewerbe betroffen. Gleichwohl sehe ich diese Übersetzungsprozesse als ein Problem. Am schlimmsten sind hierbei die Desinvestitionsdrohungen. Das ist schlicht antidemokratisch, das ist ein Erpressungsargument, es passt nicht ins Spiel. Man kann nicht mit jemandem Spielregeln aushandeln, der ständig droht, das Spiel zu verlassen, wenn ihm etwas nicht passt. Als Wähler kann ich dann meine Meinung gar nicht mehr äussern, weil ich Angst habe, den Job zu verlieren.
Ist es nicht so, dass das System komplexer ist, als es die Linke gerne sieht? Alle Akteure sind miteinander verhängt; es gibt beispielsweise nicht nur die bösen Vermieter – in den Immobilien steckt auch unser Pensionskassengeld.
Dass es Pensionskassen überhaupt gibt, ist ja schon ein Kapitalinteresse. Dass sie dann noch gezwungen sind, zunehmend bei Immobiliengeschäften mitzumachen, lässt sich doch nicht als Argument dafür brauchen, dass wir alle darin verwickelt sind. Klar habe ich als Pensionskassenbezüger einen Nutzen durch Mieteinnahmen – doch gleichzeitig bin ich auch Mieter, und als solcher habe ich den ungleich grösseren Schaden. Ohnehin könnte ich sagen: Die Welt ist gar nicht so komplex, im Gegenteil, sie ist sehr simpel strukturiert.
Wie meinen Sie das?
Das einzige, was interessiert, ist die grösstmögliche Profitrate. So funktionieren die Kapitalmärkte. Darin wird alle Komplexität ausgeblendet, und die Welt auf diesen einen Faktor reduziert. Wenn es zwei Anlagemöglichkeiten gibt, wählt das Kapital jene mit der grösseren Rendite, es interessiert nicht, was dahintersteckt. Ein Unternehmen kann an sich gut funktionieren, wenn es geringere Rendite hat als ein anderes, wird es auf Dauer eingehen, weil das Kapital nicht zu ihm fliesst.
Das stimmt doch einfach nicht. Beide Unternehmen können bestehen, das zeigt die Wirtschaftsstruktur der Schweiz. In Biel existiert die Luxusuhrenmarke neben dem Industriezulieferer, und beide haben Zugang zum Kapital.
Gewiss, und ich mache ja nicht moralische Aussagen über einzelne Akteure. Aber wenn auf Finanzmarktebene mittlerweile Computer die Anlageentscheidungen treffen, dann ist dies das stupidest mögliche Level. Er vergleicht nur Zahlen. Jedenfalls ist das System nicht nur überkomplex, sondern auf seine Weise auch unterkomplex.
Das Kapital lässt sich aber auch für das Gute einsetzen: Blackrock, der grösste Vermögensverwalter der Welt, spricht sich für Nachhaltigkeit aus – Ihnen kommen die Feindbilder abhanden.
Das glaube ich nicht. Solche Aussagen sind auch eine Imagefrage. Die öffentliche Meinung ist ein Faktor im Profitmachen, und diese spricht sich derzeit für nachhaltige Produkte aus. Das primäre Kriterium für Anlageentscheide bleibt aber der Profit, er ist der Zweck. Das Umweltbewusstsein ist nur ein Mittel dazu. Wenn es eng wird, werden die Nachhaltigkeitskriterien rasch gestrichen.
Die Krisenpolitik der Schweiz ist jedenfalls im Grunde antikapitalistisch – wir geben Abermilliarden aus, um einige Leben zu verlängern.
Meine linksradikalen Freunde würden Ihnen schreiend widersprechen.
Nur zu, einfach ohne das Schreien.
Wir leben in einer Zeit, in der sich die Denkkategorien stark verengt haben. Slavoj Zizek hat sinngemäss geschrieben: Was früher gesunde Sozialdemokratie war, wird heute als Kommunismus verschrien. Was Sie nun als «antikapitalistisch» bezeichnen, war früher liberale Politik. Niemand hätte Roosevelt vorgeworfen, sein New Deal sei Antikapitalismus. Es gilt zu unterscheiden zwischen einzelnen Kapitalisten und dem Kapitalismus als Gesamtsystem. Und dieses System ist auch um Selbsterhaltung bemüht. Das lässt sich etwa an IWF-Chefin Christine Lagarde beobachten, sie forderte kürzlich höhere Steuern.
Das tut auch Warren Buffet, weil er fürchtet, die Stimmung könnte sonst kippen. Das ist doch nicht schlecht.
Nein, aber es bedeutet eben auch: Die Hilfe des Bundesrates ist nicht antikapitalistisch, sondern systemerhaltend.
Das heisst: Jene wie Sie, die das System überwinden möchten, müssten konsequenterweise das Hilfspaket ablehnen. Das ist zynisch und menschenverachtend.
Das tun wir Linken aber gerade nicht! Würde man die Systemüberwindung an sich als Zweck setzen und die Menschen diesem unterordnen, wäre man keinen Deut besser als die Bürgerlichen. Jeder weiss, dass diese Milliarden notwendig sind. Aber sie retten auch das System.
Die Coronakrise bringt gewichtige ethische Fragen aufs Parkett; etwa jene nach dem Wert des Lebens. Wie empfinden Sie diese Diskussion?
Ganz wichtig ist, dass man unterscheidet zwischen der Position, wie sie etwa der Arzt Antoine Chaix vertritt (siehe BT vom 6. April, Anm. d. Red.), und jener von gewissen Wirtschaftsführern. Chaix meint nicht den Wert des Lebens in einem monetären Sinn, sondern ihm geht es um die Frage, warum uns ein Leben hier so viel mehr wert ist als eines in Afrika. Das ist eine sehr legitime Diskussion, sie berührt Themen wie Neokolonialismus und Rassismus. Wenn aber Wirtschaftsführer, die Afrika nicht einmal in ihrem Denkhorizont haben, postulieren, unsere Hilfe müsse doch Grenzen haben, die Betroffenen lebten eh nicht mehr lange, ist das eine ganz andere Diskussion.
Gleichwohl: Die durch den Lockdown angestossene Wirtschaftskrise könnte im Endeffekt weltweit mehr Leid produzieren, als es die Pandemie getan hätte, wenn sie ohne Lockdown angegangen worden wäre.
Mein Punkt ist folgender: Ökonomen wie Rainer Eichenberger denken ja nicht daran, mit dem Geld, das wir ohne Lockdown gespart hätten, in Afrika zu helfen. «Wirtschaftlicher Schaden» ist ein Abstraktum, verschiedenes Leid lässt sich gar nicht miteinander verrechnen. Eine betagte Frau, die an Covid-19 stirbt, ergibt nicht zehn Leid-Einheiten, und häusliche Gewalt in einer von der Krise betroffenen Familie sind zwei. Die Wirtschaft zieht ihre Legitimität nur aus dem Wohlergehen der einzelnen Menschen, wenn sie also Menschenleben vernichtet, kann das rein logisch gar nicht mit der Verhinderung «wirtschaftlichen Schadens» begründet werden. Und: Die Bevölkerung hat das Recht zu entscheiden, dass sie die alten Menschen schützen will. Dieses Ziel kann ihr eine Krise wert sein.
Aber alle Ressourcen in jedem System sind endlich, insofern knapp. Wir müssen uns immer entscheiden, wem wir sie zugutekommen lassen wollen.
«Knappe Ressourcen», das ist ein ideologisches Konstrukt. Natürlich ist alles endlich. Aber solange sich Menschen ein Vermögen von 50 Milliarden aneignen können, brauchen wir nicht über knappe Ressourcen zu diskutieren. Das ist absolut lächerlich.
Jedenfalls bewegt sich etwas: Selbst Ökonomen, die der Idee bislang wenig abgewinnen konnten, mutieren unter dem Eindruck der Krise zu Befürwortern eines bedingungslosen Grundeinkommens. Ist das gut?
Ich begrüsse es natürlich, dass solche Debatten jetzt geführt werden und ich hoffe, dass sie in eine gute Richtung gehen. Doch in diesem Punkt bin ich misstrauisch. Das Grundeinkommen ist nicht primär ein linkes Anliegen, es kam zuerst von liberaler Seite und wird in der Linken sehr kontrovers diskutiert. Und ich fände es nicht wahnsinnig schlau, mitten in einer Krise impulsiv langfristige Entscheide von solch grosser Tragweite zu treffen.
Die Forderung «Grundeinkommen jetzt!» ist in den letzten Wochen gerade von linker Seite erhoben worden.
Ich weiss, aber ich habe eine andere Meinung. Das Grundeinkommen würde zwar vom Lohnzwang befreien und damit auch vom Zwang, das Kapital zu bereichern, hätte also grosses emanzipatorisches Potenzial. Doch anderseits dient es auch dazu, die Menschen, die man sonst nicht mehr braucht, ruhig zu halten, sie weiterhin als Konsumenten im System zu behalten und erst noch andere Sozialwerke einsparen zu können. Das ist eine heikle Kiste.
Es gibt auch Menschen, die jetzt die Gelegenheit zum Umsturz sehen. Leben wir in der Vorphase einer Revolution?
Kaum. Meine Hoffnung ist, dass sich durch die Krise ein Bewusstsein herausbildet, das erkennt, wo die Missstände im System liegen. Dass so ein Potenzial zu grundsätzlicher Veränderung entsteht. Dabei wird es um die Eigentumsverhältnisse gehen. Wenn ein Mensch 50 Milliarden US-Dollar besitzt, entscheidet er allein über Dinge im Umfang von 50 Milliarden: Unternehmen, Land, Immobilien… das ist schlicht nicht demokratisch. Es ist doch etwa ganz klar, dass sich in der Klimafrage nicht viel ändert, wenn einzelne Menschen so grosse Entscheidungsmacht haben.
Zum Teil sind das aber durchaus Menschen, die in eine gute Richtung gehen wollen. Der Hass auf Bill Gates beispielsweise ist irrational.
Das Argument dafür geht so: Es bringt nicht viel, gross Geld verteilen zu wollen, wenn man es zuerst anderen wegnimmt. Es ist nicht schön, wenn einer eine Milliarde spendet, sondern es ist ein Skandal, dass er sie sich aneignen konnte.
Sie haben Ihre Musik früher bewusst nicht auf Spotify gestellt. Ihr letztes Album ist nun aber durchaus dort zu finden – was hat sich geändert?
Dass ich die Musik zuerst nicht auf Spotify gestellt habe, lag nicht primär an einer politisch begründeten Verweigerungshaltung.
Sie haben aber in der WoZ geschrieben, die Entschädigung pro Stream sei nicht eine Frage der technologischen Entwicklung, sondern eine ökonomisch-politische.
Ja, das ist auch so. Für mich ging es aber in erster Linie um die Frage, wie sich ein Album finanzieren lässt. Darum wollte ich es zuerst ein paar Monate lang verkaufen, bevor sich die Musik auf Spotify hören lässt. Das ist eine Überlebensstrategie als Musiker.
Ist es nicht ohnehin etwas bemühend, alles unter dem Aspekt Herrscher und Beherrschte, Ausbeuter und Ausgebeutete zu sehen? Gerade für Musiker bietet etwa die Digitalisierung auch Chancen.
Ich denke ja auch nicht in jedem Moment meines Lebens in marxistischen Kategorien. Aber mir geht es um ein Korrektiv. Ich finde etwa die sozialen Medien nicht nur schlecht, obwohl ich sie kritisiere. Aber man denkt die Kategorie von Herrschaft oft zu wenig mit, wenn man etwa über Digitalisierung spricht. Denn in dieser geht es auch darum, dass manche Akteure unheimlich grosse Profite erwirtschaften. Das gilt gerade für die Musik: Es war zwar noch nie so günstig, Musik zu verteilen. Doch wenn ich dafür kein Geld löse, kann ich gar keine Musik mehr machen.
Sie fordern ganz allgemein «eine grundsätzlich andere Struktur.» Wie soll die aussehen?
Es ist gefährlich, eine positive Utopie aufzustellen. Die Menschen sollen zusammen entscheiden, wie die Gesellschaft aussehen soll, wenn sie endlich die Möglichkeit dazu haben. Ich finde, Privateigentum an Produktionsmitteln – Boden, Immobilien, Ressourcen, Technologie – sollte überwunden werden. Denn Privateigentum ist eine Befehlsstruktur, die inhärent antidemokratisch ist.
Das klingt klassisch marxistisch.
Der Marxismus verlangt Verstaatlichung, und das fordere ich nicht. Mir geht es um eine Überführung in ein kollektives Eigentum. Ein Unternehmen gehörte so all jenen Menschen, die dort arbeiten. Besitz wäre an Arbeit gebunden, die Wohnung ans Wohnen. Die Belegschaft kann dann zusammen entscheiden, dass jemand, der eine schwierigere Arbeit leistet, mehr verdient. Es geht nicht um stupide Gleichheit, sondern dass alle über das mitbestimmen können, was sie betrifft. Das ist in Privateigentumsverhältnissen nicht möglich.
Man hat gesehen, wo das hinführt… es ist keine verlockende Perspektive.
Was ich skizziere, hat gar nie existiert. Hannah Arendt schreibt etwas polemisch: Der Staatssozialismus hat das Volk gerade noch mal enteignet. Denn ob ein Privateigentümer entscheidet oder der Staat, das ist beides gleich entmündigend.
Dennoch: Der Wettbewerb bringt tendenziell die besseren Lösungen hervor.
Ich schliesse Wettbewerb ja nicht aus. Zwischen den verschiedenen Unternehmen kann durchaus Wettbewerb herrschen. Was dieses Modell ausschliesst, sind exorbitante Bereicherungsmöglichkeiten für einzelne Menschen.
Zeigt denn nicht gerade der Rap, dass der Kapitalismus auch eine Ermächtigungsmaschinerie sein kann? Die ehemals vernachlässigten Schwarzen in den Ghettos stellen heute eine Leitkultur mit entsprechendem wirtschaftlichem Erfolg.
Das Problem ist, dass der Kapitalismus das Casting-Prinzip lange vor «Deutschland sucht den Superstar» eingeführt hat. Die Menschen leben also in Ghetto-Verhältnissen, die der Kapitalismus geschaffen hat, und wenden sich dem Sport oder der Musik zu, weil ihnen gar nichts anderes übrig bleibt. Dann werden einzelne von ihnen herausgepickt, weil sich mit ihnen Geld machen lässt. Klar ist das eine Chance für diese einzelnen, aber es ist ein zweischneidiges Schwert.
Wie sind Sie eigentlich zu Ihrer Haltung gekommen, was hat Sie auf diese Art politisiert?
Es waren mehrere Faktoren: Die Beschäftigung mit der Musik, meine Lehre in der Hallwag, die konkurs ging und wo die Leitung ohne Augenzwinkern hunderte Leute entlassen hat, die Arbeitslosigkeit meines Vaters. Und schliesslich: Ich bin in Bern aufgewachsen. Wer sich hier in der Jugendkultur bewegt, landet früher oder später in der Reithalle. Es wäre fast komisch, hier nicht links zu werden.
*****************
Zur Person
- geboren 1981 in Bern
- erste Bekanntheit ab 2003, als er als Tommy Vercetti am Ultimative Battle in Bern teilnimmt
- in der Folge Veröffentlichung diverser Mixtapes, u.a. mit Dezmond Dez. Mit ihm, Manillio und CBN Gründung der Formation Eldorado FM
- 2010 erscheint das Solo-Debütalbum «Seiltänzer», 2019 der Zweitling «No 3 Nächt bis morn».
- gelernter Grafiker, Studium der Visuellen Kommunikation
- arbeitet als Musiker, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule der Künste Bern und an seiner Dissertation zum Thema «Geldschein – Die visuelle Rhetorik des Geldes» tg