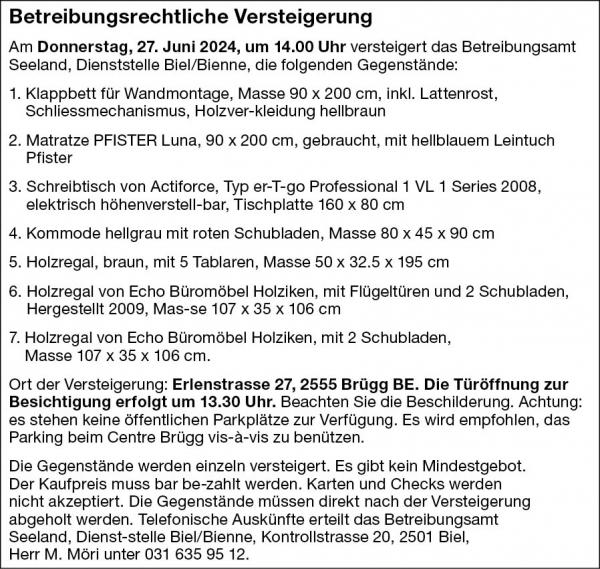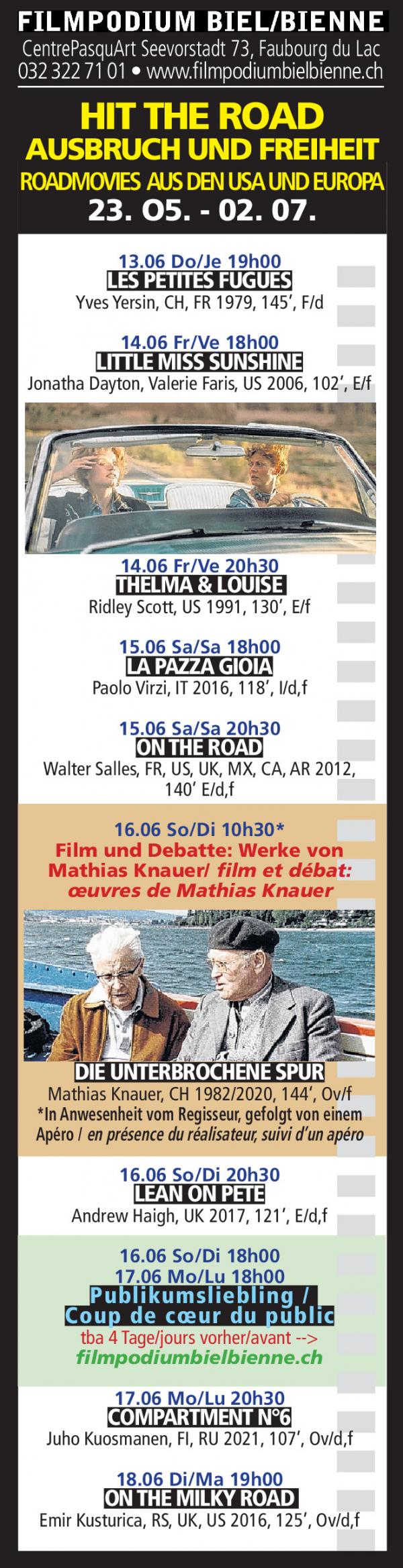von Fabian Schäfer
Die Wahl, die das Berner Volk am 18. Mai hat, ist eine echte Qual. Es stimmt über zwei Pensionskassenvorlagen ab, die sowieso zu einer Neuverschuldung des Kantons Bern in Milliardenhöhe führen und die dem Staatspersonal und der Lehrerschaft sowieso höhere Lohnabzüge bescheren. Die beiden Vorlagen – eine Hauptvorlage und ein Eventualantrag – weichen in zwei entscheidenden Punkten voneinander ab (siehe Infobox). Aber: In beiden Varianten tragen der Kanton und die anderen beteiligten Arbeitgeber wie die Insel und die Bedag den Hauptteil an die Sanierung der kantonalen Pensionskassen bei.
Zwei Differenzen |
Im Fall der Hauptvorlage ist ihr Anteil aber noch um etwa 360 Millionen Franken grösser. Diese Summe müsste das Personal zusätzlich aufbringen, wenn der Eventualantrag angenommen wird (alle Zahlen: Stand Ende 2013 – entscheidend wird sein, wie gross die Unterdeckung der Pensionskassen Ende 2014 ist).
Welche der beiden Vorlagen angenommen wird, ist gar nicht so entscheidend – Hauptsache ist, dass eine angenommen wird: Diese Botschaft überbrachte die Kantonsregierung gestern vor den Medien. Sie fürchtet nichts so sehr wie ein doppeltes Nein. Am liebsten wäre der Regierung, wenn die Hauptvorlage obsiegt, die sie als «gute Lösung» bezeichnet. Aber auch den Eventualantrag, der die Belastung für das Personal in Form von Lohnabzügen vergrössert, stuft die Regierung als «tragbar» ein.
Aus ihrer Sicht stellen beide Vorlagen Kompromisse dar: Sie trügen der schlechten Finanzlage des Kantons ebenso Rechnung wie den Bedürfnissen der Angestellten, deren Löhne in den letzten Jahren bei weitem nicht so stark gewachsen sind wie im Gehaltssystem vorgesehen.
Keine falschen Hoffnungen
Erziehungsdirektor Bernhard Pulver (Grüne) sagte, natürlich habe niemand Freude daran, dass die Staatsschulden mit diesen Vorlagen um 2 bis 3 Milliarden Franken anwachsen. «Aber die Pensionskassen müssen so oder so saniert werden – und der Kanton muss als Arbeitgeber so oder so seinen Beitrag dazu leisten.»
Auch Finanzdirektorin Beatrice Simon (BDP) betonte, die Schulden würden so oder so ansteigen, auch bei einem doppelten Nein. Pulver warnte auch das Staatspersonal vor falschen Hoffnungen: Die Pensionskasse BPK werde das Rentenalter auch nach einem doppelten Nein rasch von 63 auf 65 anheben müssen. Auch Sanierungsbeiträge seien sowieso unausweichlich.
Die Milliardenvorlagen im Überblick
Die beiden Pensionskassenvorlagen, die an die Urne kommen, weisen zwei gewichtige Unterschiede auf, sind ansonsten aber absolut identisch.
62 Artikel soll das neue Pensionskassengesetz des Kantons Bern umfassen. Nur in 2 Artikeln weichen die beiden Varianten, die am 18. Mai an die Urne kommen, voneinander ab – und auch dies nur bei zwei unscheinbaren Zahlen. Diese Zahlen entscheiden über mehrere Hundert Millionen Franken (siehe Infobox links). Im Grossen und Ganzen stimmen die Vorlagen aber überein. Eine Zusammenfassung: • Sanierung, Teil 1: Der Kanton geht gegenüber den Pensionskassen eine «Schuldanerkennung» ein und füllt denjenigen Teil der Unterdeckung auf, der auf die heutigen Rentner entfällt, die zur Sanierung nicht mehr herangezogen werden können. Er überweist das viele Geld aber nicht auf einen Schlag, sondern verzinst die Schuld und zahlt sie in Tranchen über vierzig Jahre ab. • Sanierung, Teil 2: Der Kanton, die andern Arbeitgeber (Inselspital, Bedag u. a.) und die Angestellten müssen die restliche Unterdeckung mit sogenannten Finanzierungsbeiträgen im Verlauf von zwanzig Jahren beheben. Diese Beiträge kommen zu den ordentlichen Pensionskassenbeiträgen (Lohnabzügen) hinzu. Im Unterschied zu diesen werden sie nicht den einzelnen Angestellten gutgeschrieben, sondern dienen zur Tilgung der Unterdeckung. • Sanierung, Teil 3: Die Pensionskasse BPK, die neben den Staatsangestellten auch das Personal von Insel und Bedag versichert, erhöht das ordentliche Rentenalter von 63 auf 65 Jahre. Die Angestellten müssen damit zwei Jahre länger arbeiten und Beiträge einzahlen, um etwa dies gleiche Rente zu erhalten wie bisher. Dadurch wird die Kasse stark entlastet, auch weil sie die Renten künftig weniger lang auszahlen muss, da die Zeit von der Pensionierung bis zum Tod tendenziell verkürzt wird.
In der Pensionskasse der Lehrpersonen BLVK gilt schon seit der Sanierung von 2005 Rentenalter 65. Dabei bleibt es auch. • Primatwechsel: Beide Pensionskassen wechseln vom Leistungs- ins Beitragsprimat. Damit entfallen die bisherigen Rentenversprechen, die den Kanton nun teuer zu stehen kommen. Bisher ist die Höhe der Renten im Voraus garantiert, in Prozent des letzten Lohns. Neu ist wie in den meisten Kassen entscheidend, wie viel Geld für die einzelnen Versicherten einbezahlt wurde, wie stark die Kassen das Geld an den Kapitalmärkten vermehrt haben und wie hoch der Umwandlungssatz ist, mit dem das Sparguthaben in eine Rente umgerechnet wird.
Der Primatwechsel ist nicht mit einem Leistungsabbau verknüpft. Der Kanton zahlt nicht weniger in die Pensionskassen ein als heute. Ob die Angestellten die bisherigen Renten erreichen, hängt aber stärker als heute davon ab, ob die Kassen die erwarteten Renditen erwirtschaften.
Damit insbesondere ältere Angestellte beim Wechsel ins neue System nicht schlechter gestellt werden, bezahlt der Kanton eine Übergangseinlage von rund 500 Millionen Franken, die den einzelnen Versicherten gutgeschrieben wird. • Staatsgarantie: Der Kanton soll wieder für beide Pensionskassen eine Staatsgarantie eingehen; zurzeit besteht diese nur für die BLVK, da sie bereits in einer Sanierung steckt.
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden oder Registrieren.