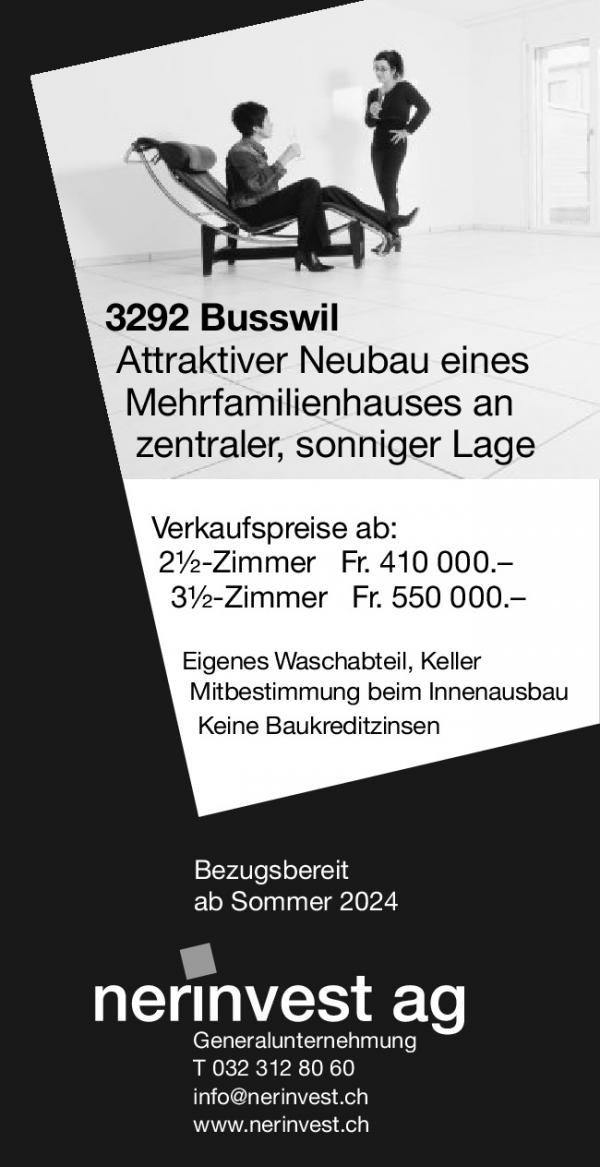Interview: Quentin Schlapbach und Simon Wälti
Christine Häsler, nach den Sommerferien gab es vermehrt Ansteckungen in den Schulen. Mit welchem Gefühl starten Sie nach den Herbstferien ins neue Quartal?
Christine Häsler: Ich habe ein gutes Gefühl, weil ich denke, dass die Schulen gut vorbereitet sind. Es ist klar, wie das Ausbruchstesten ablaufen wird. Und welche Massnahmen wann nötig sind. Es ist aber möglich, dass es wieder mehr Fälle gibt.
Sind Sie bei den getroffenen Massnahmen abhängig von der Gesundheitsdirektion, oder haben Sie ein Mitspracherecht?
Dies ist nicht anders als beim Bund. Die Fachpersonen sind wichtiger. Sie entscheiden, wie die Gesellschaft und die Schulen am besten vor dem Virus geschützt werden. Wir sind aber einbezogen und können uns einbringen, sodass ein möglichst guter Schulunterricht gewährleistet werden kann. Wir sind sehr froh, dass nach den Herbstferien viel weniger Klassen in Quarantäne geschickt werden müssen, weil mit dem Ausbruchstesten positive Personen schneller erkannt werden.
Sie halten es für richtig, dass man auf das Ausbruchstesten setzt und nicht zu Massentests zurückkehrt?
Das ist genau so eine Frage, bei der die Fachpersonen entscheiden müssen. Wir haben festgestellt, dass die Massentests bei den Schulen, die mitgemacht haben, für eine Beruhigung gesorgt haben. Gleichzeitig sagten die Fachleute, man wolle dort testen, wo es wirklich notwendig sei, und nicht breit und freiwillig. Mir leuchtet dieser Entscheid ein, der Wechsel war aber für alle schwierig.
Sie hätten die Massentests also gern weitergeführt?
Die Massentests trugen viel zur Beruhigung bei. Wenn diese aber nicht die notwendigen Daten liefern, dann muss man auch wagen, das zu ändern. Wir erreichen mehr, wenn wir wirklich dort testen, wo wir es brauchen. Und wenn dafür weniger Klassen in Quarantäne geschickt werden müssen.
Die Organisation Pädiatrie Schweiz empfiehlt, dass Massnahmen wie Massentests, Maskenobligatorien und Quarantäneverfügungen auf ein «unerlässliches Minimum» reduziert werden. Teilen Sie diese Haltung?
Absolut. Ich bin auch sehr froh um diese Aussage, weil wir im Kanton Bern schon seit einiger Zeit einiggehen und bewusst in diese Richtung gehen. Wir alle sind froh um jedes Schrittlein zurück zur Normalität. Ich war zum Beispiel froh, als wir die Maskenpflicht vor den Sommerferien aufheben konnten, das war wahnsinnig wichtig.
Es gibt auch die Eltern, die sich Sorgen machen. Da wird der Vorwurf laut, die Kinder würden «durchseucht». Was antworten Sie darauf?
Es gibt keine Strategie, die Kinder zu durchseuchen, weder in der Regierung noch in der Bildungsdirektion. Es ist einfach so, dass im Moment keine Impfung für Kinder unter zwölf Jahren zugelassen ist. Ich verstehe aber die Eltern, die sich Sorgen machen wegen ihrer Kinder. Es sind aber nicht alle dauernd aufgeregt, es gibt ganz viele, die ruhig bleiben und froh sind, dass Schulalltag trotzdem möglich ist.
Erhalten Sie viele Reaktionen von besorgten Eltern?
Es gibt immer wieder Post. Und zwar sowohl von Eltern, die viel weniger oder keine Massnahmen wollen, als auch von solchen, die viel mehr Schutz für ihre Kinder fordern.
Hält sich das bei den Zuschriften ungefähr die Waage?
Ja. Was aber ganz wichtig ist: Die ganz grosse Mehrheit schreibt und mailt nicht, ist aber sehr froh um das, was in der Krise geleistet wird.
Inwiefern waren die letzten Monate denn für Schülerinnen und Schüler belastend?
Die wirklich grosse Belastung waren die acht Wochen im Frühling 2020, als kein Präsenzunterricht stattfinden konnte. Es geht dabei nicht in erster Linie um Lerndefizite. In dieser Zeit kam es bei einigen Schülerinnen und Schülern zu psychosozialen Problemen. Das zeigte sich im unmittelbaren Austausch mit den Schulleitungen, den Erziehungsberatungsstellen und auch der Schulsozialarbeit.
Braucht es wegen der Pandemie mehr Angebote für Schülerinnen und Schüler mit psychischen Problemen?
Bei unseren Angeboten wie der Schulsozialarbeit und der Erziehungsberatung stellen wir eine verstärkte Nachfrage fest. Bei den Erziehungsberatungsstellen meldeten sich deutlich mehr Eltern oder Lehrpersonen, die nach Hilfe fragten, weil es einem Kind nicht mehr gut ging. Ich bin aber wahnsinnig froh, dass in der Schweiz, verglichen mit anderen Ländern, die Kinder fast durchgehend in die Schule gehen konnten. Deshalb haben wir jetzt kein grösseres Problem.
Der Unterricht konnte dennoch nicht überall wie gewohnt stattfinden – etwa bei Quarantänemassnahmen. Sind Lerndefizite erkennbar?
Eine endgültige Bilanz fehlt noch, aber es gibt bereits erste Erkenntnisse. Bei den Übertrittsquoten für die Sekundarschule oder das Gymnasium stellten wir bisher keine Unterschiede zu früheren Jahrgängen fest. Die Lehr- und Maturitätsabschlüsse waren dieses Jahr notenmässig sogar leicht überdurchschnittlich. Wir rechnen also insgesamt nicht damit, dass sich dieses Covid-Jahr negativ auf den Bildungsstand der Kinder und Jugendlichen ausgewirkt hat.
Könnte es auch sein, dass die Lehrpersonen die Schülerinnen und Schüler aufgrund der Umstände weniger streng bewerteten?
Es ist durchaus möglich, dass die Schulen da eine gewisse Rücksicht nahmen. Wir forderten ja auch, dass nur jene Lerninhalte geprüft werden, die wirklich auch vermittelt wurden.
Wie ist das Feedback der Lehrerinnen und Lehrer?
Wir sind in einem permanenten Austausch und in enger Zusammenarbeit. Wir besprechen und erarbeiten die Massnahmen etwa mit Bildung Bern und weiteren Organisationen. Die Lehrpersonen haben eine unglaubliche Arbeit geleistet. Zudem ist die Situation bei den Stellenbesetzungen nicht einfach.
Hat die Pandemie den Lehrberuf weniger attraktiv gemacht?
Das glaube ich nicht. Wir stellen im Gegenteil fest, dass wir rekordhohe Anmeldezahlen haben an der Pädagogischen Hochschule. Sehr viele junge Menschen wollen den Lehrberuf ergreifen. Das ist auch nötig, weil grosse Jahrgänge in die Schule kommen. Es braucht mehr Klassen, gleichzeitig gibt es viele Pensionierungen. Hier entsteht ein «Gap», den wir fast nicht auffangen können – trotz der erwähnten Rekordzahlen. Lehrerin oder Lehrer ist ein Beruf, der einem gegenwärtig besonders viel abverlangt, aber er bildet die Basis der Gesellschaft und ist ausserordentlich wertvoll.
Die Lehrpersonen sind auch gefährdet. Haben Sie zahlreiche Ausfälle, sei es durch Covid-19-Erkrankungen oder durch Quarantäne?
Wir merken, dass der Druck zugenommen hat. In einem Schulzimmer zusammen mit 20 bis 25 Kindern ist es sehr schwierig, sich mit Abstand, Hygiene und Lüften zu schützen. Darum war ich sehr froh, konnten wir den Lehrpersonen das priorisierte Impfen anbieten.
Bleiben wir beim Thema Impfen: Werden mobile Teams die Schulen besuchen, um Kinder ab 12 Jahren zu impfen?
Auf der Stufe Volksschule ist das nicht vorgesehen. Wir finden, das ist ein Alter, bei dem in erster Linie die Eltern zuständig sind und entscheiden sollen. Aber auf der Stufe Sek II kamen schon vor den Herbstferien bei Gymnasien und Berufsfachschulen Impftrucks vorbei. Das Angebot wird sehr gut genutzt. Jetzt nach den Herbstferien werden viele Gymnasiastinnen und Berufsschüler die zweite Impfung erhalten.
Man kann nicht in ein Restaurant ohne Zertifikat, aber man kann in einem Raum mit 25 Personen Schule geben ohne Zertifikat. War es nie ein Thema, eine Zertifikatspflicht einzuführen oder regelmässige Tests zu verlangen?
Letztlich geht es um das Recht auf Bildung und um das Recht, in die Schule gehen zu können. Das ist ganz wichtig, auch vor dem psychosozialen Hintergrund. Der Präsenzunterricht ist so zentral, den wollen wir unbedingt aufrechterhalten. Wenn aber jemand eine Vorerkrankung hat, so soll sich diese Person auch schützen können und geschützt werden.
Eine Baustelle, die Sie von Ihrem Vorgänger Bernhard Pulver übernommen haben, ist das viel kritisierte Französischlehrmittel «Mille feuilles». Wie geht es da nun weiter?
Die Gemeinden haben ab dem nächsten Schuljahr die Möglichkeit, ein alternatives Lehrmittel einzusetzen. Wir haben dies frühzeitig kommuniziert, damit sie genügend Zeit haben, sich zu entscheiden. Es ist für viele Gemeinden letztlich auch eine finanzielle Frage. Ich bin froh, dass es diese Wahlmöglichkeit nun gibt. Lange Zeit gab es schlicht keine Alternative zu «Mille feuilles» auf dem Markt – zumindest nicht für alle Schulstufen. Jetzt gibt es solche Lehrmittel, die auch den Praxistest bestanden haben. Ich hoffe, dass jene Gemeinden, die mit «Mille feuilles» bisher unglücklich waren, nun eine Lösung finden.
Glauben Sie, dass dieser Wechsel flächendeckend stattfinden wird?
Nein, das glaube ich nicht. Es wird sicher Wechsel geben, insbesondere bei jenen Gemeinden, von denen wir bereits entsprechende Rückmeldungen bekommen haben. Aber eine flächendeckende Abkehr vom bisherigen Lehrmittel kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben «Mille feuilles» in den letzten Jahren zusammen mit dem Schulverlag laufend verbessert.
Die unterschwellige Botschaft Ihres Entscheids lautet also nicht, dass «Mille feuilles» unbrauchbar ist?
Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben in den letzten Jahren viele Rückmeldungen von Lehrpersonen – aber auch von Schülerinnen und Schülern – erhalten, die dieses Lehrmittel schätzen gelernt haben. «Mille feuilles» hat ganz klar seine Stärken, die leider aber nicht in allen Gemeinden zum Tragen kamen.
Welche Spuren haben die letzten eineinhalb Jahre Pandemie bei Ihnen persönlich hinterlassen?
Die Belastung war teilweise extrem hoch, deutlich grösser als in normalen Zeiten. Ich spürte vor allem eine grosse Verantwortung – gegenüber den Schülerinnen und Schülern, den Lehrpersonen aber auch meinen Mitarbeitenden hier vor Ort. Ich will jedoch keineswegs klagen. Es war für ganz viele Menschen in diesem Land eine schwierige Zeit.
Erhielten Sie in dieser Zeit auch Drohungen?
Ja, das gibt es in einer Aufgabe wie der meinen leider hin und wieder.
War das auch schon vor Corona so?
Die Pandemie hat diese Stimmen sicher noch einmal verstärkt. Aber gemessen an der Bevölkerung des Kantons Bern mit über einer Million Einwohnerinnen und Einwohnern ist es eine ganz kleine Minderheit, die solche Drohbriefe schreibt. Ich bekomme aber auch viel konstruktive Kritik. In dieser Pandemie musste ich ein Stück weit aushalten, dass ich es nicht allen recht machen kann.
Wünschten Sie sich in dieser Zeit nie eine andere Direktion?
Nein, ich bin sehr froh, da wo ich bin.