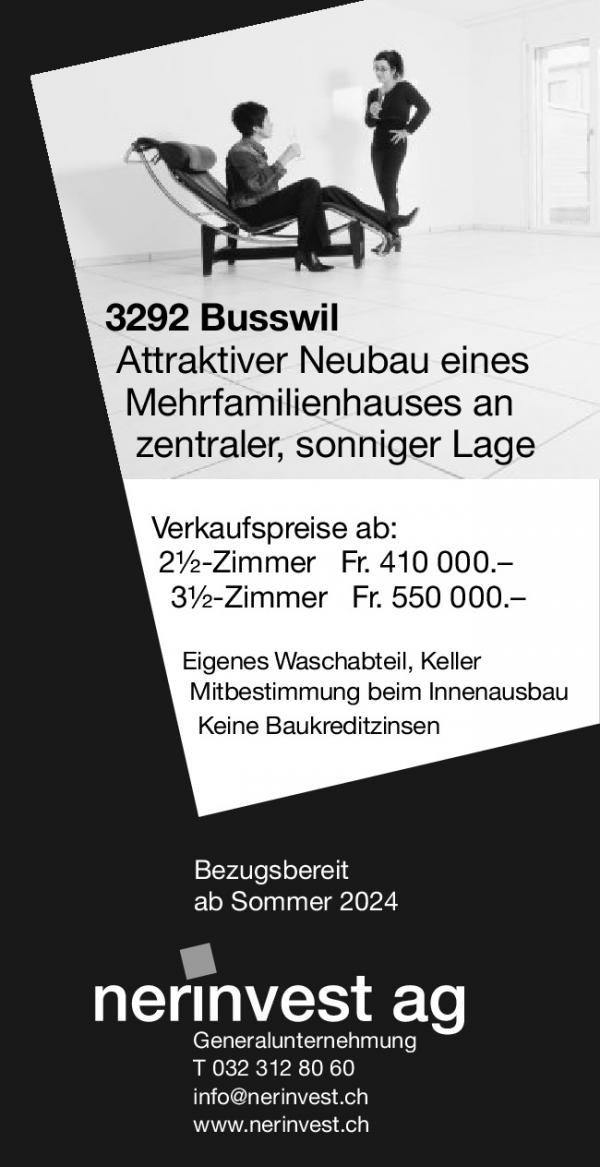Raphael Amstutz
Anruf in Bevagna in Umbrien. Der Schweizer Filmemacher Clemens Klopfenstein lebt seit bald 40 Jahren in Italien. Auf dem Bildschirm erscheint der gebürtige Seeländer mit einer Staubmaske auf dem Kopf.
Baupause. Klopfenstein renoviert gerade sein Haus. Dann legt er los. Dieses Feuer. Klopfenstein ist auch mit bald 77 ein Ausbund an Energie und Leidenschaft. Ein bunter Hund, eloquent und selbstironisch.
Ein gewisser Hans Erni
«Ich bin ausgewandert worden», sagt er. 1971 war es. Klopfenstein, Student an der Kunstgewerbeschule, lag mit hohem Fieber in einem Kleinbasler Arbeiterhäuschen, las bei halbem Bewusstsein das Buch «Das Manuskript von Saragossa» von Jan Potowski. «Ich träumte Wahnbilder davon, Wüsten, Gebirge, Ruinen», erinnert er sich, «und als ich wieder auf die Beine kam, musste ich diese Bilder sofort zeichnen.»
Seine Arbeiten gefielen. Jedenfalls gewann er das Eidgenössische Kunststipendium. «Da ich aber Ruinen gezeichnet hatte, kam ich in eine weitere Runde, in die ‹Rom-Runde› und da rief der Präsident der Eidgenössischen Kunstkommission: ‹Der muss nach Rom, der zeichnet Ruinen!›». Dieser Rufer war übrigens der grosse Künstler Hans Erni.
Klopfenstein kam ans Schweizer Institut in Rom, gedacht war ein Aufenthalt für ein Jahr. Es wurden fast drei Jahre. Unter anderem auch deshalb, weil er Fotoreportagen für Schweizer Journalisten realisierte.
«Ein schöner Schissdräck»
«Es war eine verrückte Zeit und ich wollte nicht zurück in die für mich damals langweilige Schweiz», so Klopfenstein. Also blieb er und weil Rom zu teuer war, landete er schliesslich in Umbrien.
Fast vier Jahrzehnte ist das her. Während der Coronakrise hat er Bevagna während eines Jahres kaum je verlassen. Das stört den Vielgereisten nicht. «Reisen kann ich wieder, wenn ich tot bin.»
«Ich wurde also zum Lernen ins Ausland verstossen und das stimmte auch auf einer anderen Schiene», erklärt Klopfenstein. Weil er die Architektur in Rom in Ruhe studieren wollte, was nur in der Nacht in der leeren Stadt möglich war, begann er, mit neuartigem Material zu fotografieren. «Daraus entwickelte sich die Idee, dies auf Film auszuprobieren, damit ich endlich so drehen konnte, wie ich es mir vorstellte: Ohne künstliches Licht, ohne Equipe», sagt Klopfenstein.
Sein Zugang kam an. Die Solothurner Filmtage waren begeistert, ebenso das ZDF. Und so übersprang Klopfenstein die Schweiz und ging, ausgerüstet mit einem weiteren Stipendium, nach Berlin. «Die Deutschen mochten mich, den lustigen, kleinen Schweiz-Italiener mit der südlichen Leichtsinnigkeit.»
Klopfenstein entwickelte seinen Stil weiter und wurde von Deutschland unterstützt. «Das zwang die Schweizer Instanzen sozusagen, auch mitzuziehen.» Speziell die Eidgenössische Filmkommission sei dann regelrecht umgekippt, «fand sie meine Nachtexperimente doch zuerst einen schönen ‹Schissdräck›».
Klopfenstein hat ein entspanntes Verhältnis zum einheimischen Filmschaffen. So verglich er den Schweizer Film einmal mit einem Joghurt. «Er ist weder Brot noch Käse oder Schinken. Er ist nebenher, nicht unangenehm. Er steht im Kühlschrank und manchmal vergisst man ihn. Er tut nicht weh und ist im Abgang sehr leicht verdaulich.»
Clemens Klopfenstein steht auch heute noch zu dieser Aussage. Was wäre denn zu ändern? Dem Schweizer Film fehle eine eigene Handschrift, ein Branding. Im Inland ginge das noch, aber im Ausland, da sollten die Schweizer Filme vielleicht als Pflicht mindestens fünf Minuten Eiger, Mönch und Jungfrau im Hintergrund zeigen, so Klopfen- stein. «Oder sich gleich auf ein grosses Schweizer Thema wie Heidi oder Wilhelm Tell beschränken.»
Filmemacher sei aber weiterhin eine Art Wunschjob. Oft sei es auch einfach eine Entwicklungsphase, die häufig nach leidvollen Erfahrungen vorbeigehe, sagt er.
Vieles sei denn doch zu mühsam, zu unsicher. «Doch mehr als bankrott kann man ja nicht gehen.» Da blitzt er wieder auf, dieser Klopfensteinsche mit Pragmatismus grundierte Witz.
Und so plädiert er auch weiter für «Hüftschüsse». Will heissen: Eine gute Idee, ein schlankes Team, wenig Technik. Schnell drehen, direkt, ehrlich, einfach mal loslegen.
So verwundert es nicht, dass Klopfenstein mit Tiktok ein neues Betätigungsfeld gefunden hat. Er nennt es das neue Experimentieren, ohne Bürokratie und ohne Administration.
Der 77-Jährige und Tik-tok
Die Arbeit geht dem 77-Jährigen nicht aus: Der in den 70er-Jahren gedrehte Film «La Luce Romana vista da Ferraniacolor» hat er jetzt fertiggestellt und möchte ihn bald mal zeigen – notabene als Uraufführung. In Produktion ist «Die Glocken von Santa Chiara», «ein Preludium im Tiktok-Stil als Vorfilm zum neuen Langspielfilm ‹Das Ächzen der Asche›, den ich gemeinsam mit meinem Sohn Lukas Tiberio realisieren werde.» Der sei zunächst auch ausgewandert nach Kanada und jetzt arbeite er, im Homeoffice in Bevagna, für Filme auf kalifornischen Plattformen. «Das Wandern wird kompliziert.»
Daneben malt Klopfenstein unermüdlich weiter und bereitet das fünfte Fresko über Franz von Assisi in Torre del Colle vor, stellt, gemeinsam mit seinen beiden Söhnen, Retrospektiven für verschiedene Plattformen zusammen und holt jeden Morgen seine «Frankfurter Allgemeine Zeitung» am Kiosk.
Vermisst er denn überhaupt etwas in Italien? Klopfenstein lacht: «Kartoffelstock und ‹Chügeli›.» Kalbsbrät, das gebe es in Umbrien nicht.
Info: Dieser Text wurde mithilfe der Gottlieb und Hans Vogt-Stiftung realisiert.