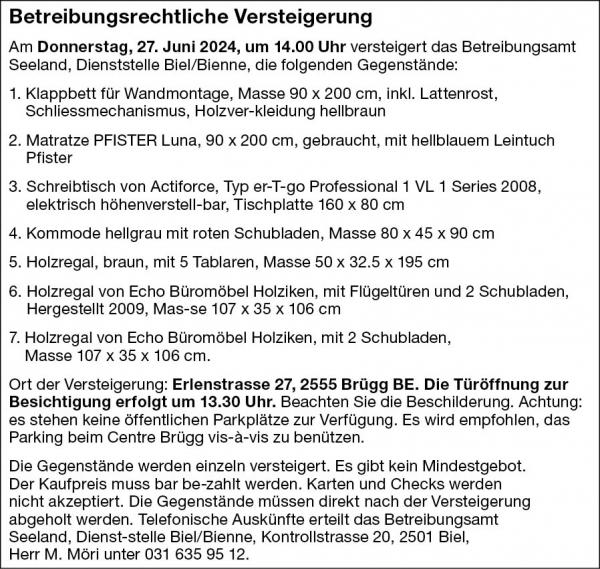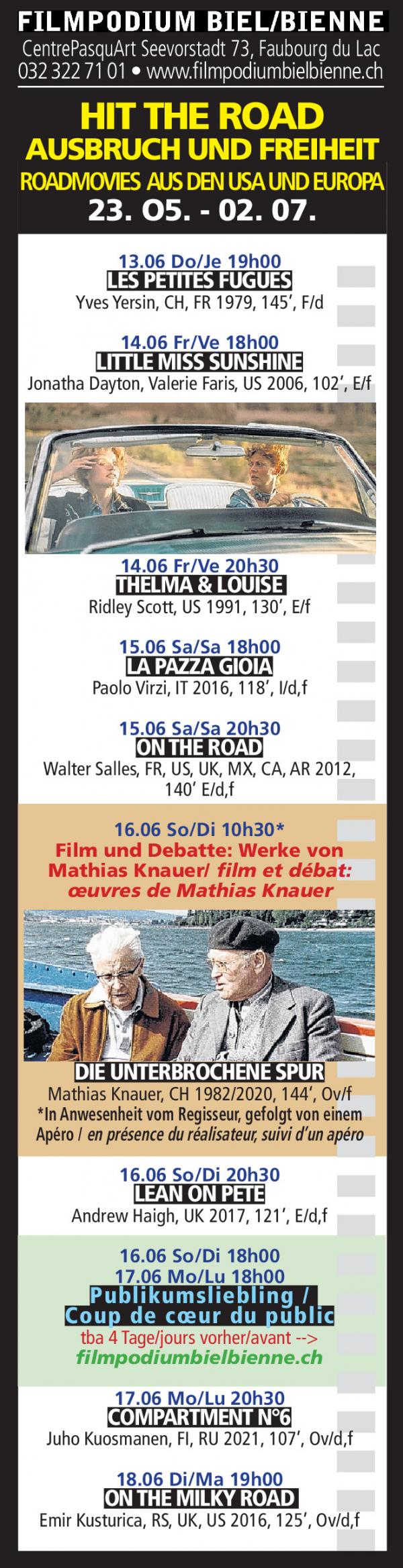Rita Flubacher
Kaum ein Apparat ist derzeit mehr gefragt als das Beatmungsgerät, an das am Coronavirus schwer erkrankte Patienten in den Spitälern angeschlossen werden. Bei den Chefs der vier grössten Herstellerfirmen läuft das Telefon heiss.
Stefan Dräger, der den deutschen Medizinaltechnikhersteller Dräger leitet, gab in deutschen Medien freimütig Auskunft, wen er in den vergangenen Tagen so alles am Hörer hatte: den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz, König Willem-Alexander der Niederlande und «unzählige Minister aus allen möglichen Ländern». Und natürlich die deutsche Regierung, die von ihm verlangte, bis zum Jahresende 10000 zusätzliche Beatmungsgeräte zu produzieren. Noch im Herbst wollte Dräger wegen Flaute im Geschäft Arbeitsstellen streichen.
Der Schweizer Konkurrent Hamilton Medical mit Standorten in Bonaduz und Domat/Ems in Graubünden gibt sich weitaus diskreter. Man wolle nicht mit der Öffentlichkeit über Kundenanfragen reden, teilt Firmenchef Jens Hallek mit. «Aber es ist klar: Viele Regierungen suchen auf dem Weltmarkt nach Beatmungsgeräten», fügt er an.
Auch Hallek hatte von der Schweizer Regierung einen Anruf erhalten: Der Bund hat 900 Beatmungsgeräte gekauft. Die ersten 50 Geräte sind vor zwei Wochen ausgeliefert worden, ein Teil davon wurde per Helikopter ins Tessin geflogen. Diese Woche gehen 300 weitere Geräte an den Bund über.
Hamilton Medicalsucht Arbeitskräfte
Für die Branche, die bis jetzt ein Nischendasein führte, ist das eine gewaltige Herausforderung. Normalerweise werden bei Hamilton wöchentlich 220 Maschinen hergestellt. Mittlerweile ist die Kapazität um 50 Prozent erhöht worden. Bis Ende April soll die Produktion verdoppelt werden. Hamilton beschäftigt 500 Personen. Nun würden neue Mitarbeiter eingestellt, erklärt Hallek.
Der schwedische Hersteller Getinge, der bis jetzt ein Viertel der weltweiten Nachfrage an Beatmungsgeräten abdeckte, will in diesem Jahr 16000 Apparate auf den Markt bringen, 60 Prozent mehr als im Vorjahr.
Der vierte Hersteller schliesslich befindet sich ausgerechnet in dem vom Coronavirus besonders schlimm betroffenen Italien. Die Firma Siare stellte bislang monatlich rund 160 Geräte her. Nun soll der Ausstoss verdreifacht werden – mit Unterstützung der italienischen Armee. Im letzten Jahr habe die Branche Kapazitäten zur weltweiten Produktion von 40000 Geräten gehabt, erklärte ein Vertreter der Firma Getinge. Jetzt orderte allein die deutsche Regierung 10000 Geräte, der Gouverneur von New York verlangt von der US-Regierung allein für seinen Bundesstaat 30000 Geräte.
In der Branche zerbricht man sich den Kopf, was die enormen Kapazitätsausweitungen für den Materialnachschub bedeuten. «Es ist voraussehbar, dass es zu Engpässen kommen wird», befürchtet Jens Hallek von Hamilton. Die Beatmungsgeräte sind Hightech-Maschinen, gegen 1500 Teile werden benötigt. Laut Branchenvertretern stammt das Material von rund 100 Zulieferern weltweit.
Das hat Folgen: Laut Stefan Dräger kann die Produktion gerade deswegen nur begrenzt hochgefahren werden. Er erhalte derzeit viele Angebote zur Unterstützung der Lieferkette. Aber, so dreht es der Chef in ungewohntem Bild: «Sie können kein Baby in einem Monat bekommen, indem Sie neun Frauen schwängern. Das ist eine Mission Impossible», erklärte er in der «Financial Times». Zugleich warnte er: «Diese Lieferketten dürfen unter keinen Umständen unterbrochen werden. Sollte das passieren, hat die ganze Welt ein Problem.»
Nun drängen Branchenfremde ins Geschäft. Da ist das italienische Start-up Isinnova, das im 3-D-Druck zuhause ist und soeben eine im Sporthandel gängige Tauchermaske in eine Notfallmaske für Beatmungsgeräte umgewandelt hat. Den Tipp dazu gab ein Arzt. An renommierten US-Universitäten haben Studierende, Forscher und Ärzte andere Billigvarianten von Beatmungsgeräten entworfen. Physiker der Philipps-Universität Marburg etwa haben ein längst bekanntes Gerät zur Behandlung von Schlafapnoe, des kurzzeitigen Atemstillstands während des Schlafs, ausgebaut.
Von anderem Kaliber sind die Bemühungen von General Motors, mit einem US-Medizinalgerätehersteller ins Geschäft für Beatmungsgeräte einzusteigen. Auch europäische Autokonzerne wie VW, deren Produktion weitgehend stillgelegt sind, wollen ihre 3-D-Drucker für die Herstellung von Bestandteilen und komplexen Formen umnutzen. Der britische Staubsaugerhersteller Dyson hat laut eigenen Angaben innerhalb von zehn Tagen mit einem auf medizinische Fragen spezialisierten Beratungsunternehmen eine Beatmungsmaschine von Grund auf entworfen. Nun sollen 10000 Stück davon produziert werden.
Experten sind skeptisch. Die Medizinalgeräteherstellung ist stark reguliert, jeder Produktionsschritt muss dokumentiert und anschliessend zertifiziert werden, jedes fertige Gerät muss getestet werden. Denn: Hat ein Gerät plötzlich eine Macke, könnte das den Tod des Patienten bedeuten.
Lieferketten sind nicht vorhanden
Und Autokonzerne, die in die Produktion einsteigen wollen, müssen sich erst eine neue Lieferkette aufbauen. Mit Zulieferern wiederum, die möglicherweise ebenfalls erst Kapazitäten aufbauen müssten, und die in Ländern mit Exportkontrollen stehen und wo möglicherweise die Belegschaft wegen der Pandemie zuhause bleiben muss. Das alles kostet sehr viel Zeit.
Die letzte Hürde schliesslich: Beim 3-D-Druck von Komponenten bei VW oder wo immer müssten die Medizinaltechnikunternehmen ihre Daten freigeben. Und da gibt es offenkundig hohe Hemmschwellen. Schliesslich will kein Unternehmen potenzielle Konkurrenten mit Wissen versorgen. Jens Hallek von Hamilton macht klar: «Die Produktion unserer Geräte an Dritte auszulagern, ist vorerst kein Thema.»