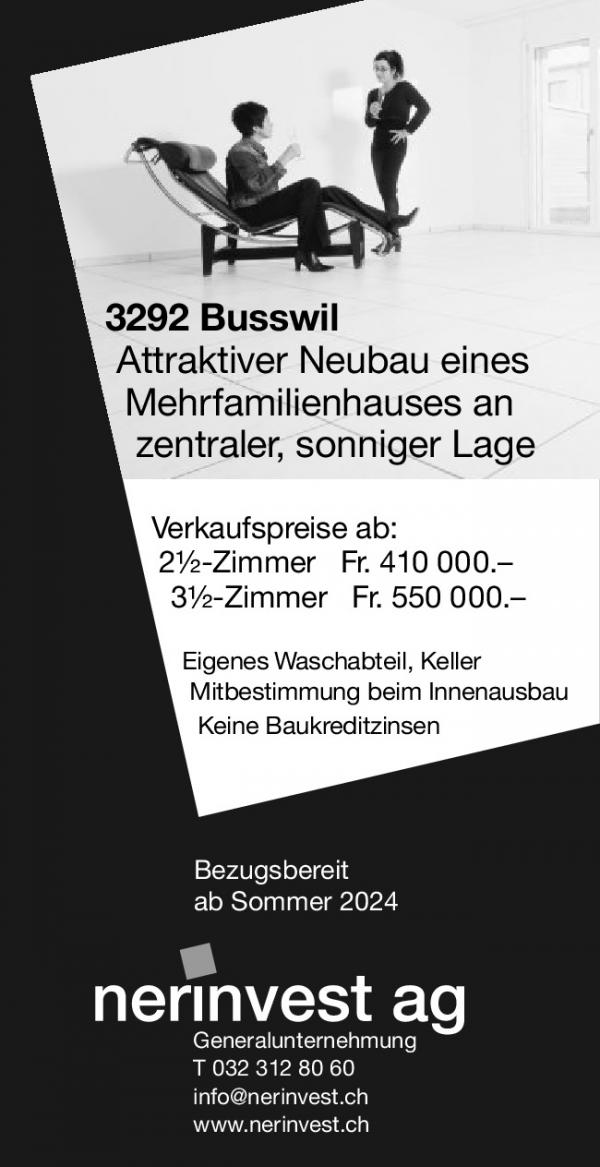Interview: Parzival Meister
Corrado Pardini, wären Sie gerne ein Franzose?
Corrado Pardini: Ob ich gerne ein Franzose wäre? (Lacht) Ich definiere mich nicht über eine Nationalität.
Nun, als Gewerkschaftsführer in der Schweiz halten Sie nächste Woche an der 1. Mai-Feier in Biel vor wahrscheinlich rund 300 Anwesenden Ihre Kampfrede. Dem Ruf Ihrer Kollegen in Frankreich folgen derzeit Tausende. Sind Sie neidisch?
Ich bin in erster Linie froh, dass wir nicht dieselben Zustände wie in Frankreich haben. Denn diese Mobilisierung hat mit einem massiven Abbau zu tun, den die Regierung durchsetzen will. Zudem bedeutet eine solche Mobilisierung einen riesigen Aufwand. Dafür beneide ich meine Kollegen nicht, aber ich habe einen grossen Respekt davor.
Uns geht es demnach also zu gut, als dass wir kämpfen müssten. Aber ist es nicht so, dass bei uns diesbezüglich eine andere Kultur herrscht?
Wie Sie richtig sagen, haben wir eine andere Kultur und Geschichte. Wir führen unsere Verhandlungen in der Regel am grünen Tisch. Wir versuchen, unsere Sozialpartnerschaften anders zu leben als im Ausland. Wir sind zum Beispiel weniger konfrontativ als die Franzosen.
Das könnte man auch als Zeichen von Schwäche auslegen.
Nein, auch wir können auf die Strasse gehen. Die grösste Mobilisierung, die ich organisieren musste, fand in den Jahren 2001 und 2002 statt. Wir gingen mit zehntausenden Bauarbeitern auf die Strasse und haben es geschafft, für sie das Rentenalter 60 durchzusetzen. Auch im Seeland haben über 1500 Bauarbeiter gestreikt. Ich weiss, welche Arbeit hinter einem solchen Kampf steckt. Deshalb nochmals: Ich beneide meine Kollegen in Frankreich nicht.
Ist der gut schweizerische Kompromiss die bessere Gangart?
Wenn beide Seiten die Bereitschaft dafür zeigen, ist es sicher der einfachere Weg. Aber auch bei uns spüre ich eine Verhärtung. Die Angriffe auf das Arbeitsgesetz haben in den letzten Jahren zugenommen. Ich hoffe schwer, dass die Arbeitgeber zur alten Kultur des Diskurses zurückfinden werden.
Und wenn nicht: Haben die Gewerkschaften in der Schweiz genügend Biss, sich auch abseits des Verhandlungstischs zu wehren?
Wir sind bereit, auch diese Auseinandersetzung zu führen. Zuletzt war dies vor ein paar Monaten beim ABB-Werk in Séchron der Fall. Wir sind mit den Arbeitern in den Streik getreten, weil die Gegenseite diktieren wollte und kein Diskurs stattfand. Der Streik ermöglichte die Rückkehr an den Verhandlungstisch.
Gibt es je nach Landesteil Unterschiede in der Streik-Bereitschaft der Arbeitnehmer?
Die Romandie und das Tessin sind schon bewegungsorientierter als die Deutschschweiz. Aber generell für das ganze Land kann gesagt werden: Wir haben seit 1937 eine Kultur, die den Kompromiss eher am Tisch als auf der Strasse sucht.
Sie sprechen damit das Friedensabkommen von 1937 an. Gewerkschaften und Arbeitgeber haben sich auf das Prinzip des Arbeitsfriedens geeinigt. Dem vorausgegangen ist aber 1918 der erste und bisher einzige Landesstreik in der Schweiz.
Der Landesstreik und dutzende andere Streiks auch. In dieser Zeit hat das Volk gesehen, dass Streiks eine soziale Verbesserung mit sich bringen können. Der Landesstreik vor 100 Jahren war aber schon eine soziale Zäsur für die Schweiz. Ich bin froh, dass wir dieses Jubiläum feiern und die Erinnerungen an dieses wichtige Ereignis der Geschichte auffrischen können.
War der Landesstreik die Basis für alles, was man bis 1937 erreicht hatte?
Nicht nur bis 1937. Auch das Frauenstimmrecht war zum Beispiel eine Forderung der Streikenden.
Der Streik hallte also bis 1971 nach?
Vieles, was wir erst spät erreicht haben, sind Forderungen von damals. Für manches brauchte es einfach mehrere Anläufe. Die Ereignisse von 1918 führten zu einem enormen politischen Umdenken und zu grossen sozialen Errungenschaften; es gibt kaum Vergleichbares in unserer Geschichte.
Es war also ein Streik, der dazu geführt hat, dass in der Schweiz mehr diskutiert als gestreikt wird?
Der Landesstreik gehört zur Identität der Gewerkschaften. Beim Friedensabkommen von 1937 spielten aber noch andere Komponenten mit. In Deutschland waren die Nazis am Ruder, der Faschismus breitete sich in Europa aus. Mit dem Zweiten Weltkrieg vor der Tür hatte man sich in der Schweiz auf einen Burgfrieden geeinigt. Auch bei einer positiven Betrachtung des Friedensabkommens muss ich aber sagen, dass es zu einer Erlahmung der Gewerkschaften geführt hat.
Also ist eine fehlende Streikbereitschaft doch ein Zeichen für zu wenig Biss.
Nein, diese Lähmung konnten wir ablegen. In den 80er- und 90er-Jahren fand ein Wandel statt. Wir waren nicht mehr einfach nur Bittsteller, wir führten wieder Verhandlungen auf Augenhöhe. Und dieser Wandel war wichtig für den sozialen Fortschritt im Land. Die Partnerschaft zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern wurden auf einen neuen Sockel gestellt.
Und was zeigen die Tendenzen? Bleiben Sie auf Augenhöhe?
In den 90er-Jahren gab es einen massiven Angriff des Gewerbeverbandes, der die Gesamtarbeitsverträge (GAV) abschaffen wollte. Das konnten wir erfolgreich verhindern. Dann kam die Öffnung gegenüber Europa und mit ihr die flankierenden Massnahmen, was wiederum zu einer Stärkung der Gesamtarbeitsverträge geführt hat. Heute arbeiten 50 Prozent der Arbeitnehmer in der Schweiz unter dem Schutz eines GAVs, was eine deutliche Zunahme bedeutet.
Als es vor 100 Jahren zu einem Generalstreik kam, lag die Wochenarbeitszeit bei 59 Stunden. Das Geld bei den Arbeitern war knapp. Geht es uns im Vergleich zu damals nicht ziemlich gut?
Wir haben in der Schweiz laut Bundesamt für Statistik rund 150 000 Erwerbstätige, die von Armut betroffen sind. Die Zunahme der Working-Poor ist ein echtes Problem. Es darf nicht sein, dass jemand voll arbeitet und trotzdem Sozialhilfe beziehen muss. Wir haben explodierende Kosten bei den Mieten und den Krankenkassen. Das treibt viele Menschen an ihre finanziellen Grenzen. Dazu kommen ältere Menschen, die trotz Rente von der Sozialhilfe abhängig sind. Eine Schande für die Schweiz.
Blickt man auf die breite Masse, geht es uns aber einigermassen gut. Und es ist nicht vorstellbar, dass sich die soziale Unzufriedenheit erneut in einem Landesstreik entlädt.
Klar, wir haben einen viel höheren Lebensstandard als in den Zeiten vor dem Zweiten Weltkrieg. Die Gewerkschaften haben mit harter Arbeit erreicht, dass wir viele Verbesserungen für die Arbeiterschaft durchsetzen konnten. Das ist nicht selbstverständlich, wenn wir auf unsere Nachbarländer blicken. Doch selbst bei uns ist alles eine Frage der Perspektive: Der Einzelne, der mit seinem Lohn nicht durchkommt, für den fühlt es sich an wie für die Leute in vergangenen Zeiten. Wir müssen unsere Werte laufend verteidigen. Es gibt genügend Manager, die sich alles krallen, was sie können und den Rachen nie voll bekommen.
Und trotzdem laufen wir doch nicht Gefahr, dass sich die Situation dermassen verschlechtert, dass es zu Aufständen wie vor 100 Jahren kommt.
Das ist immer eine Frage der politischen Verhältnisse. Es braucht starke Gewerkschaften als Gegengewicht zum Kapital. Denn das Kapital reguliert sich nicht selbst, wenn man ihm freie Bahn lässt.
Am 1. Mai dreht sich alles um Lohngleichheit. Wieso hat man sich entschieden, dieses Jahr die Lohngleichheit ins Zentrum zu rücken?
Weil die Frauen zu Recht sagen, dass sie die Nase voll haben. Wir versuchen seit Jahrzehnten, die Wirtschaft auf freiwilliger Basis dazu zu bewegen, für Lohngleichheit zu sorgen. Aber bei diesem Thema funktioniert die Selbstregulierung nicht. Es braucht endlich Taten!
Im Februar wies der Ständerat eine Vorlage zurück, die Unternehmer zu einer Lohnanalyse verpflichtet hätte. Gab dieser Entscheid den Ausschlag?
Auch, ja. Das war ein Affront gegenüber allen Frauen und aufgeschlossenen Männern. Solche Analysen sind nötig. Aber der Entscheid der Bürgerlichen hat gezeigt, dass sie gar nicht hinschauen wollen, weil sie genau wissen, dass eine krasse Ungleichheit herrscht. Das müssen wir ändern. Ich bin froh, am 1. Mai auch als Mann meinen Teil beizutragen. Wenn wir bei diesem Thema nicht weiterkommen, müssen wir zur Durchsetzung des Rechts wohl eine Initiative lancieren.
Mit welchem Inhalt?
Die Unternehmen sollen verpflichtet werden, ihre Löhne zu analysieren und wenn nötig zu handeln.
Und mit welcher Konsequenz, wenn sie es nicht tun?
Es muss wehtun. Frauen und Männer müssen beide gerecht für ihre Arbeit entlöhnt werden. Eine Nichteinhaltung sollte von Amtes wegen verfolgt werden. Die Lohngleichheit zwischen Mann und Frau ist ein verfassungsmässiges Recht und muss vom Staat garantiert werden. Die Wirtschaft wird dies nie aus freien Stücken tun.
Widmen wir uns einem erfreulicheren Thema. Letzte Woche ist der Euro erstmals seit der Aufhebung des Mindestkurses wieder auf über 1.20 Franken gestiegen. Was ging in Ihnen vor, als Sie diese Meldung hörten?
Es hat mich extrem gefreut. Als Verantwortlicher für die Industrie habe ich zig Anläufe gemacht, zig Gespräche mit Herrn Jordan (Thomas Jordan, Präsident der Schweizerischen Nationalbank, die Red.) geführt und nicht aufgehört, für diese Untergrenzen zu kämpfen. Mittlerweile haben alle eingesehen, dass die Aufhebung der Untergrenze ein Fehler war.
Im BT-Interview hat Bundesrat Johann Schneider-Ammann zwar bestätigt, dass der Wegfall des Mindestkurses die Industrie vor Probleme gestellt habe. Doch den Unternehmen sei es gelungen, ihr Profil zu stärken und dass sie erstarkt aus der Krise hervorgegangen seien.
Das ist nur Geschwätz. Ich habe viele Kontakte in die Unternehmen, ich habe mit Geschäftsleitern zu tun, die eigenes Kapital in ihrer Firma haben und über Nacht ihre Marge um 10 bis 20 Prozent schwindet. Ich rede hier von völlig gesunden Unternehmen, von vielen KMUs, für die eine solche Aussage ein Affront ist.
Aber jetzt ist alles gut, oder?
Im Moment ja, aber wir müssen auch nach vorne schauen. Ich sehe zwei Probleme auf uns zukommen. Irgendwann wird Herr Jordan den Negativzins aufheben müssen. Und fallen die Negativzinsen weg, laufen wir Gefahr, dass der Franken wieder im Wert aufgeblasen wird. Der zweite Punkt betrifft die europäische Politik: Wenn sich das politische System in den wichtigen Ländern wie Deutschland, Frankreich und Italien nicht nachhaltig stabilisiert, wird der Franken wieder zum Spekulationsobjekt und als Fluchthafen für unsichere Anleger dienen.
Die Unia ist in den Sektoren Industrie, Gewerbe, Bau und privater Dienstleistungsbereich tätig. In welcher Branche lebt es sich als Arbeitnehmer am besten?
Ich glaube in der Industrie. Hier herrschen gute Arbeitsbedingungen – die Uhrenindustrie ist ein gutes Beispiel dafür. Der GAV in der Uhrenindustrie gehört zu den besten in der Schweiz.
Bei der Frage nach den schlechtesten Konditionen dürften Sie den privaten Dienstleistungsbereich nennen. Korrekt?
Ja, dort herrscht ein riesiger Nachholbedarf. Betroffen ist zum einen der Verkauf: Zu lange Arbeitszeiten bei zu tiefem Lohn. Kämpfen müssen wir aber auch für Temporäre in allen Branchen. Dieser Bereich geht oft vergessen. Die Temporärarbeit nimmt sprunghaft zu. Es ist eine negative Entwicklung, wenn die Menschen nur noch befristet angestellt werden.
Sie bezeichnen die Industrie als guten Sektor für Arbeitnehmer. Aber droht nicht gerade in diesem Bereich durch die fortschreitende Digitalisierung der Wegfall von Arbeitsplätzen?
Nein. In der Industrie kennt man solche technischen Fortschritte und Automatisierungen schon lange. Klar wird es nochmals einen Schub geben. Aber um die Industrie mache ich mir am wenigsten Sorgen. Das Auffangbecken für Arbeitsplätze, die in der Industrie verloren gingen, war immer der Dienstleistungsbereich. Und diesen Bereich wird es wohl durch die Digitalisierung am härtesten treffen.
Sind Self-Scanning-Kassen ein Beispiel für diese Entwicklung?
Die sind ein gutes Beispiel dafür. Aber auch im kaufmännischen Bereich wird sich viel verändern. Es wird Spracherkennungssysteme geben, die einen Brief ausspucken, ohne dass ihn jemand tippen muss. Übersetzer werden betroffen sein. In der Buchhaltung wird es weniger Leute brauchen. Da kommt einiges auf uns zu.
Was ist zu tun?
Wir müssen unser Bildungssystem reformieren. Heute absolviert man eine Berufslehre im Alter zwischen 16 und 25 Jahren. Künftig muss man vielleicht drei Berufslehren absolvieren – auch in höherem Alter. Aber 40-Jährige können heute nicht einfach nochmals eine Lehre beginnen. Sie haben Familie, finanzielle Verpflichtungen. Wir müssen diesen Menschen eine solide Ausbildung ohne finanzielle Einbussen ermöglichen.
Stichwort Bildung: Sind Weiterbildungen auch Ihre Antwort auf das Problem, wie man über 50-Jährige im Arbeitsmarkt halten kann?
Aus- und Weiterbildungen sind das A und O. Aber wenn wir über die Ü-50er reden, ist etwas anderes entscheidend: Früher gab es ein Tabu. Kein Unternehmer hat einen Angestellten in diesem Alter, der über 20 Jahre dem Betrieb die Treue gehalten hat, auf die Strasse gestellt.
Und dieses Tabu ist heute kein Tabu mehr?
Nein! Und das muss sich ändern. Die Gesellschaft muss sagen, dass ein solches Verhalten unanständig und inakzeptabel ist. Der Arbeitgeber muss spüren, dass dies von der Gesellschaft nicht toleriert wird.
Vermissen Sie in den Betrieben die Patrons alter Schule?
Ich will nicht in Nostalgie schwelgen, aber der klassische Unternehmer, der durch den Betrieb schreitet und einen Bezug zu den Mitarbeitern hat, verschwindet tatsächlich mehr und mehr. Heute kommen die Manager frisch ab Presse, übernehmen den Betrieb und haben die Zahlen, nicht die Menschen im Kopf.
Seit rund zehn Jahren hat die Basler Chemie- und Pharmaindustrie in ihrem GAV eine Kündigungsfrist von sechs statt drei Monaten für Angestellte ab 45 Jahren festgeschrieben.
Genau. Und das ist eine der besten Lösungen, die ich in der Privatwirtschaft kenne. Ü-50er brauchen diesen gesetzlichen Schutz. Drei Monate sind einfach zu wenig. Auf Gesetzesebene muss sich zudem die Bezugsdauer für das Arbeitslosengeld für diese Menschen erhöhen.
Sie selbst sind jetzt auch ein Ü-50er. Beruflich und politisch läuft es aber ziemlich gut für Sie. Welche Ambitionen haben Sie für die nächsten Jahre?
Als Nationalrat der Gesellschaft zu dienen, ist ein sehr grosses Privileg. Die Erfüllung des Auftrags meiner Wählerschaft ist meine Ambition.
Anders gesagt: Wenn Sie politisch weiter aufsteigen wollten, würde dies ein Exekutivamt bedeuten und Sie müssten den Gewerkschaftssekretär an den Nagel hängen. Ist das eine Option?
Für viele Amtskollegen ist der Bundesrat das Ziel. Ich bin für mein Leben gerne Gewerkschaftssekretär. Ich bin in die Politik gegangen, weil es wichtig ist, dass die Arbeitnehmer in den Parlamenten eine Stimme haben. Ich bin ein sehr erfüllter Mensch. Diese Erfüllung kommt auch daher, dass ich mich beruflich und politisch für mehr Gerechtigkeit und für Menschen einsetzen kann. Gewerkschafter zu sein ist und bleibt für mich der schönste Beruf der Welt.
***************************
Zur Person
- Corrado Pardini, 52-jährig, lebt mit Ehefrau, Tochter (20) und Sohn (24) in Lyss
- Berufliche Laufbahn: 1981 Lehre zum Maschinenschlosser, 1987 Eintritt in Gewerkschaft Bau und Industrie als Sekretär, nach der Fusion von SMUV und VHTL Regionalsekretär der neuen Grossgewerkschaft Unia, seit 2008 in der Unia-Geschäftsleitung verantwortlich für den Sektor Industrie
- Politik: Mitglied der SP, von 2002 bis 2011 im bernischen Grossen Rat, seit 2011 im Nationalrat und Mitglied der Kommission für Wirtschaft und Abgaben und der Rechtskommission pam