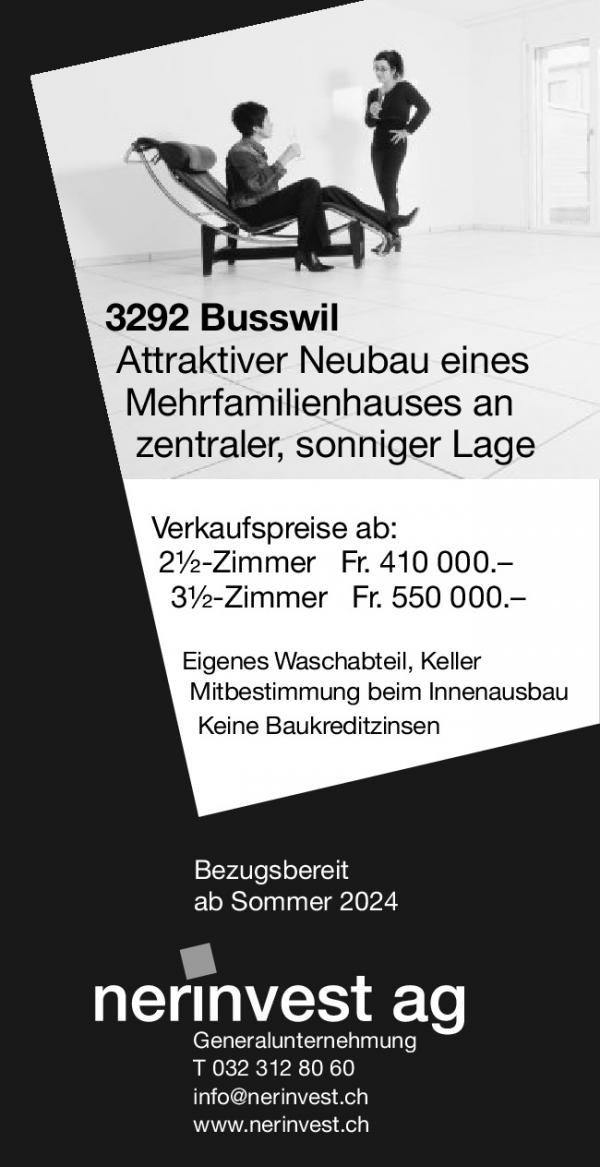- Dossier
Der Bitcoin-Kursverlauf entlarvt auf einen Blick, um was es geht: reine Spekulation mit beträchtlichen Risiken und riesigen Verlusten – also nichts für Normalsparer, sondern etwas für abgebrühte Zocker. Mitte Dezember 2017 war ein Bitcoin noch fast 20 000 Schweizer Franken wert. Anfang Mai 2018 sind es noch rund 9000 Franken. Wer also vor einem knappen halben Jahr auf Kryptogeld gesetzt hat, hat mehr als die Hälfte seines Einsatzes verloren. Derartige Verluste sind garantiert keine Werbung für eine elektronische Währung, die US-Dollar, Euro oder Schweizer Franken den Kampf angesagt hat. Stabilität, Sicherheit und Berechenbarkeit sehen anders aus als die Kursentwicklung des Bitcoins.
Bargeld gibts noch lange
Richtig ist, dass die Digitalisierung die Art und Weise völlig verändern wird, wie bezahlt, Geld transferiert und aufbewahrt werden wird. Moderne Technologien erlauben es zunehmend und immer einfacher, unbar zu bezahlen, etwa mit der Maestro-, Geld- oder Kreditkarte im Restaurant, bei Migros oder Coop oder beim mobilen Bezahlen von Interneteinkäufen mit einer App und Smartphone.
In der Tat sinkt über die letzten Jahre hinweg der Barzahlungsanteil an allen Zahlungen kontinuierlich. Eine Wirtschaft ohne Bargeld ist technisch heute schon nahezu problemlos möglich. In Skandinavien ist man schon fast soweit. Dort erledigen bereits mehr als zehn Prozent der Bevölkerung alle Einkäufe unbar und in vielen Restaurants oder Geschäften kann nur noch mit Plastikgeld bezahlt werden.
In der Schweiz und Deutschland hingegen ist Bargeld unverändert beliebt, auch wenn es gegenüber elektronischen Bezahlformen schrittweise Anteile verliert. Kontaktloses Begleichen kleinerer Beträge mit dem Smartphone oder einer Geldkarte, Sofort- oder Kreditkartenüberweisungen sowie Internetbezahlverfahren – wie beispielsweise Paypal – im Onlinehandel gewinnen auch hierzulande an Bedeutung, aber eben nur im Schneckentempo. Trotz Debit-, Kreditkarten und Mobile Payment bleiben Schweizer – wie die Nutzung der Bancomaten und das Volumen der abgehobenen Geldbeträge offenbaren – vorerst ihren Banknoten weiter treu. Ein Ende des Bargelds ist noch lange nicht in Sicht. Einfachheit, Anonymität, Zuverlässigkeit und Datenschutz sowie die Negativzinsen bei Spareinlagen sprechen bei den meisten Schweizern weiterhin für das Bargeld.
Hat es in der Schweiz das «Plastikgeld» bereits schwer, die Vormachtstellung des Bargelds zu brechen, gilt das erst recht für das Kryptogeld. Der Bitcoin, noch immer die dominierende virtuelle Währung, erfüllt nicht in Ansätzen die Erwartungen, die an «gutes Geld» geknüpft sind. Die Defizite gelten für alle Geldfunktionen, die Tausch-, die Zahlungs- und die Wertaufbewahrungsfunktion.
Ohne reale Wertgrundlage
Als vor zehn Jahren Satoshi Nakamoto, eine bis heute unerkannt gebliebene Person, «A Peer-to-Peer Electronic Cash System» ins Leben rief, wollte er digitale Zahlungen «Peer-to-Peer» ermöglichen, das heisst von einem Teilnehmer direkt zum anderen Teilnehmer ohne Umwege über Banken oder gar Zentralbanken. Als private geschaffenes Geld entfällt jedoch die Funktion als gesetzliches Zahlungsmittel. Niemand muss Kryptogeld akzeptieren. Damit aber ist die Tauschfunktion nicht gegeben. Für das einfache Einkaufen und Bezahlen ist der Bitcoin somit vollständig ungeeignet und die Transaktionskosten zur Abwicklung einfacher Kaufgeschäfte bleiben viel zu hoch.
Noch krasser liegt der Bitcoin gegenüber staatlichen Währungen wie US-Dollar, Euro oder Schweizer Franken zurück, wenn es darum geht, Menschen vor dem Verlust ihrer Vermögen zu schützen. Der Bitcoin ist und bleibt Geld ohne reale Wertgrundlage. Er ist nichts mehr als ein Versprechen auf die Werthaltigkeit von Algorithmen. Das ist nicht viel mehr als eine Blase, aufgebläht mit viel heisser Luft. Der (Gegen-)Wert eines Bitcoins bestimmt sich einzig und allein durch Angebot und Nachfrage. Bitcoins besitzen keinen intrinsischen Wert, sondern nur einen Tauschwert, und sie sind deshalb besonders anfällig für Wertschwankungen.
Beim Schweizer Franken, dem US-Dollar oder dem Euro sind Zentralbanken darauf verpflichtet, die Preisstabilität zu gewährleisten und damit die Bevölkerung vor einem Kaufkraftverlust ihrer Währung durch Inflation zu schützen. Das kann natürlich schiefgehen. Aber trotz mancher Fehler und bei aller durchaus berechtigten Kritik an ihrer Geldpolitik sind die staatlichen Währungshüter durch Gesetze, Parlamente und Politik kontrolliert und müssen der Öffentlichkeit Rede und Antwort stehen.
Es gibt Argumente dafür
Natürlich gibt es starke Argumente für eine Privatisierung der Geldwirtschaft. Zu oft sind staatliche Währungen mehr oder weniger schleichend durch Inflation oder über Nacht durch Währungsreformen entwertet worden – auch komplett. Aber genauso krachend sind Experimente mit privaten Geldsystemen gescheitert. Sie brachten erst Blasen, dann den Crash. Genau deswegen hat sich weltweit das Geldmonopol staatlicher Notenbanken durchgesetzt. Wie das Rechtssystem lässt sich eben auch das Geldwesen nicht privatisieren, ohne mehr neue Probleme zu schaffen, als alte zu lösen.
Wieso sollte «privates», durch Algorithmen und Netzwerke dezentral geschaffenes Geld mehr Vertrauen als die Zentralbanken geniessen? Bei Kryptowährungen herrschen Anonymität und Intransparenz. Es gibt (noch) keine staatlichen Regulierungen oder Kontrollen, und die Geldausgabe ist durch keinerlei Garantien abgedeckt. Es kann also beliebig viel neues Geld geschaffen werden, ohne dass Eigenkapital oder andere Sicherheiten unterlegt werden müssten.
Zwar gilt bei Bitcoin das Versprechen, dass das Angebot auf 21 Millionen Einheiten limitiert sein soll. Wer aber garantiert, dass die Begrenzung auch wirklich eingehalten werden wird, wer hat wo welchen Zugang zu den Quellprogrammen und den dezentral «Coins» schürfenden Rechnern? Glaubt wirklich jemand ernsthaft, dass die heute vielleicht noch sichere Blockchain-Technologie von privaten Händlern gegen Cyberkriminalität zu schützen ist – wer von den privaten Bitcoin-Herstellern würde dafür bereit sein, die Kosten für mehr Sicherheit zu übernehmen? Gerade ein Erfolg des Bitcoins – also steigende Wechselkurse zu US-Dollar oder Euro – würde es für Kriminelle erst recht attraktiv machen, das System zu hacken, zu manipulieren und zum Interesse Einzelner zu missbrauchen. Wenn überhaupt kann da höchstens der Staat mit all seiner Macht und wohl nur in internationaler Zusammenarbeit im Kampf gegen Cyberkriminalität bestehen.
Was, wenn die steigenden Bitcoin-Kurse alternative Kryptowährungen auf den Plan rufen, die als Wettbewerber um Kunden konkurrieren, die nach sicherer Wertaufbewahrung suchen? Dann ist die Unvermehrbarkeit des digitalen Geldes nicht mehr gegeben und Entwertung droht. Wer aber setzt dann die Klagen der Leichtgläubigen gegenüber den Geldschürfern des Digitalisierungszeitalters durch? Vor allem wenn die in rechtsfreien Räumen weit weg von Westeuropa sitzen sollten – beispielsweise in Nordkorea, wie böse Zungen munkeln?
Die Letzten beisst der Bitcoin
Der Bitcoin ist ein Schneeballsystem, weil bei privaten Kryptowährungen nur zwei Dinge sicher sind: erstens, dass bei einem Crash die letzten Mitreisenden die grossen Verlierer sein werden. Und dass zweitens jene unbekannten Hintermänner die grossen Profiteure sind, die den Bitcoin in Umlauf bringen. Sie streichen sich den schon immer bekannten, bisher den staatlichen Zentralbanken vorbehaltenen, «Seigniorage» genannten Gewinn ein. Er entspricht der Differenz zwischen Produktionskosten der Bitcoins und deren Ausgabepreis – eine Differenz, die momentan bereits ein paar IT-Freaks und deren Geldgeber zu Dollar-Milliardären hat werden lassen. Es sind diese Träume auf Wiederholung, die Blasen entstehen und platzen lassen.
Schliesslich ist der Bitcoin ein Umweltdesaster, weil seine Schürfung enorm viel Energie benötigt. Pro Jahr verbraucht das Bitcoin-Netzwerk etwa so viel Strom wie Portugals Wirtschaft und Gesellschaft. Ob das nachhaltig ist, darf bezweifelt werden.
Alles in allem findet sich momentan nicht ein einziger Grund dafür, wieso Kryptowährungen staatliche Währungen ablösen sollten. Weder garantiert privates Geld mehr Stabilität noch geringere Risiken, weniger Volatilität oder einen geringeren Wertverlust als staatliche Zentralbanken. Vielmehr zeigt sich, dass Kryptowährungen sogar noch schlechter abschneiden als ihr Ruf. Investoren können schnell Geld verlieren und besitzen kaum gerichtsfeste Ansprüche.
Zukunft: Der e-Franken
Allerdings dürften Kryptowährungen dann eine Chance haben, wenn sie als staatliche Währungen und nicht als privates Geld daherkommen. Wenn die amerikanische oder die europäische Zentralbank oder die schweizerische Nationalbank digitales Zentralbankgeld ausgeben, würde damit eine Forderung an die Notenbank entstehen. Das wäre keine wesentliche Veränderung gegenüber der heutigen Welt. Lediglich die verwendete Technik würde sich ändern. In Schweden wird über eine e-Krone nachgedacht. Ähnliche Vorhaben, digitales Zentralbankgeld als Ergänzung und nicht etwa als Ersatz zum Bargeld einzuführen, gibt es in China und Russland. In einem e-Franken der schweizerischen Nationalbank, der neben Banknoten und Münzen als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt wird, liegt die ferne Zukunft der Kryptowährungen. Nirgendwo sonst.

Der aus Burgdorf stammende Thomas Straubhaar ist Professor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere internationale Wirtschaftsbeziehungen, an der Universität Hamburg. Bis September 2014 war er Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts HWWI.