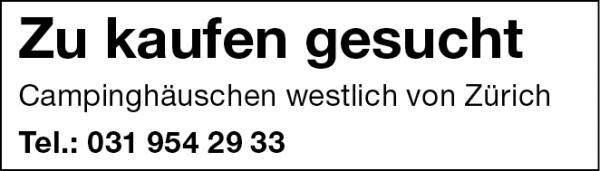Stefan von Bergen
Wer Ebbe und Flut des öffentlichen Verkehrs (ÖV) im Kanton Bern erfahren will, nimmt die S-Bahn-Linie 4 durchs Gürbetal Richtung Bern. In den Zug, der um 6:37 Uhr in Thun abfährt, steigen in jedem Dorf Menschen ein, die zur Arbeit nach Bern pendeln. Ab Belp gibt es nicht mehr genug Sitzplätze, neu Zugestiegene stehen. Wenn die S4 um 7:18 Uhr in Bern die Türen öffnet, ergiessen sich Hunderte in den Berner Bahnhof. Einige Schüler bleiben sitzen. Neue Pendler steigen ein. Um 7:20 Uhr fährt die S4 weiter. In Burgdorf verlassen um 7:43 Uhr Studierende der Fachhochschule den Zug. Wenn die S4 um 7:47 Uhr weiterfährt nach Langnau im Emmental, Ankunft 8:15 Uhr, sind fast alle Sitze leer.
Alles für die Rushhour
Eine «kluge Linie» sei die S4, freut sich Markus Dössegger. Er ist Leiter Bahn beim Personenverkehr der BLS, die das Berner S-Bahn-Netz betreibt. Die S4 schlängle sich auf ihrer Tour durch den halben Kanton geschickt durch die Regionen, hole überall Leute ab und bringe sie zum Knoten Bern – mit ein und derselben Zugkomposition und einem einzigen Lokomotivführer. «Auch wenn das Schlussstück im Emmental eher schwach belegt ist, ist die Auslastung der S4 gut», sagt Dössegger.
Besteigt man die S4 zwei Stunden später, erkennt man ein Dilemma des Regionalverkehrs: Der nun kürzere Zug ist halb leer. «Die Sitzplatzkapazität muss auf die Spitzenzeiten ausgelegt werden», erklärt Dössegger. Überdies verlange der Kanton Bern als Besteller des Regionalverkehrs so viele Sitzplätze, dass niemand länger als 15 Minuten stehen müsse. Um die Rushhour zu entlasten, hat die BLS für fast 500 Millionen Franken 28 Doppelstockzüge «Mutz» gekauft. Die teuren Züge verkehren auch in schwach belegten Randzeiten, wenn sie wenig Geld einspielen.
Ab 32 Passagieren gibt es Geld
ÖV-Pendler klagen über das Gedränge. Vor allem rot-grüne Parteien, Behörden und Regionen wollen die «Erfolgsgeschichte» des ÖV fortsetzen. Die Planer des Trams von Ostermundigen nach Köniz berufen sich auf Prognosen, wonach der ÖV im Raum Bern bis ins Jahr 2030 um enorme 60 Prozent wachsen soll. Sie alle orientieren sich an den kurzen Belastungsspitzen auf den Hauptlinien.
Diese Anspruchshaltung aber kollidiert mit dem komplexen Gesamtbild des Berner ÖV. Er ist ein Geflecht stark und schwach belasteter Linien. Die Postautolinien 100 und 101 von Bern nach Wohlen und Hinterkappelen seien Paradelinien, sagt Postautosprecher Simon Rimle. Auch Kurse auf dem Land, etwa von Thurnen nach Riggisberg, wür- den gut genutzt. Aber schon knapp hinter der Berner Agglomerationsgrenze sitzen in vielen Bussen und Postautos nur wenige Passagiere. Je weiter weg eine Linie von Zentren oder touristischen Attraktionen verläuft, umso schwächer ist ihre Auslastung.
Bund und Kantone übernehmen beim Regionalverkehr zu et- wa gleichen Teilen jene Kosten einer Linie, die nicht durch die Billetttarife der Passagiere abgedeckt sind. Zum Regionalverkehr gehören alle Bahn-, Postauto- oder Buslinien von den Zentren aufs Land. Die Einstiegshürde für diese Defizitgarantie liegt tief. Es genügen 32 Passagiere im Tag, damit eine Buslinie vom Bund und damit auch vom Kanton Abgeltungen erhält für mindestens vier Kurse in beide Richtungen.
Auf dem ganzen Netz der BLS, zu dem der Hauptbahnhof des Grossraums Bern gehört, beträgt der Kostendeckungsgrad knapp 50 Prozent. Im Berner Regionalverkehr – mit den BLS- und Postautolinien, weiteren Buslinien und Vorortsbahnen wie dem RBS – sind es gar nur 48,9 Prozent. Allerdings ist der Deckungsgrad im Regionalverkehr der ganzen Schweiz, die dem Kanton Bern in der heiklen Topografie gleicht, kaum besser: 49,8 Prozent.
Im Klartext: Um den Regionalverkehr kostendeckend zu betreiben, müssten die Passagiere den doppelten Billettpreis zahlen. Die zweite Hälfte des Tickets zahlen mit ihren Steuern auch die Autofahrer – und ärgern sich bisweilen darüber (siehe Box).
Selbst auf Hauptlinien wie Bern–Thun oder Bern–Biel ist der Kostendeckungsgrad kaum höher als 70 Prozent. Auf peripheren Linien wie dem Postautokurs von Oberthal nach Grosshöchstetten, der 2014 aufgehoben wird, liegt er gar unter 20 Prozent. Weitere Zahlen geben BLS und Postauto aus Konkurrenzgründen nicht bekannt.
Verzettelte Agglo Bern
Zur mittelprächtigen ÖV-Kostendeckung kommt im Kanton Bern dazu, dass alle ÖV-Fahrer 58 Prozent mehr Kilometer zurücklegen als in anderen Kantonen. Die Pendeldistanz ist dadurch 20 Prozent länger. Das hat das Institut BAK Basel Economics im Rahmen eines Vergleichs der Berner Staatsausgaben eruiert. Beide Befunde bilden Berns Strukturprobleme ab. Die Wege im weitläufigen Kanton sind lang, was es schwierig macht, einen höheren Kostenan- teil zu erwirtschaften. Immerhin sind die Berner ÖV-Kosten pro Einwohner 7 Prozent unter einem nationalen Schnitt.
BAK Basel hat selbst in den Berner Agglomerationen eine unterdurchschnittliche ÖV-Auslastung ausgemacht. Daran erkennt man ein Malaise, das der Zürcher Politgeograf Michael Hermann kürzlich diagnostiziert hat: Der Grossraum Bern hat zwar eine stark wachsende Zahl von Arbeitsplätzen, bei der Bevölkerung aber eine der tiefsten Zuwachsraten aller Agglomerationen. Nicht zuletzt deshalb, weil in den Berner Vorortsgemeinden die Einzonung von zentrumsnahem Bauland für Wohnungen oft scheitert.
Dass die deshalb noch relativ grüne Agglomeration Bern besonders ökologisch aufgestellt sei, hält Hermann für einen Selbstbetrug: Bern exportiere das Bevölkerungswachstum etwa in den Kanton Freiburg und fördere so die Zersiedelung der Landschaft. Die Pendlerwege sind auch deshalb lang, weil die Bevölkerung im Grossraum Bern weiträumig verteilt wohnt. Selbst hier ist der Kostendeckungsgrad mässig, weil auch die Agglo-Bevölkerung nur langsam wächst.
Fass ohne Boden? Keineswegs
128 Millionen Franken gab der Kanton Bern 2012 für die Abgeltung des Regionalverkehrs aus. Das ist nicht weniger als ein Siebtel des Totalbetrags von 858 Millionen Franken, den alle Kantone zusammen in den Regionalverkehr pumpen.
Ist der ÖV im Kanton Bern ein Fass ohne Boden? Wolf-Dieter Deuschle, Vorsteher des kantonalen Amts öffentlichen Verkehr, dementiert. Die Berner seien ÖV-Fans, 27 Prozent aller von Personen zurückgelegten Fahrkilometer würden im Kanton Bern im öffentlichen Verkehr absolviert. Bloss 27 Prozent? Das sei im Quervergleich viel, sagt Deuschle. Im Aargau seien es nur 19 Prozent. Und der Kanton Zürich zah- le 150 Millionen Franken Abgeltung. Während in Bern die Weite kostet, sind es im dicht bevölkerten Zürich die Leute.
Der Berner ÖV stehe im nationalen Vergleich «sehr gut da», sagt Deuschle. Obwohl die Wege länger seien, lägen die ÖV-Kosten pro Einwohner unter dem nationalen Schnitt. Und der Berner ÖV wachse. Um 3 bis 4 Prozent hätten die Zahl der Passagiere und die pro Person gefahrenen Kilometer seit 2008 jährlich zugelegt, der Autoverkehr aber stagniere.
In einer gewinnorientierten Firma wären das nicht berauschende Werte. Aber der ÖV rechnet sich anders. Zwei Denkweisen treffen hier aufeinander: die der Politik und die der Betriebswirtschaft. Während die Politiker Linien bestellen, die die Standortgunst einer Region erhöhen sollen, müssen die Betreiber – etwa die BLS und Postauto – diese Linien möglichst günstig betreiben. Ihr Spielraum ist allerdings gerade bei schwach belegten, peripheren Linien gering.
Sparen eigentlich unmöglich
Könnte der Kanton Bern dem Dilemma der ÖV-Finanzierung entkommen, indem er unrentable Linien in den Randregionen einstellt? Das hat der Bund im Jahr 2009 versucht. Er schlug vor, die Limite zum Subventionsbezug von täglich 32 auf 100 Passagiere zu erhöhen. 10 Prozent der Berner Postautolinien und gar 20 Prozent der Bündner und Walliser Linien hätten dann keine Bundessubventionen mehr erhalten. Entweder wären die Kantone eingesprungen, oder man hätte die Linien eingestellt.
Der Aufschrei war gross, der Bundesrat liess die Fitnessübung fallen. Was sich auch zeigte: In der Peripherie lässt sich am ÖV kaum sparen. Der Betrieb eines Postautos, das pro Tag ein paarmal hin und her fährt, kostet den Staat relativ wenig, auch wenn nur wenig zahlende Passagiere mitfahren. Für eine dicht befahrene Hauptlinie aber, deren Fahrzeuge, Personal und Betrieb Millionen kosten, zahlt der Staat viel, selbst wenn die Kostendeckung durch die Passagiere hoch ist. Wollte man substanziell sparen, müsste man also Hauptlinien einstellen. Das aber kann keine realistische Option sein.
Eine solche Schliessung würde sich im verflochtenen ÖV-System nicht nur lokal auswirken, erklärt Wolf-Dieter Deuschle. Ganze Regionen wären betroffen, die rentablen Bahn-Fernverkehrslinien würden geschwächt, die Staus auf den Strassen länger. Im Kanton Bern mit seiner ausgeprägten Regionenpolitik wäre der Widerstand gegen einen solchen Kahlschlag gross.
Es erstaunt deshalb nicht, dass der ÖV im Freitag präsentierten Sparpaket des Kantons verschont wird. Selbst der Ersatz schlecht belegter Bahnlinien durch billigere Busse wird nur für den Notfall vorgeschlagen.
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden oder Registrieren.