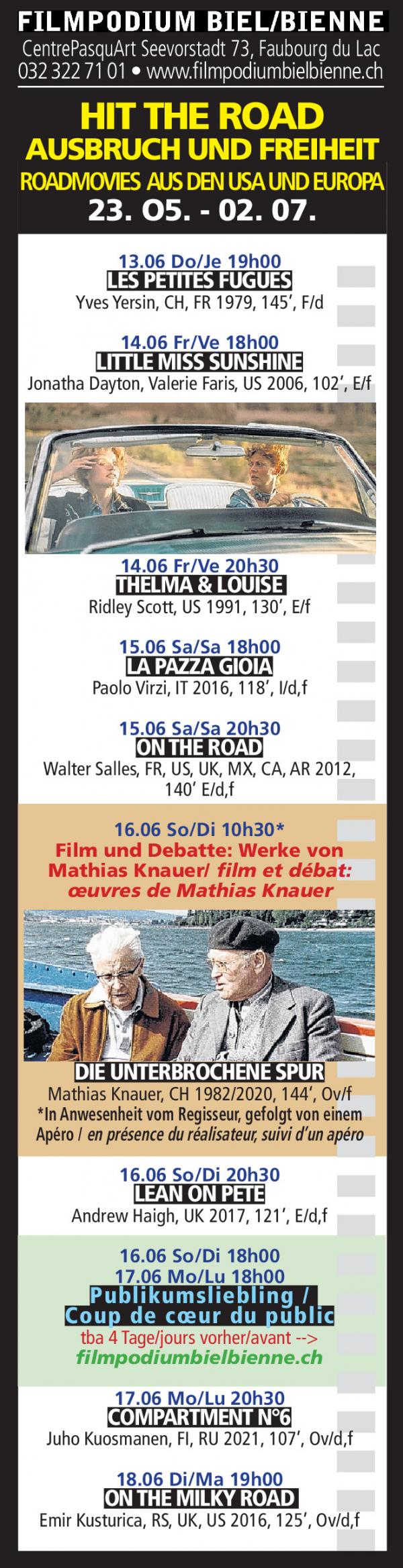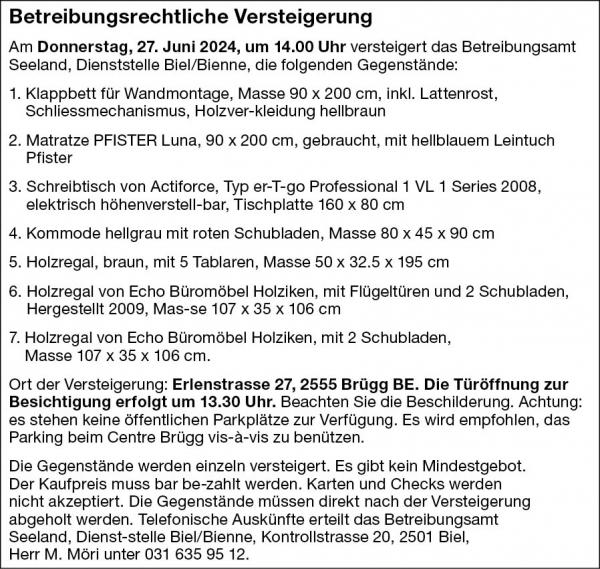Michael Lehmann
Wie knobeln Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka aus, wer den Freistoss ausführen darf? Der eine sagt womöglich, dass er sich heute besonders gut fühle. Der andere kontert vielleicht, er wisse genau, dass dieser Torwart mit Linksschützen seine liebe Mühe habe.
Es bleibt der Fantasie der Zuschauer überlassen.
Anders ist es im Curling. Wenn die Curler zusammen besprechen, wo der nächste Stein liegen bleiben muss, sind die Zuschauer mittendrin. Sie hören, weshalb sich die Sportler für den Takeout statt den Freeze entscheiden. Das ist einmalig im Spitzensport. Im Fussball werden hin und wieder Mikrofone bei der Auswechselbank positioniert, im Eishockey manchmal der Schiedsrichter oder einzelne Spieler verkabelt und in der Formel 1 sind Funksprüche für alle hörbar. Trotzdem: Nirgendwo kann der Fan so tief in die Gedankengänge der Athleten eintauchen wie im Curling.
Möglich machen es die Mikrofone, mit denen die Curler verbunden sind. Sie geben allerdings nicht nur die taktischen Diskussionen wieder. Auch, wenn ein Curler mit einem misslungenen Stein hadert, bekommen das die Zuschauer eins zu eins mit. Curling als sportliches Äquivalent zu einer Big-Brother-Episode? Das lässt sich zumindest aus gewissen Kommentaren der Livestreams auf Youtube rückschliessen: «Ich bin nur hier, um die beiden streiten zu sehen», schreibt einer. Weitere pflichten ihm bei.
Ob es einen Einfluss auf die Sportler hat, dass kaum eins ihrer gesprochenen Worte ungehört bleibt, ist nie eingehend untersucht worden. Die angefragten Sportpsychologen der Sporthochschule in Magglingen gehen davon aus, dass sich die grosse Mehrheit der Sportler nicht von den Mikrofonen irritieren lässt. Die Ausnahme: Der Betroffene ist sehr auf sein Image bedacht.
Das BT hat Spiele verschiedener Seeländer angeschaut, bestimmte Szenen herausgepickt und die Sportler danach gefragt, wie sie mit dem Mikrofon als steter Begleiter unter dem Kinn umgehen.
Der Fluchende
Mats Perret slidet dem Stein hinterher, den er soeben abgegeben hat. «Är isch schnäu wider.» Was tun? Perret wischt die Eisfläche vor dem Stein. Ein Impuls; schnell merkt er, dass der Stein nicht mehr zu retten ist. «Shit.» Perret stoppt, lässt den Stein ziehen. «Fuck, genau glich wie vorhär.» Der Stein bleibt stehen. Im Haus, statt wie geplant vor dem Haus. «Fuck, Mann», wiederholt Perret. Seine Partnerin versucht, ihn aufzumuntern: So wie der Stein nun liege, sei es doch tipptopp. Das sieht Mats Perret anders. «Dä isch nid tipptopp», entgegnet er. Er stützt seinen Kopf auf seinem Besen ab, schaut ins Leere und lässt einen tiefen Seufzer folgen.
Mats Perret lacht, als er auf die Szene angesprochen wird. «Die Emotionen halt», sagt er. Da rutsche schnell mal ein Kraftausdruck raus.
Fluchwörter sind im Sport allgegenwärtig. Viele Athleten lassen ihren Frust auf diese Weise raus. Auch im Curling. Olympiasieger, Welt- und Europameister: Es gab immer Curler, die auf dem Eis ohne Hemmungen fluchten. Weil sich die Curler aber auf die Fahne geschrieben haben, in einem Gentlemansport aktiv zu sein, werden verbale Entgleisungen wiederholt thematisiert. Dies ist besonders in englischsprachigen Ländern der Fall, wo Fernsehstationen auf ein bestimmtes Wort äusserst sensibel reagieren.
Rutscht einem Curler nach einem misslungenen Stein ein «Fuck» über die Lippen, sind die Kommentatoren gezwungen, sich umgehend für die rohe Sprache zu entschuldigen. Der Fluchende selbst muss gar mit einer Busse rechnen; wenn er Glück hat, bleibt es bei einer Ermahnung.
In der Schweiz droht Mats Perret so etwas nicht. Dennoch sind die Curler angehalten, auf ihre Sprache zu achten. An einem grösseren Turnier würde er seine Worte wohl sorgfältiger wählen, erklärt der Seeländer. Da er meist nur national unterwegs ist, kommt es überhaupt selten vor, dass er mit einem Mikrofon ausgestattet wird. Bei seiner Schwester ist das anders.
Die Zankende
«Zieh, Linie.» Jenny Perret will, dass Partner Martin Rios das Eis vor dem Stein wischt. «Zieh, Linie!» Dieses Mal schreit sie es. «Vergisses», entgegnet Martin Rios. «Dä chunnt nie verbi.» Er entscheidet sich, den Stein ziehen zu lassen. Jenny Perret blickt Martin Rios an, als hätte er sich soeben eine Zigarette angezündet. «Das find ig itz ganz dumm vo dir.»
Es folgt das Hickhack, das Jenny Perret und Martin Rios schweizweit als «Chiffler-Päärli» bekannt gemacht hat.
Ja, aber … Nein. Und wenn … Nein. Doch.
Die Zuschauer sind dank der Mikrofone mitten im Gezanke drin. Früher hat das Jenny Perret gestört. Sie machte sich Sorgen, was die Zuschauer von ihr halten würden. Mittlerweile ist das nicht mehr so.
Vor bald zwei Jahren, noch vor Olympia, geriet das Duo in die Schlagzeilen. Hat Martin Rios während einer Partie an der Schweizer Meisterschaft einen Stein berührt, um dessen Bahn zu ändern? Einige Beobachter unterstellten dem Curler Absicht und Unfairness. Über soziale Netzwerke folgten Anschuldigungen und üble Beleidigungen in Richtung des Duos. Auch einige Medien berichteten einseitig. Das hat Jenny Perret nachhaltig geprägt. «Seither denke ich: Ist doch egal, was die Leute über uns denken.»
Im Vergleich mit Mats Perret halten sich Jenny Perret und Martin Rios zwar mit Fluchwörtern zurück, nicht aber mit gegenseitiger Kritik. Diese formulieren die beiden schonungslos und direkt. «Schon gut», sagen viele Curler nach einem misslungenen Stein des Teamkollegen, «schlecht gespielt», sagen Jenny Perret und Martin Rios.
Der teils direkte, teils genervte, teils sarkastische Umgangston und der Fakt, dass die beiden früher auch abseits des Eises ein Paar waren, führt wiederholt dazu, dass ihre Teamdynamik hinterfragt wird. Als die beiden an den Olympischen Spielen besonders im Fokus standen, erklärten sie den Medienvertretern: Wir brauchen das.
Einmal hatten sich Jenny Perret und Martin Rios entschieden, sich mit gegenseitiger Kritik zurückzuhalten. «In dieser Phase spielten wir viel schlechter», erinnert sich die 26-jährige Sutzerin.
Zuletzt, im Final des World Cups in Omaha (USA), schienen die negativen Äusserungen die beiden Curler jedoch mehr zu verunsichern als zu stärken. Nach einem starken Start funktionierte plötzlich kaum mehr etwas. Fehlstein reihte sich an Fehlstein. Während die Gegner in der Pause das Geschehen besprachen, gingen die beiden Schweizer auf Abstand.
Hatte die Kommunikation doch einen Einfluss? «Vielleicht war es an diesem Tag zu viel des Negativen», sagt Martin Rios schulterzuckend. Manchmal ist es zu viel, manchmal zu wenig. «An den Olympischen Spielen haben wir uns im Final zu sehr zurückgehalten. Das hat uns die Goldmedaille gekostet.»
Die Zurückhaltende
Melanie Barbezat verzieht die Mundwinkel. «Dä isch lang.» Sie blickt dem Stein nach. Bloss nicht wischen. Wann wird er endlich langsamer? Spät. Der Stein bleibt im hinteren Drittel des Hauses stehen. Vorgesehen war er im vorderen Drittel. «Ok», sagt Teamkollegin Alina Pätz. «Sorry», sagt Melanie Barbezat. Zu viel Tempo. Unkonzentriert. Barbezat tippt sich mit dem Zeigefinger zweimal an die Stirn.
Keine Flüche, kaum Kritik. Dafür Kosenamen wie Meli oder Pätzi. Das Frauenteam um Skip Silvana Tirinzoni strahlt Harmonie pur aus; das scheinbare Gegenteil von Jenny Perret und Martin Rios. Fehlsteine werden zur Kenntnis genommen, kaum diskutiert. «Ich kann von uns behaupten, dass wir uns eigentlich immer anständig äussern», sagt Melanie Barbezat. Das ist nicht zuletzt den vielen Turnierteilnahmen in Kanada geschuldet. Kritische Entscheidungen oder misslungene Steine besprechen die Curlerinnen – wenn überhaupt – off- nicht on-Ice. Daher hat niemand im Team ein Problem damit, verkabelt zu werden.
Eine Erfolgsgarantie ist dies freilich nicht. «Jedes Team muss für sich selbst erkennen, wie es am besten funktioniert.» Die 27-jährige hätte Mühe mit einem eher harschen Umgangston. Ob sie dann mit derselben Konzentration weiterspielen könnte? Melanie Barbezat ist froh, muss sie es nicht herausfinden.
In einem Punkt sind sich letztlich alle drei Curler einig: Dank der Mikrofone sind die Zuschauer praktisch mit den Curlern zusammen auf dem Eis. Sie können bei den taktischen Überlegungen mitreden, bei misslungenen Versuchen mitfluchen, bei Erfolgen mitjubeln. Das macht die Sportart für Übertragungen im Fernsehen attraktiv. Die TV-Präsenz wiederum erleichtert die Sponsorensuche, die sich für Vertreter einer Randsportart jeweils schwierig gestaltet.
Daher werden die Curler, ob sie ihn mögen oder nicht, weiter mit ihrem Begleiter unter dem Kinn spielen.
**********************
Verbale und nonverbale Ausrutscher
Klartext
Das Deutsche Frauenteam spielte in diesem Jahr eine starke Europameisterschaft. Doch im Spiel gegen die Schweiz lief einiges schief. Beim Stand von 4:8 hatte Skip Daniela Jentsch genug. Gefrustet schlug sie mehrmals mit dem Besen aufs Eis. In der kurzen Teambesprechung zeigte sich, wem sie die Schuld an der Misere gab: «Da kommt von euch einfach zu wenig. Ihr seid nicht auf Augenhöhe. Ich bin auf Augenhöhe, ihr nicht.» Klare Ansage.
Geschwisterstreit
Matt und Becca Hamilton sind Bruder und Schwester. Kein Wunder, gerät auch das amerikanische Olympia-Duo immer wieder aneinander. Nach einem Fehlstein seiner Schwester wollte Matt sie zuerst aufmuntern: «Hey Becca, come here.» Diese hielt jedoch wenig von der Idee und Matts Mitleid wandelte sich in Ärger um. «Don’t you roll your eyes at me», sagt er (dt. verdreh nun nicht die Augen). Danach herrschte vorerst eisiges Schweigen.
Kreativ
Nicht nur im Englischen, sondern auch im Deutschen sind «Fuck» und «Shit» – vermutlich wegen ihrer Kürze – gängige Fluchwörter. Schon fast kreativ zeigte sich die Kanadierin Heather Nedohin, die nach einem Fehlstein ihren Frust mit dem Wort «Shitballs» ausdrückte. Ein Wort, das gemäss Urban Dictionary zwei Bedeutungen haben kann. Diese werden an dieser Stelle jedoch nicht näher erläutert.
Betrunken
Vorab: Von dieser Begebenheit sind bisher keine Tonaufnahmen an die Öffentlichkeit gelangt. Vor einem Monat wurde ein kanadisches Team mitten im Turnier disqualifiziert, weil die Curler – offensichtlich betrunken – ständig fluchten, Besen zerbrachen und die Garderobe verwüsteten. Unter den Spielern war mit Ryan Fry (40) ein Olympia-Goldmedaillengewinner von 2014. Er hat kürzlich beschlossen, eine Curling-Pause einzulegen.