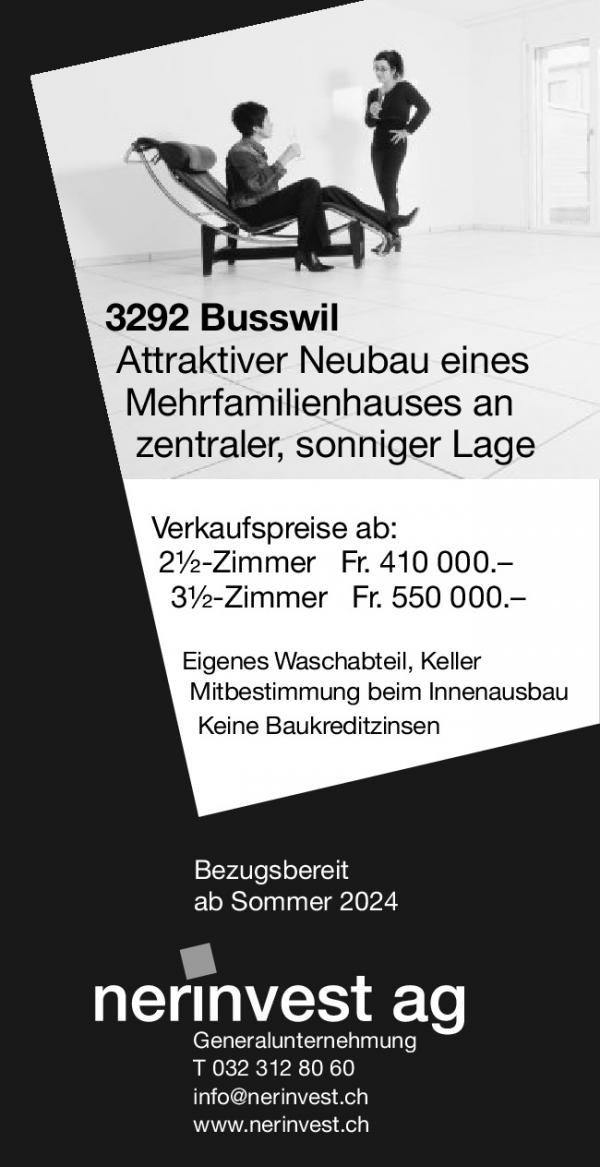Hagr Arobei
Herbst 2015 auf dem Mittelmeer, in der Nähe der griechischen Küste. Das Boot ist randvoll mit Menschen auf der Flucht nach Griechenland. Kinder, Frauen, Männer. Viele tragen eine Waffe. In der Nähe hält eine Polizeipatrouille Wache. Der Schlepper versucht, unbemerkt an ihnen vorbeizufahren. Kurz vor der Küste ertönt ein lauter Ruf – sie wurden entdeckt. Es wird diskutiert, die Polizei will den Schlepper festnehmen. Als das Boot der Polizisten auf sein Boot prallt, versucht der Schlepper zu entkommen. Wie durch ein Wunder gibt es kein Unglück, niemand fällt ins Wasser. Keiner der 24 Flüchtlinge ertrinkt, obwohl ein Grossteil von ihnen nicht schwimmen kann. Der Schlepper wird festgenommen, die Passagiere auf die griechische Insel Kalymnos gebracht.
Szenenwechsel. Lyss, Durchgangszentrum für Asylsuchende, Dezember 2016. Ein kleines Zimmer, ein Doppelbett mitten im Raum. Zwei unterschiedliche Teppiche auf dem Boden und ein kleiner Schreibtisch, überfüllt mit Alltagssachen und Spielzeug. Ein kleines Zimmer, in dem Familie Kan wohnt. Sie besteht aus Vater Ahmed*, Mutter Myriam* und der dreijährigen Tochter Sarah*. Zum ersten Mal erzählen sie von ihrer Flucht aus dem Irak in die Schweiz. «Physisch geht es uns hier besser, aber mental sind wir tot», sagt Myriam Kan. Sie sorgt sich um das Wohlergehen ihrer Tochter. Seit die Familie vor knapp eineinhalb Jahren aus dem Irak geflüchtet ist, hat Sarah kein Wort gesprochen. «Die Reise muss sie traumatisiert haben.» Familie Kan lebt nun seit 14 Monaten im Durchgangszentrum in Lyss. Ursprünglich kommen sie aus Sulaimaniyya, eine Stadt im Norden des Iraks, die vor allem von Kurden bewohnt ist.
* richtige Namen der Redaktion bekannt
Zusammenhalt dank Frauentausch
Eine Tradition der noch sehr altmodischen Dörfer im Norden Iraks ist, dass innerhalb von zwei Familien jeweils eine Frau mit einem Mann der anderen Familie verheiratet wird. So auch bei den Kans. Myriam und Ahmed Kan heirateten und verliebten sich ineinander. Nachdem es bei dem anderen Paar zu Konflikten kam, liess es sich scheiden. Die Familien zerstritten sich und von Myriam und Ahmed Kan wurde verlangt, die Ehe ebenfalls auf der Stelle aufzulösen. «Das brachten wir einfach nicht übers Herz. Ich riskiere lieber mein ganzes Leben, als mein Leben mit Myriam zu verlieren», sagt Ahmed Kan und lächelt seine Frau an. Die Verwandten drohten ihnen mit dem Tod. «Wir packten unsere sieben Sachen und machten uns auf die Reise», sagt Myriam Kan. Noch heute werden sie von Verwandten verfolgt. Daher müssen ihre Namen und ihr Aussehen geheim bleiben. «Ich habe Angst, dass meine Familienmitglieder uns auf die Schliche kommen. Sie wollen nach wie vor unseren Tod, denn wir haben ihre Ehre befleckt», sagt Myriam Kan.
Familie Kan spricht kurdisch. Ashti Amir, Mitarbeiter beim Durchgangszentrum in Lyss, verlässt den Raum. Der Draht zu den Mitarbeitern scheint angespannt zu sein. «Der Ort ist gut, aber es wird nicht viel für uns gemacht. Keines unserer Papiere wurde bisweilen bearbeitet und wir wissen nicht warum», sagt Myriam Kan. Ihr Ehemann ist in schlechter Verfassung. Er leidet an Nierensteinen, die Schmerzen verursachen und ihn körperlich einschränken. Im Raum steht eine Plastikflasche, gefüllt mit einer gelblichen Substanz. «Mein Mann muss in diese Plastikflasche urinieren. Ich habe Angst, dass meine Tochter es trinkt, wenn ich nicht aufpasse», sagt Myriam Kan. Der Weg zu den Toiletten sei zu weit, sie befinden sich einen Stock weiter unten. «Auf dem Weg zur Toilette bin ich mal gestürzt und hätte mir dabei fast den Rücken gebrochen», sagt Ahmed Kan.
Ihre Reise begann in Sulaimaniyya. Die Familie nahm einen Reisebus, der sie in die Türkei fuhr. Ganze 40 Stunden verbrachten sie im Bus. In der Türkei bestiegen sie ein Boot, das mit 24 weiteren Flüchtlingen beladen war. Weiter ging es nach Mazedonien, Serbien, Kroatien, Slowenien, Österreich und schliesslich in die Schweiz.
Von Polizisten geschlagen
Die ganze Reise dauerte einen Monat. «Besonders in Griechenland waren die Einwohner freundlich und haben uns Nahrungsmittel, Kleider und Hygieneartikel geschenkt», sagt Ahmed Kan. Acht Tage verbrachten sie dort in einem Flüchtlingscamp. In Serbien war dagegen von Gastfreundlichkeit wenig zu spüren. «Die Bewohner waren nicht so zuvorkommend wie jene in Kalymnos. Am schlimmsten waren die Polizisten. Sowohl in Serbien als auch in Kroatien haben sie mich geschlagen», sagt er. Die Erzählungen hören sich brutal an. «Man hat keine Rücksicht auf meine Krankheit genommen. Ich wurde getreten und angespuckt. Die Polizisten sind frustriert und haben die Lage nicht unter Kontrolle.» Die kleine Familie sieht traurig aus. «In Serbien war es am schlimmsten. Wir mussten drei Stunden lang mit hunderten von anderen Flüchtlingen wandern», sagt Myriam Kan. Das Essen war knapp und sie waren erschöpft. Nach der Wanderung seien sie von einem Taxifahrer betrogen worden. Er behauptete, er bringe sie zur Zugstation und verlangte eine hohe Summe als Vorauszahlung. Statt zum abgemachten Ort zu fahren, brachte er sie zur Polizei und behielt das Geld. Beim zweiten Anlauf klappte es. Eine albanische Familie brachte sie gegen eine kleine Bezahlung zum Bahnhof. Sie kauften sich Zugtickets und machten sich auf den Weg nach Kroatien. «Wir mussten ohne Essen und Trinken zwölf Stunden fahren. Es war stickig und die Kleine hatte Hunger», sagt Myriam Kan.
Tochter Sarah umklammert ihr Smartpad und spielt damit. «Wir haben ihr dieses Tablet gekauft, damit sie sich hier nicht so langweilt», sagt Myriam Kan. Immer wieder ertönt die Melodie eines Spiels. «Wir wissen, dass das nicht besonders pädagogisch ist. Aber mit ihr rausgehen können wir nicht. Sie hasst es, draussen zu sein, und hat Angst vor dem Wald, der hier angrenzt.» Manchmal sehe die Kleine Sachen, die niemand anders sehen kann. Dann schreit sie und hat fürchterliche Angst. Meist geschieht das in der Nacht. «Sie ist praktisch auf der Flucht gross geworden. Es bricht uns das Herz, dass sie da durch musste», sagt Myriam Kan.
Nachdem in Serbien und Kroatien das Schlimmste überstanden war, setzten sie ihre Reise nach Slowenien und Österreich fort. Schliesslich landeten sie in der Schweiz. Die Familie Kan ist froh, endlich hier angekommen zu sein. Zuerst wurden sie nach Biel gebracht. «Unsere Unterkunft glich einem Gefängnis. 17 Tage lang blieben wir dort», sagt Ahmed Kan. Nachdem das Immigrationszentrum in Bern ihre Geschichte unter die Lupe genommen hatte, wurden sie in ein Durchgangszentrum, ebenfalls in Biel, gebracht. Da dies voll war, verbrachten sie die ersten zwei Monate in einem Hotel. Nach einem kurzen Aufenthalt in Ins wurden sie zu ihrem jetzigen Heim in Lyss gebracht.
«Wir schätzen die Unterkunft, aber wir fühlen uns sehr einsam», sagt er. Zum einen sei die Kommunikation mit den anderen Asylsuchenden ein Problem. Wenige von ihnen sprechen das irakische Kurdisch. Andererseits zieht sich die Familie zurück, scheint etwas misstrauisch zu sein. «Wird man von der eigenen Familie betrogen, lernt man, dass man sich letzten Endes nur auf sich selbst verlassen kann», sagt Ahmed Kan.
Freundliche Schweizer
Von der Schweiz hat Familie Kan ein gutes Bild. «Die Einwohner hier sind sehr nett und grüssen uns auf der Strasse. Wir respektieren alle und schätzen die Freundlichkeit, die uns die Schweizerinnen und Schweizer entgegenbringen», sagt Myriam Kan. Bei den Behörden gehe es aber nicht wirklich voran. «Wir nehmen es ihnen nicht übel. Es gibt sehr viele Asylbewerber und die Schweiz ist ein kleines Land.» Ein anderes Problem ist das Wasser. «Im Zimmer haben wir nur sehr heisses Wasser. Ohne Haushaltshandschuhe verbrenne ich mir die Hand», sagt sie.
Auch die Tatsache, dass sie aus dem Irak geflüchtet sind, sei nicht gerade von Vorteil: «Syrier haben Vorteile, weil sich das Land aktiv im Krieg befindet. Aber auch im Irak leidet die Bevölkerung. Man ist nirgends sicher. Und das wissen die Behörden ganz genau. Das weiss die ganze Welt», sagt Myriam Kan.
Auf dem Boden des Zimmers ist die Familie nahe zusammengerutscht. «Wir haben Schreckliches gesehen. Den Tod, die Angst und Trauer, die Einsamkeit. Wir fühlen uns von ihnen verfolgt», sagt Myriam Kan. Es ist die Ungewissheit über die Zukunft, die ihnen besonders zu schaffen macht. «Wir haben nach wie vor nur den Ausweis N (für Asylsuchende). Das ist noch keine definitive Aufnahme.» Trotz allem sehen sie Hoffnung. Hoffnung auf ein besseres Leben. «Es geht hier nicht um mich oder meine Frau. Letzten Endes geht es vor allem um unsere Tochter. Wir werden weiter kämpfen und ihre Zukunft nicht aufgeben», sagt Ahmed Kan. Die Familie tauscht berührende Sätze aus: «Wir haben einander und das ist, was zählt.»
******************************************************
Wie ich als Kreis in der Welt der Vierecke lebte
Vor über zehn Jahren ist BT-Praktikantin Hagr Arobei mit ihrer Familie aus Bagdad in die Schweiz geflüchtet. Sie berichtet, wie sie sich damals in der noch fremden Schweiz gefühlt hat.
Nie werde ich die Freude vergessen, als wir im zürcherischen Schwerzenbach in ein Flüchtlingsheim gebracht wurden: Wir bekamen ein eigenes Zimmer zu dritt! Endlich ein bisschen Privatsphäre. Endlich gab es eine richtige Dusche und genügend Toiletten.
Was für die meisten Schweizer selbstverständlich ist, war für uns im Jahr 2003 ein Privileg. Hin und wieder gab es kleinere Aktivitäten, zum Beispiel einen Filmabend. Das freute mich sehr, ich war glücklich. An den Irak konnte ich mich nicht mehr erinnern.
Seit 13 Jahren wohne ich in Zürich. Ursprünglich komme ich aus Bagdad, Irak. Damals musste ich gemeinsam mit meiner Mutter und meiner grossen Schwester aus unserer Heimat flüchten. Die Spannung im Land war spürbar, meine Mutter wollte gehen, bevor der Krieg ausbrach. Mein Vater, ein Arzt, wollte nachkommen, doch der Krieg brach früher aus als erwartet. Im Kriegszustand ist es den Ärzten nicht gestattet, auszureisen. Er blieb zurück. Das brach meiner Mutter das Herz.
Voller Furcht machten wir uns auf die gefährliche und lange Reise. Meine ersten Erinnerungen beginnen in Griechenland. Ein grosses Gebäude, das hunderte von Menschen beherbergte. Es war einstöckig und hatte keine Zimmer, einzig die Toiletten waren abgegrenzt. Das Essen war rationiert, meist gab es die gleichen Speisen: Poulet, ein wenig Gemüse, Brot, dazu Wasser und morgens Milch. Es gab dort grosse Tore, die alle 30 Minuten geöffnet wurden, damit man kurz an die frische Luft konnte. Polizisten und Soldaten prägten das Bild. Einige Monate später gingen wir nach Italien und zogen danach in die Schweiz.
Ich fühlte mich leer, anders
Nachdem wir für einige Monate in einem Flüchtlingsheim in Schwerzenbach untergekommen waren, zogen wir in ein Dorf im Zürcher Oberland. Wir wohnten in einer kleinen Baracke mit zwei Schlafzimmern, einem kleinen Badezimmer und einer bescheidenen Küche. Was für ein Luxus das doch für mich war! Zu meinem Vater hatte ich inzwischen seit Jahren keinen Kontakt mehr, doch das störte mich nicht. Die Erinnerungen an sein Gesicht, seine Stimme und seine Gesten waren verschwommen. Es gab nur meine Mutter, meine ältere Schwester und mich.
Den ersten Kulturschock erlebte ich im Kindergarten. Während unseres Aufenthaltes im Flüchtlingsheim in Schwerzenbach wurde uns die Schweizer Kultur nicht nähergebracht, um uns herum lebten ausschliesslich andere Flüchtlinge. Während der Schulzeit änderte sich dies. Auf einmal befand ich mich inmitten von 20 Mitschülern, die alle die deutsche Sprache beherrschten und für europäische Verhältnisse eine mehr oder weniger normale Kindheit genossen. Weit weg vom Krieg, weit weg von Terror und weit weg vom grossen Gebäude in Griechenland.
Ich fühlte mich schlecht. Durch meine damals noch ungenügenden Deutschkenntnisse fiel es mir schwer, Freundschaften zu knüpfen oder die Anweisungen meiner Lehrer zu verstehen. Auf der Flucht hatte mir der Kontakt zu gleichaltrigen gefehlt, so wusste ich nicht, wie ich auf andere Kinder zugehen sollte. Ich war sehr schüchtern.
Mir war bewusst, dass ich anders war. Und ich hasste es. Ich sehnte mich nach einer normalen Familie, wie sie meine Kameraden hatten. Aus mir wurde schnell eine Aussenseiterin. Täglich kam ich nach Hause, deprimiert und enttäuscht von mir selber. Die Schule war schwer: Zum einen aufgrund der Sprache, zum anderen konnte mir meine Mutter nicht bei den Hausaufgaben helfen und ich war stets gezwungen, alles alleine zu erledigen. Das ist unfair, dachte ich, warum muss ich so viel mehr geben als alle anderen? Warum bin ich damit bestraft worden, in einer Welt voller Vierecke zu leben, wenn ich doch eigentlich ein Kreis bin? Egal wie oft ich auch versuchte, mich diesen Vierecken anzupassen – stets gab es Ecken, die ich nicht ausfüllen konnte. Ich fühlte mich leer, komisch, anders. Die Schuld gab ich mir selbst. Wenn ich jetzt zurückschaue, erfüllt es mich mit Schmerz. Ein sechsjähriges Kind sollte sich nicht so fühlen.
Treffen mit meinem Vater
Das Geld war knapp und Kino, Restaurantbesuche und Musikstunden waren unerfüllbare Wünsche. An solche unrealistischen Gedanken vergeudete ich damals keine Energie. Für einige Jahre wohnten wir in der kleinen Baracke, bis wir in eine andere zogen, die ein wenig grösser war. Darüber war ich überglücklich. Zwar musste ich nach wie vor mein Zimmer mit meiner Schwester teilen, aber immerhin war es ein wenig grösser.
Mit zwölf Jahren geschah es: Mein Vater kam zu Besuch! Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie wir ihn am Flughafen abholten. Wie mein Vater aussah, wusste ich damals bereits nicht mehr. Wann immer ein Mann in unsere Richtung lief, fing mein Herz an zu pochen. Endlich war er da. Nie mehr werde ich vergessen, wie ihn meine Mutter ansah. Dieser tiefe und sehnsüchtige Blick und der Schmerz, der damit verbunden war. Aber auch die Freude und Erleichterung, dass sie ihren Ehemann nach endlos langen Jahren endlich wieder zu Gesicht bekam. Ich empfand keine grosse Freude, eher Nervosität. Wer war dieser Mann? War er tatsächlich mein Vater? Was hiess es, einen Vater zu haben?
Ich bin Schweizerin
Nach zwei Wochen musste er wieder abreisen. Mein Vater, den ich doch gerade erst wiederbekommen hatte, verliess mich erneut. Ich weinte, der Schmerz war kaum auszuhalten. Da wusste ich, wofür man einen Vater hat. Er ist für mich da, wenn die Mutter verärgert ist, deckt mich vor dem Schlafengehen zu, erzählt mir Geschichten und ist immer für mich da. Dieser bittere Schmerz wird wahrscheinlich nie ganz verschwinden. Auch wenn Papa uns heutzutage alle sechs Monate für zwei Wochen besucht, weiss ich stets, dass er wieder geht und dass er vielleicht nie mehr zurückkehren wird.
Inzwischen hat sich mein Leben ziemlich verändert. Die Sprache beherrsche ich jetzt sehr gut, ich habe mich einbürgern lassen und wir wohnen in einer grossen Wohnung, in der ich mein eigenes Zimmer habe. Meine Schwester und ich haben das Gymnasium besucht. Und was für uns einst Luxus war, gehört inzwischen zur Normalität. Ein Musikinstrument zu spielen, ist nicht mehr abwegig und Restaurantbesuche stehen regelmässig auf dem Plan.
Man könnte meinen, das Schlimmste sei nach der Flucht überstanden, doch dem ist nicht so. Oft wurde ich von den Kindern und manchmal sogar von deren Eltern ausgestossen. Sie gaben mir das Gefühl, ich sei minderwertig. Aber genauso oft gab es auch Menschen, die uns regelmässig besuchten, uns Spielzeuge schenkten und uns zeigten, dass wir hier zur Gemeinschaft gehören.
Diese Menschen nahmen mir den Hass, die Wut auf die Ungerechtigkeit und linderten den Schmerz. Diesen Menschen will ich von ganzem Herzen danken, denn sie haben mir dazu verholfen, die Person zu werden, die ich heute bin. Eine Schweizerin mit arabischen Wurzeln.
Hagr Arobei
Info: Hagr Arobei ist 18 Jahre alt und wohnt in Zürich. Seit Mitte Oktober absolviert sie beim BT ein Praktikum im Regionalressort.
«Was da passiert, ist ein Abschlachten»
Zu Besuch bei den Asylsuchenden
«Die Nacht ist oft eine schwierige Zeit»
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden oder Registrieren.