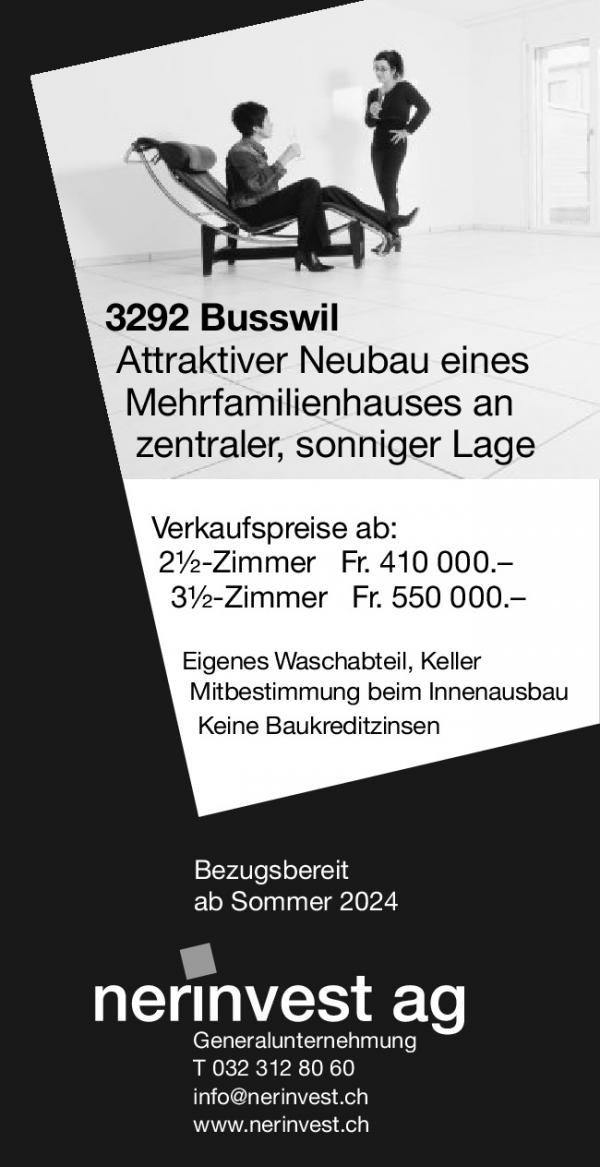Hannah Einhaus
83 Jahre liegen zwischen den damaligen Ereignissen und heute, und doch spüren wir nach wie vor einen tiefen Schmerz, wenn wir auf die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 in Hitler-Deutschland zurückschauen. Im ganzen Dritten Reich, einschliesslich Österreich, brannten über 1600 Synagogen nieder. Tausende Geschäfte und Wohnungen wurden zerstört und ausgeraubt, Friedhöfe geschändet und Zehntausende von Menschen in Konzentrationslager gesteckt oder ermordet.
Was bedeutete diese Nacht in Deutschland für die Juden in der Schweiz und damit auch für die jüdischen Gemeinden in Bern und Biel? Das «Israelitische Wochenblatt» in Zürich schrieb damals vom «grössten Pogrom aller Zeiten». Das allgemeine Entsetzen war allgegenwärtig und löste – in den Worten des «Wochenblatts» – einen «entfesselten Entrüstungssturm» aus, «wie ihn in dieser Form die Welt seit den Armenier-Greueln nicht erlebt hat». Damit ist der Völkermord an den Armeniern durch die Türken im Jahr 1915 gemeint.
Welt liess Hitler freie Hand
Die Reichspogromnacht bildete einen vorläufigen Höhepunkt einer ganzen Reihe von Schritten der systematischen Entrechtung der Juden in Deutschland. Bereits seit 1936 galten die Nürnberger Rassengesetze, die aus Menschen die Kategorien Arier und Juden machten. In den Monaten vor der Pogromnacht ging es Schlag auf Schlag: An der Konferenz von Evian im Juli 1938 signalisierten die Staaten der Welt, einschliesslich der Schweiz, dass ihre Grenzen bei einer Flucht der Juden aus dem Dritten Reich verschlossen bleiben würden. Indirekt gaben sie damit Hitler freie Hand, Juden zu jagen, zu enteignen, in die Enge zu treiben, in Lager zu stecken und schliesslich zu ermorden. Die Schweiz führte in diesen Monaten den berühmten «J-Stempel» ein und schloss die Grenzen für «rassische Flüchtlinge».
1938 erhielten in Deutschland alle Jüdinnen und Juden zwangsweise den Zweitnamen «Sarah» und «Israel». Parallel dazu wurden jüdische Unternehmen nach und nach «arisiert», also den jüdischen Besitzern entrissen und hitlerfreundlichen Unternehmern überlassen.
Juden, denen die Flucht nicht gelungen war, lebten nun entrechtet, enteignet, ausgeraubt, ohne Synagogen – und wurden in Konzentrationslager deportiert. Davon betroffen waren auch Jüdinnen aus der Schweiz, die in Deutschland lebten und durch ihre Heirat mit einem Deutschen den Schweizer Pass verloren hatten.
Von den Zuständen in diesen Lagern erfuhr Georges Brunschvig, damals Vorstandsmitglied der Berner Gemeinde, aus erster Hand von einem gewissen Adolf Rosenberg. Er war dem KZ Buchenwald nach 18 Tagen Haft entkommen und hierher nach Bern geflüchtet. In einem Tagebucheintrag hielt Brunschvig Rosenbergs Erzählungen fest, zum Beispiel: «10 000 Juden waren im November 1938 eingeliefert worden. Sie wurden verteilt in vier Baracken, je 2500 Menschen. Die ersten vier Tage erhielten sie keinen Tropfen Wasser, acht Tage konnten sie sich nicht waschen. Pro Baracke war eine Latrine. Die meisten Häftlinge mussten in die Hosen machen. Von der Nahrung kriegten sie Durchfall. Solange einer gesund war, konnte man es überstehen.»
Dann weiter: «Das Schlimmste war die Nacht. Viele wurden wahnsinnig, ihre gellenden Schreie ertönten und plötzlich Ruhe. Entweder hatte man sie totgeschlagen, oder sie waren, um der Not ein Ende zu bereiten, in die elektrische Umzäunung gerannt. Zur Zeit befinden sich noch etwa 800 Menschen im Lager.» Brunschvigs Tagebucheintrag entstand im Februar 1939, drei Monate nach der Pogromnacht. In dieser kurzen Zeit also hatte nur einer von zwölf Inhaftierten überlebt. Die anderen elf waren ausgelöscht, nur weil sie Juden waren.
Diese und ähnliche Schilderungen über KZs und Vernichtungslager sind heute bekannt, dokumentiert und erforscht, tausende Bücher geschrieben. Doch damals, im Februar 1939, gehörten Rosenbergs Schilderungen zu den frühen Berichten über die Zustände in den Lagern.
Die Pogromnacht sorgte auch bei den verschont gebliebenen Juden in der Schweiz für ein Dilemma. Am 20. November 1938, zehn Tage nach der Reichspogromnacht, wollte man in der Berner Synagoge einen öffentlichen Trauergottesdienst durchführen, mit geladenen Gästen der Regierung. Er sollte per Annonce im «Anzeiger der Stadt Bern» angekündigt werden. Doch nach langer Diskussion im Vorstand wurde diese Idee wieder fallen gelassen. Man befürchtete, die Öffentlichkeit könne dies als Demonstration auffassen. Eine Zeitzeugin aus Bern erzählte mir einmal: «Uns wurde mit dieser Pogromnacht endgültig bewusst, dass Hitler im Falle einer Annexion der Schweiz die Juden nicht anders behandeln würde als in Deutschland oder Österreich. Das löste auch bei uns in der Schweiz grosse Ängste aus.»
Verordnung nie angewendet
Immerhin reagierten die schweizerischen Behörden mit der sogenannten «Demokratieschutzverordnung». Sie richtete sich gegen «das öffentliche Aufreizen zum Hasse gegen einzelne Gruppen der Bevölkerung wegen ihrer Rasse, Religion oder Staatszugehörigkeit». Verstösse sollten bestraft werden. Auf den höheren Schutzbedarf der Juden deutete folgender Satz: «Die Ritualmordhetze ist die schmutzigste Waffe dieses Rassenhasses.» Dies dürfte ein Signal an die schweizerischen Nazi-Bewegungen gewesen sein. Doch war diese Verordnung wirklich wirksam? Nur soviel: Bis Kriegsende wurde sie nie angewendet, es kam zu keinen Anzeigen, Urteilen und Bussen. Die Verordnung blieb toter Buchstabe und verhinderte keine Aktionen und Publikationen gegen Juden. Bundesrat und Justizminister von Steiger machte dem Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund klar, dass der Antisemitismus per se keineswegs gleichbedeutend sei mit dem Straftatbestand der Demokratieschutzverordnung.
Ich habe mich immer gefragt: Warum hat die Schweiz 50 Jahre gebraucht, um erst in den 90er-Jahren die Geschichte ihrer Flüchtlingspolitik aufzuarbeiten? Warum verdrängte Bundesrat Delamuraz noch 1995 die Vergangenheit mit seinem legendären Satz «Auschwitz liegt nicht in der Schweiz»? Schon seit den 1950er- und 1960er-Jahre lagen genügend Dokumente und Augenzeugenberichte vor, um darüber zu berichten. In Deutschland kam es in den 1960er-Jahren zu verschiedenen Prozessen gegen Kriegsverbrecher, Autoren griffen das Thema für Literatur und Bühne auf. Doch die Schweiz enthielt sich einer Auseinandersetzung mit ihrer Rolle als Zuschauerin.
Ein wenig Auschwitz
1964 unternahmen der damalige Chefredaktor des «Beobachters», Peter Rippmann, und Autor Max Frisch einen Versuch, eine allfällige «unbewältigte Vergangenheit» literarisch zu thematisieren. Die Debatte versiegte, bevor sie richtig begonnen hatte. Zu verbreitet war die Meinung, die vom Krieg verschonte Schweiz habe gar keine Geschichte. Literarische Grössen wie Dürrenmatt klebten an einer solchen Überzeugung. Es gab also auch keine Schuld und daher auch nichts zu «bewältigen» und aufzuarbeiten.
Erst in den frühen 90er-Jahren begann ein schmerzhafter Prozess einer Auseinandersetzung. Aussenpolitisch pochte der Jüdische Weltkongress auf jüdische Ansprüche der Wiedergutmachung bei nachrichtenlosen Vermögen. Auf innenpolitischen Druck entstand der Bergierbericht über die damalige Flüchtlingspolitik und die wirtschaftliche Kollaboration der Schweiz mit Nazi-Deutschland. Ein wenig Auschwitz lag eben doch in der Schweiz. Auf diese Kritik folgten auch zahlreiche antisemitische Bemerkungen.
Heute, im Jahr 2021, ist eine dritte Generation herangewachsen, die diese Zeit nur noch aus den Schulbüchern kennt und kaum noch oder keine Gelegenheit mehr hat, mit damaligen Zeitzeugen zu sprechen. In den Schulen wird das Fach Geschichte laufend abgewertet. Allgemeinwissen über die Schoah mag noch vermittelt werden, eine Vertiefung in die Rolle der Schweiz hängt stark von den einzelnen Lehrkräften ab. Erinnerungsarbeit ist jedoch wichtig, wenn nicht im Schulzimmer, dann anderen Formen. Der Antisemitismus ist nicht ausgestorben, man denke an die zahlreichen Anschläge in den letzten Jahren im Ausland und in Biel dieses Jahr. Jeder solche Angriff setzt Menschen einer bestimmten Gruppe herab und ist damit auch ein Angriff auf Demokratie und Menschenrechte.
Derzeit ist der Bund beauftragt, ein offizielles Memorial für die Opfer des Nationalsozialismus zu errichten, das mit dem Rückblick in die Geschichte das Bewusstsein für die Bedeutung der Menschenrechte von heute fördern soll. Zu hoffen ist, dass es diesmal kein toter Buchstabe bleibt wie damals die Demokratieschutzverordnung von 1938. Ältere wie Jüngere sollen sich bewusst sein, dass jederzeit wieder Synagogen, Moscheen, Tempel und Bücher brennen könnten, wenn der rechtsstaatlichen Ordnung nicht Sorge getragen wird. Immer und überall gilt: Nie wieder!