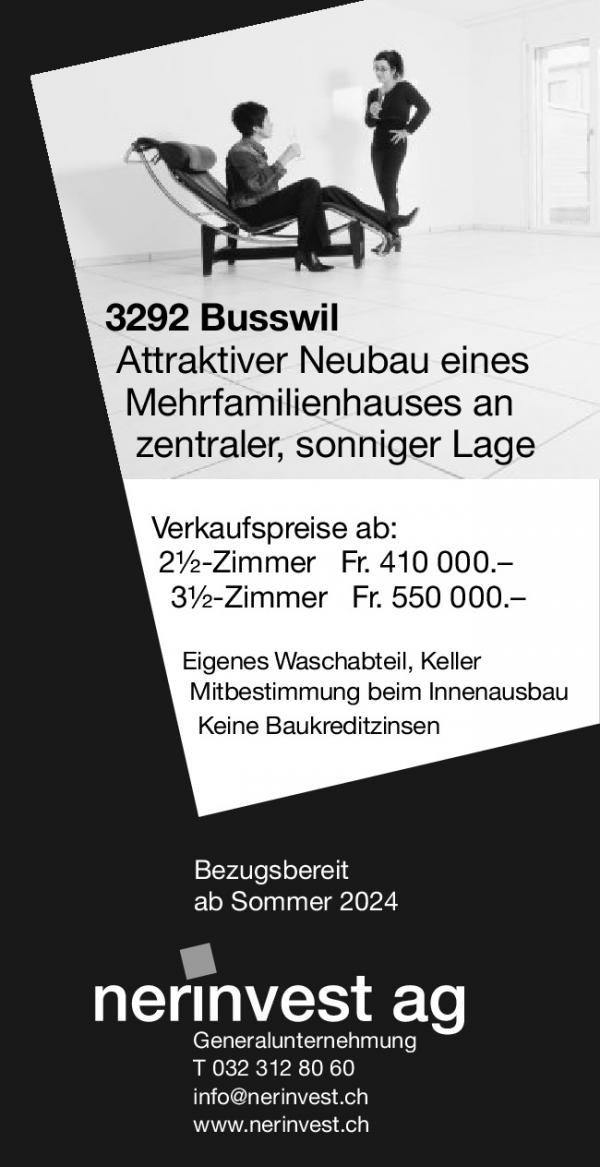- Dossier
Stefan Leimer
Sandstrand, das Rauschen der Wellen, Sonne, warme Temperaturen und idealerweise noch ein paar Palmen. Das Meer ist für viele Menschen ein Ort der Sehnsucht.
Ich kann mich noch gut erinnern, als in den Sommerferien einige meiner Schulfreunde mit ihren Eltern ans Meer fuhren. Meist nach Italien, von wo sie dann rechtzeitig zum Schulbeginn braun gebrannt wieder zurückkamen. Wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass ich eines Tages am Meer leben werde ... ich hätte ihn ausgelacht.
Aber dann zog es mich nach New York. Zugegeben, New York verbindet man nicht unbedingt mit «Leben am Meer». Broadway, 5th Avenue, Empire State Building und viele andere Sehenswürdigkeiten verbindet man mit New York City, der Stadt, die nie schläft. Auch ich hatte andere Prioritäten als das Meer, das sich quasi vor der Haustür befand, zu erkunden. So führten wir eine Fernbeziehung, das Meer und ich. Denn abgesehen von ein paar Spaziergängen entlang der Atlantikküste in Long Island sahen wir uns praktisch nie.
Dann trennten sich unsere Wege
Erst in den darauffolgenden fünf Jahren an der Côte d’Azur wurde aus unserer Beziehung etwas Ernstes. Vom Schlafzimmer aus, auf dem Arbeitsweg und in der Freizeit, wir sahen uns praktisch jeden Tag. Das Meer wurde zu meinem ständigen Begleiter, immer an meiner Seite. Wenn ich Lust hatte, konnte ich jederzeit in sein erquickendes Nass eintauchen, mich im warmen Sand räkeln oder einfach nur am Strand sitzend seinen Wellen zuhören. Dann haben sich unsere Wege getrennt und wir haben uns aus den Augen verloren.
Erst jetzt, knapp 30 Jahre später, sind wir uns wieder begegnet. In Andenes, einem kleinen Fischerort auf den norwegischen Vesterålen, wo ich bei Wal Safari Andenes als Tour Guide arbeite. Lange haben wir uns nicht gesehen und naturgemäss haben wir uns beide stark verändert. Nur zögerlich kommen wir uns näher, müssen uns wieder neu kennenlernen. Das Meer aber zeigt mir oft die kalte Schulter, weist mich zurück.
Romantik in Gummistiefeln
Körperkontakt ist kaum erwünscht. Die Wassertemperaturen steigen auch im Sommer nur selten über 12 Grad. Badeausflüge überlasse ich den Einheimischen oder Touristen, die sich darauf etwas einbilden. Obwohl die Sandstrände teilweise verlockend sind. Heller Sand und sanft ins Meer abfallendes, türkisblaues Wasser. Zumindest bei schönem Wetter. Aber das Nordmeer hat viele Gesichter. Es ändert immer wieder sein Aussehen, seine Farbe, seinen Geruch und verliert manchmal gar den letzten Rest von Anstand.
Die Tage, an denen wir eine spiegelglatte See haben, kann man an einer Hand abzählen. Aber dann zeigt sich das Meer von seiner schönsten Seite und lässt im – wahrsten Sinne des Wortes – tief blicken. Das Wasser ist kristallklar, und von den Felsen aus kann man den sandigen Grund in ein paar Metern Tiefe erkennen.
Je nach Saison, Licht und Tageszeit wechselt das Meer die Farbe von schwarz über silber zu grünblau. Jetzt, im Winter, zeigt es insbesondere seine fifty shades of grey. Bei Sonnenauf- und -untergängen, die nahtlos miteinander verschmelzen, verführt es mich zu Spaziergängen an seinen Gestaden. Zart umsäuseln die Wellen meine Füsse. Die stecken allerdings in zwei Paar Wollsocken und Gummistiefeln mit dicken Sohlen. Aber selbst in diesen Momenten kann man dem Meer nicht vorbehaltlos vertrauen.
Bei Temperaturen im einstelligen Minusbereich überfriert der feine Wasserfilm, der zurückbleibt, wenn die Ebbe in die Flut übergeht. Mehr als ein Mal habe ich die Kontrolle über mein Gleichgewicht verloren. Im fahlen Dämmerlicht kann man diese spiegelglatten Abschnitte nicht immer ausmachen.
Ist es über mehrere Tage windstill, friert gar das salzhaltige Meerwasser. Bis zu mehrere Zentimeter dick kann diese Eisschicht in ruhigen Buchten werden. Kommt Sturm auf, zerbrechen die Eisplatten und schieben sich zu bizarren Eisskulpturen übereinander. Ein Traum für jeden Fotografen, denn zusammen mit dem flachen Licht ergeben sich wunderbare Motive.
Das Meer ist nicht nachtragend
So bezaubernd das Meer sein kann ... Wenn es mit Wind und Wetter einen Pakt eingeht, wird es zu einer boshaften Kreatur, die nichts und niemanden in seiner Nähe duldet. Aufgewühlt lässt es seine Wellen gegen die Küste donnern, und die reissen alles mit, was sich ihnen in den Weg stellt. Selbst in sicherer Entfernung wird man noch mit salziger Gischt bespuckt.
Das Meer aber ist nicht nachtragend. Als hätten wir nie Streit gehabt, präsentiert es sich am nächsten Tag. Der Sturm ist weitergezogen, der Himmel zeigt sich in versöhnlichem Blau, und nur die grossen Wellen erinnern an das Tief der letzten Tage. Nun schlägt die Stunde der Surfer. Im Süden der Insel bietet eine kleine Surfschule den Unerschrockenen die Möglichkeit, ihre ersten Erfahrungen im arktischen Nordmeer zu machen. Die verschneiten Berge bieten einen fotogenen Hintergrund, und mit etwas Glück zeigen sich am Horizont Orcas und sorgen für zusätzlichen Nervenkitzel. Auch wenn von diesen intelligenten Delphinen für uns Menschen keine Gefahr ausgeht.
Im Gegensatz zu früher interessiere ich mich heute auch für die inneren Werte des Meeres, mache mir Sorgen um seine Zukunft. Es war nicht nur Ursprung des Lebens, sondern ist heute noch wichtige Grundlage für das Leben auf der Erde. Die unaufhörliche Ausbeutung durch die Menschheit hat das Meer an den Rand eines Kollapses gebracht. Der Klimawandel und weltweite Verschmutzung geben ihm nun den Rest.
Das Meer erwärmt sich laufend, es geht ihm schlecht und es leidet an Fieberschüben. Scheinen die absoluten Zahlen der Erwärmung gering, für das Meer haben sie enorme Auswirkungen. Die Chinesische Akademie der Wissenschaften vergleicht die Energie, die in den letzten 25 Jahren als Wärme in die Meere gelangt ist, mit der Kraft von 3,6 Milliarden Hiroshima-Atombomben. Gerne möchte ich ihm helfen, dem Meer, fühle mich dabei aber wie der Tropfen auf den heissen Stein. Oder bin ich ein Teil des heissen Steines …?
Das Meer kann sich wieder erholen. Aber nur, wenn wir es schaffen, den CO-Ausstoss kurzfristig extrem zu reduzieren. Aber selbst dann würde das Meer Tausende von Jahren brauchen, um wieder gesund zu werden.