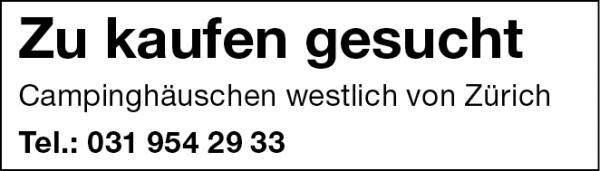Charles Linsmayer
Am 6. Juli 1941 hielt der Basler Theologieprofessor Karl Barth vor der Landsgemeinde des Bundes evangelischer Jugend der Schweiz in Gwatt unter dem Titel «Im Namen Gottes, des Allmächtigen» eine Rede, die von der Zensur sofort verboten wurde, als sie zehn Tage später im Druck erschien. Nicht, weil der Redner bessere Arbeiterlöhne oder die Aufnahme eines Sozialdemokraten in den Bundesrat forderte, sondern weil er die Zensur scharf angriff, die Schweizer Asylpolitik als «weder grosszügig noch weitsichtig» beurteilte, die Wirtschaft als «Kriegshelferin» Deutschlands denunzierte und vor allem ganz klar zu sagen wagte, was in Deutschland passierte und was der Grund sei, dass die Schweiz nicht «Gesinnungsneutralität» pflegen dürfe, sondern sich auf die Seite der Alliierten zu stellen habe. Im Zensurbefehl vom 29. Juli 1941 hiess es jedenfalls: «Gleich wie in seinen früheren Schriften benützt Prof. Barth die theologische Umrahmung, um anhand des Spiegels, den er den Eidgenossen vor Augen hält, gegen einen fremden Staat in einer Weise Stellung zu nehmen, die geeignet ist, die korrekten Beziehungen der Schweiz zu diesem Staat zu stören und ihre neutrale Haltung zu gefährden.»
Wer war dieser Mann, der das offiziell verordnete Schweigen über die Verbrechen des Faschismus und die sträfliche Liebedienerei gegenüber Hitler und Konsorten brach und all das offen ansprach, was aus opportunistischen Gründen tabuisiert wurde?
Theologischer Erneuerer
Als Sohn eines Theologieprofessors in Bern aufgewachsen, machte der Basler Theologe mit Jahrgang 1886 erstmals von sich reden, als er sich 1911 bis 1921 als Pfarrer in Safenwil dem Sozialismus näherte und die soziale Frage auf ganz neue Weise theologisch anpackte. 1919 stellte er sich mit seinem «Römerbrief» gegen den verstaubten deutschen Protestantismus und begründete unter der Parole «Gott ist Gott» jene dialektische Spielform der Theologie, die in Gott einen «grundsätzlich Anderen» sieht und allein noch der biblischen Offenbarung vertraut. 35-jährig wurde Barth 1921 Professor in Göttingen, 1925 kam er an die Universität Münster, 1930 berief man ihn auf den Bonner Lehrstuhl für Dogmatik.
Barth hatte eben mit seinem theologischen Hauptwerk, der «Dogmatik», begonnen – einer fundamentalen Leistung des modernen Protestantismus, die am Ende zwölf Bände umfassen sollte –, als 1933 Hitler an die Macht kam und der vermeintlich weltfremde Professor sich zu einem seiner brillantesten Gegner entwickelte. «An der Wahrheit des Satzes, dass Gott Einer ist, wird das Dritte Reich Adolf Hitlers zuschanden werden», prophezeite er furchtlos im «Dogmatik»-Band II, und bald einmal wurde, was der Schweizer verkündete, zum theologischen Rüstzeug für Hitlergegner wie Martin Niemöller oder Dietrich Bonhoeffer.
«Wir haben einen anderen Glauben, wir haben einen anderen Geist, wir haben einen anderen Gott», rief er im Januar 1934 den anpassungswilligen deutschen Christen zu, mit der «Barmer Erklärung» stellte er sich an die Spitze der oppositionellen Bekennenden Kirche, und Stationen wie die Suspension von seiner Bonner Professur und die zwangsweise Versetzung in den Ruhestand waren nur zu erwartende Folgen seiner konsequenten Nazi-Gegnerschaft, die ihn schliesslich im Juni 1935 auch die Professur in Basel nur mit der erklärten Absicht annehmen liess, auch künftig keineswegs schweigen zu wollen.
Das Mittel der «Offenen Briefe»
Barth entwickelte in der Zeit des Faschismus eine Methode der Verkündigung zur Perfektion, die er schon 1909, als junger Pfarrer, erstmals benützt hatte: die Verbreitung von Stellungnahmen mittels Offener Briefe, die an eine Gruppe von Gläubigen oder an Einzelpersonen gerichtet waren, die den Text dann aufgefordert oder unaufgefordert publik machten.
Ein erster spektakulärer Paukenschlag war der Offene Brief, den Barth am 19. September 1938 an den Prager Theologen Josef L. Hromàdka schrieb und der am 25. September 1938 in der «Prager Presse» veröffentlicht wurde. Wenige Tage zuvor war zwischen Chamberlain und Hitler das «Münchner Abkommen» unterzeichnet worden, das nach dem «Anschluss» Österreichs dem «Führer» auch noch die Sudetenlande zugesprochen und die Souveränität der Tschechoslowakei auf Kosten des geretteten Friedens mit Füssen getreten hatte. In offenem Gegensatz zum überall zur Schau getragenen Opportunismus Hitler gegenüber sprach Barth den Tschechen ein Recht auf Verteidigung zu, gab seiner Hoffnung, die tschechische Regierung werde das Diktat von München nicht hinnehmen, offen Ausdruck und liess seinen Appell in den Worten gipfeln: «Jeder tschechische Soldat, der dann streitet und leidet, wird es auch für uns – und ich sage es heute ohne Vorbehalt: er wird es auch für die Kirche Jesu Christi tun ...»
Barths mutiger Brief, der in ganz Europa Verbreitung fand, brachte das deutsche Propagandaministerium so sehr in Rage, dass es grosse Teile davon selbst in einem Hetzartikel verbreitete. Sogar die Bekennende Kirche distanzierte sich, und auch das Kirchenblatt für die reformierte Schweiz protestierte lauthals gegen den Brief, der in der Tschechoslowakei bis zum Ende Krieges eine moralische Stütze für den inneren Widerstand blieb.
Wider den Landi-Geist
Aber nicht nur im Ausland, auch in der Schweiz selbst machte Barth schon vor Kriegsbeginn mit seiner unabhängigen Haltung von sich reden. So ging er im Mai 1939, mitten in der nationalen Begeisterung für die Landi 39, in einem Offenen Brief mit der geistigen Landesverteidigung ins Gericht und legte deren Verwandtschaft mit dem faschistischen Pathos gnadenlos offen. «Sind wir der ‹schweizerischen Kultur› treu», fragte er sibyllinisch, «wenn wir ganz bestimmten ausländischen Vorbildern folgend, nun ebenfalls ‹das nationale Interesse in den Mittelpunkt aller Bestrebungen stellen›, wenn wir nun ebenfalls einen Mythus, den ‹Mythus der schweizerischen Freiheit› uns anschaffen und pflegen, ... wenn wir nebenbei nun ebenfalls in Antisemitismus zu machen beginnen, wenn wir nun ebenfalls Kultur mit Heimatschutz verwechseln?»
Als der Krieg begann und die Schweiz sich nicht nur politische, sondern auch Gesinnungsneutralität verschrieb, war Barth wiederum praktisch der Einzige, der seine offene Sprache beibehielt. Im Dezember 1939, in einem Weihnachtsbrief nach Frankreich, ermutigte er die Franzosen nicht nur mit der Erklärung, dass «jeder Christ, der die letzten Jahre mit offenen Augen und offenen Ohren miterlebt hat», zum Krieg gegen Hitler «Ja und Amen» sagen müsse, sondern gab, was die Neutralität der Schweiz betraf, auch zu Protokoll, dass dieses Abseitsstehen natürlich nur ein vorläufiges sein könne: «Auch wir im ‹Neutralen› sind insofern gar nicht neutral, als wir sehr genau wissen, dass die Anstrengungen und Opfer dieses Krieges auch um deswillen nötig sind, was uns zum Leben unentbehrlicher ist als das Leben selber. Unsere französischen und englischen, aber auch unsere deutschen Freunde sollen es ruhig hören, dass wir denen dankbar sind, die es, entsprechend ihrer geschichtlichen Stellung und Verantwortung, übernommen haben, diesen Krieg gegen Hitler zu führen.»
Kampf im In- und Ausland
Wie anhand seiner Rede von 1941 angetönt, kämpfte Barth auch in der Schweiz selbst gegen Chauvinismus und Anpasserei, am spektakulärsten aber waren weiterhin seine jeweils auf abenteuerlichem Weg an den Bestimmungsort geschmuggelten Briefe an die Christen in besetzten oder Krieg führenden Ländern. Etwa jener vom Herbst 1941 an den Erzbischof von Canterbury, der von einem «von Gott nicht nur zugelassenen, sondern gebotenen Krieg» sprach und für den der Bundesrat sofort ein völliges Publikations- und Kommentierungsverbot erliess.
Nachdem Barth im Dezember 1941 über den Sender BBC einen Weihnachtsbrief «an die Christen in Deutschland» hatte verlesen lassen, in dem «das Schreckliche, was eure und unsere Brüder und Schwestern aus Israel in Deutschland durchzumachen haben», beim Namen genannt wurde, und nachdem er im Frühjahr 1942 – wiederum über die BBC – auch eine Botschaft nach Norwegen gesandt hatte, die vom «erweckenden, ermutigenden und tröstlichen Beispiel» des norwegischen Widerstands «für uns Christen in allen Ländern» sprach, zapfte die Bundesanwaltschaft Barths Telefon an, stiess aber bloss auf nichtssagende Harmlosigkeiten.
Im Herbst 1942 liess er durch Hebe Kohlbrugge, die 1991 dafür in Prag einen Ehrendoktorhut erhielt, seine Botschaft «An meine Freunde in den Niederlanden» ins deutsch besetzte Holland bringen und forderte darin die holländischen Christen nicht nur dazu auf, ihre Gottesdienste weiterhin mit einem Gebet für die (exilierte) Königin Wilhelmina beginnen zu lassen, sondern zugleich auch dazu, die Aktivitäten des Maquis als «christlich geboten» aktiv zu unterstützen. Nicht nur die Bundesräte, die Barth gerne als «Schlottertanten» titulierte, auch breite Teile der eher konservativen Bevölkerung und sogar Exponenten der reformierten Kirche standen seinen Aktivitäten offen feindselig gegenüber.
So bezichtigte, als sein Brief an die französischen Christen bekannt wurde, am 24. Januar 1940 ein Pfarrer W.U. Hämmerli im «Schweizer Bauer» den «sattsam bekannten Theologenbonzen» der «brenzlichen Überheblichkeit». «Wir meinten bisher», hiess es dann, «der Bundesrat bestimme unsere Aussenpolitik nach dem Geist unserer Verfassung, nach dem Willen des Parlaments und der überwiegenden Mehrheit unseres Volkes. Weit gefehlt!»
Aber auch nach 1945, als die Zensur abgeschafft war, wurde Karl Barth für seinen Einsatz für eine bessere Schweiz nicht etwa gelobt und gefeiert, sondern geriet, obwohl er nie Mitglied einer Partei gewesen war, schon bald ins Visier der eidgenössischen Kommunistenhasser und McCarthy-Mitläufer und avancierte für viele zum «Staatfeind Nr.1», den vor allem der bernische Erziehungsdirektor und spätere Bundesrat Markus Feldmann auf gehässige Weise an den Pranger stellte – etwa darum, weil er im kommunistischen «Vorwärts» lobend erwähnt worden war.
Vielsagend ist auch, dass Edgar Bonjour 1970 in seiner «Neutralitätsgeschichte» das politische Wirken von Karl Barth praktisch vollständig unterschlug, obwohl dieser inzwischen längst weltweit als einer der bedeutendsten Kirchenlehrer des Protestantismus im 20. Jahrhundert Anerkennung gefunden hatte.
Liebe als Wohltat und Verurteilung
Fragt man sich, woher der einer noblen Familie entstammende Karl Barth, dessen Vorfahren väterlicher- wie mütterlicherseits Pfarrherren waren, in einer Zeit, als die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung eine unmenschliche Flüchtlingspolitik und eine kaum verhohlene Anbiederung an das nationalsozialistische Deutschland als alternativlos akzeptierte, die Kraft zum Widerstand nahm, stösst man auf ein Phänomen, das lange tabuisiert wurde. «Es kann wohl sein, dass sich in meiner Theologie ein Element der Erfahrung findet, oder besser gesagt, ein Element von gelebtem Leben», schrieb Barth 1947 dem Neuenburger Pfarrer William Lachat. «Es wurde mir auf eine konkrete Art verboten, der Legalist zu werden, der ich unter anderen Umständen hätte werden können.»
Und als diese Erfahrung brachte er eine Tatsache ins Spiel, «welche die grösste irdische Wohltat ist, die mir in meinem Leben geschenkt wurde, aber zugleich auch das strengste Urteil wider mein irdisches Leben». Gemeint war die von 1925 bis zu seinem Tode 1968 dauernde Beziehung zur 13 Jahre jüngeren Bayrischen Generalstochter Charlotte von Kirschbaum, die von den Zeitungen noch 1998 als seine «wissenschaftlich-platonische Lebensgefährtin» bezeichnet wurde und von der wir seit der Veröffentlichung ihrer Korrespondenz im Jahre 2008 wissen, dass sie nicht nur seine engste Mitarbeiterin, sondern auch seine Geliebte war. Eine Assistentin und Geliebte, die seit 1929 mit Barth in der gleichen Wohnung mit seiner Ehefrau Nelly und seinen fünf Kindern lebte und inzwischen auch mit all diesen zusammen im Familiengrab im Basler Hörnli-Friedhof ruht.
«Sehnsucht, die Ewigkeit zu finden»
1947 schrieb Barth: «Frl. von Kirschbaum und ich lieben uns von Anfang an, und da wir ein bisschen älter geworden sind, lieben wir uns immer noch.» Und es muss von dieser Liebe, die «wie ein Elementarereignis» über ihn gekommen war, zum einen ein unerhört starkes erotisches Fluidum auf den Menschen Karl Barth und zum andern ein kaum wirklich abzuschätzender Einfluss auf den Theologen ausgegangen sein. Bei der Arbeit war die autodidaktisch zur Theologin gewordene frühere Krankenschwester nicht nur seine «Hilfe», sondern auch die ordnende Instanz – «Du hast die Eigenschaften eines umsichtigen Generalstabschefs», schrieb er ihr einmal. Und Fachleute sprechen inzwischen davon, dass Charlotte von Kirschbaum einen erheblichen Anteil an seiner «Dogmatik» gehabt habe.
Was aber jene «irdische Liebe» betrifft, welche die beiden, wie Barth schrieb, «unter anderen Umständen als Mann und Frau zusammengeführt hätte», so zeigen nicht zuletzt die Schuldgefühle seiner Frau gegenüber, wie intensiv sie gewesen sein muss. «Ich bin das Karnickel, das an allem schuld ist und das nun mit Recht so gezüchtigt wird», bekannte er einmal.
Jedenfalls muss diese Liebesbeziehung, welche die beiden «in der Sehnsucht, ihre Ewigkeit zu finden» verband und in der gemeinsamen theologischen Bemühung «einen festen Boden» bekam, Karl Barth, wie er ja selber sagt, vom Legalisten zum Nonkonformisten gemacht haben und ihm einen guten Teil jener Kraft geschenkt haben, die nötig war, um gegen die offizielle Politik von Armee, Regierung und Volk jene Haltung einzunehmen und der ganzen Welt gegenüber auf mutige und intelligente Weise offenzulegen, wie sie der auf ihre humane Tradition so stolzen Schweiz als einzige angemessen gewesen wäre.
Wenn die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg für Deutschland durch eine Lichtgestalt wie Dietrich Bonhoeffer etwas aufgehellt wird, so ist es für die Schweiz Karl Barth, der dem ansonsten düsteren Bild eines Landes, das mitleidlos einem «sacro egoismo» frönte, etwas gegenüberstellte, auf das wir auch 75 Jahre später noch stolz sein dürfen.
Info: Für diesen Text waren wichtig: Karl Barth, «Offene Briefe», in zwei Bänden herausgegeben von Diether Koch, Theologischer Verlag, Zürich 2001; «Karl Barth – Charlotte von Kirschbaum», Briefwechsel, Band I, herausgegeben von Rolf-Joachim Erler, Theologischer Verlag, Zürich 2008; Peter Zocher, «Karl Barth – Bilder und Dokumente aus seinem Leben», Theologischer Verlag, Zürich 2018. Bis auf das «Spiegel»-Bild auf der Titelseite wurden die Bilder dieses Beitrags freundlicherweise vom Karl Barth-Archiv, Basel, zur Verfügung gestellt.