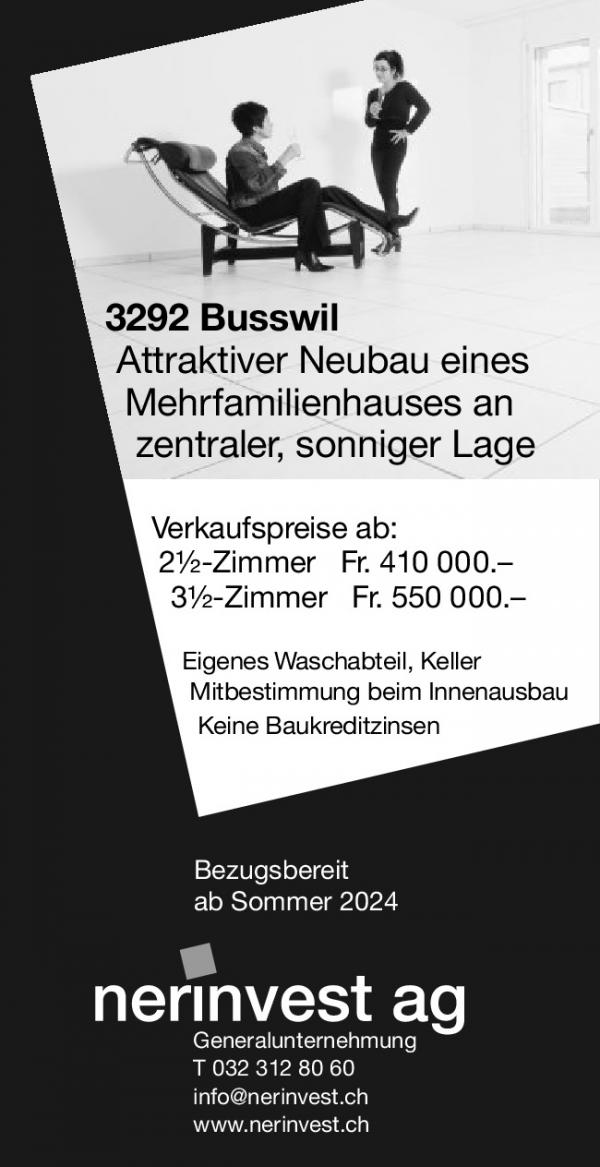Michael Schneider
«Schluss mit reden, es gibt tausend Gründe zu handeln», in einem anderen. Am Dienstag hat der 45-Jährige gestanden, den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke erschossen zu haben. Als Motiv nannte er seinen Vernehmern, dass sich Lübcke für eine liberale Flüchtlingspolitik einsetzte.
Für Deutschland ist der Mord an Lübcke eine Zäsur: Zwar ist rechter Terror seit Langem ein Problem, man denke nur an die Mordserie der Terrorzelle NSU. Gezielte Attentate Rechtsextremer auf gewählte Amtsträger jedoch, das gab es zuletzt zur Zeit der Weimarer Republik. Nach dem Geständnis konzentrierte sich die politische Debatte zunächst darauf, ob der Beschuldigte, wie er behauptet, allein handelte oder Teil eines rechtsextremen Netzwerks war. Und auf die Frage, warum ihn die Sicherheitsbehörden nicht beobachteten. Lübckes mutmasslicher Mörder ist wegen politisch motivierter Gewalttaten mehrfach vorbestraft. Mehr als 20 Jahre lang verkehrte er in der hessischen Neonazi-Szene.
Politisch ebenso relevant ist eine andere Frage: Gibt es einen Zusammenhang mit der Verrohung des politischen Diskurses, die in Deutschland seit Beginn der Flüchtlingskrise 2015 zu beobachten ist? Eine menschenfeindliche Sprache sei früher der Nährboden von Gewalt gewesen, und sie sei es heute noch, sagte dazu der Vorsitzende des Bundestages, Wolfgang Schäuble. Wer diesen Boden dünge, mache sich mitschuldig. Dabei geht es einerseits um die Hetzkampagne, der Lübcke ausgesetzt war, seit er sich 2015 an einer Informationsveranstaltung zu einer geplanten Flüchtlingsunterkunft gegen Beschimpfungen durch Fremdenfeinde gewehrt hatte. Lübcke erhielt Morddrohungen, stand zwischenzeitlich unter Polizeischutz. Andererseits geht es um den Ton in der Diskussion um die Zuwanderung allgemein. Mit der Entgrenzung der Sprache habe die Alternative für Deutschland (AfD) der Entgrenzung der Gewalt den Weg bereitet, schrieb kürzlich Peter Tauber, der frühere Generalsekretär der CDU. Die AfD weist den Vorwurf entschieden zurück. Taubers Argument ist heikel. Denn von Anstiftung, von offenen Aufrufen zur Gewalt, von einer juristischen Schuld kann in diesem Zusammenhang keine Rede sein.
Die Debatte um die verrohte Rhetorik der AfD wird dennoch zu führen sein. Unbestreitbar ist, dass die Partei Politik nach dem Freund-Feind-Schema betreibt. Exemplarisch dafür ist ein Auftritt des Thüringer AfD-Politikers Björn Höcke vor gut einem Jahr. Es stehe schlimm um Deutschland, sagte Höcke bei einer Veranstaltung im Ort Mödlareuth an der Grenze Thüringens zu Bayern. Die politischen Eliten bestünden «nur noch aus Vaterlandsverrätern». Wer so spricht, sieht Andersdenkende nicht als politische Gegner, er erklärt sie zu Feinden. Verrätern kann man nicht zubilligen, sie handelten mit guten Absichten, auch wenn man in einer Sache anderer Meinung ist. Mit Verrätern Argumente auszutauschen, bringt nichts. Kein Wunder, erklärten hochrangige AfD-Vertreter nach dem erstmaligen Einzug der Partei in den Bundestag 2017, sie wollten die Regierung jagen. Verräter verdienen keine Wertschätzung. Da erstaunt es nicht, wenn die AfD auf Facebook Kanzlerin Angela Merkel als «ins linksgrüne Lager abgedriftete Kanzlerdarstellerin» betitelt, und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer als «Meinungsdiktatorin». Schwerwiegender als diese Beleidigungen ist: Verrätern traut man das Schlimmste zu. Auf dem Video von Höckes Rede ist zu hören, wie seine Zuhörer «Widerstand, Widerstand!» skandieren. Als lebten sie nicht in einem demokratischen Rechtsstaat, sondern in einer Diktatur.
Ob dieses aufgeheizte Klima den mutmasslichen Attentäter Stephan E. beeinflusste, wird allenfalls der Prozess gegen ihn klären können. Für derartige Diagnosen ist es zu früh. Aber schon jetzt muss klar sein, dass Demokratie ohne Respekt nicht zu haben ist. Wer Spitzenpolitiker pauschal als Verräter betitelt, macht den Hass auf sie salonfähig. Wer von der Demokratie spricht, als wäre sie ein Unrechtsregime, liefert im schlimmsten Fall jenen einen Vorwand, die aus Hass zur Tat schreiten.