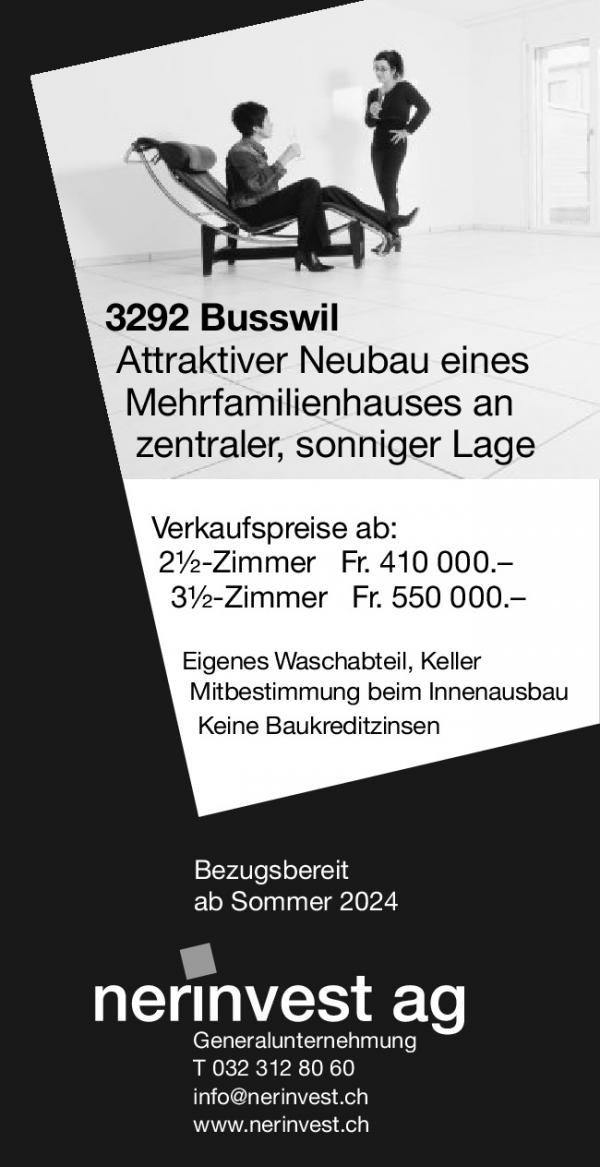Regula Gilg
Anita*, eine zierliche und introvertierte Frau, leidet zunehmend unter Stress und Selbstwertproblemen. Sie ist im ersten Lehrjahr an einer technischen Fachschule. Die Aufnahmeprüfung hat sie problemlos bestanden, und am Sachgebiet ist sie interessiert. Dass sie in der Ausbildungsklasse die einzige Frau ist, kümmert sie bisher wenig.
Doch mit der Konzentration hat sie Mühe, sie schweift immer wieder ab und muss zu Hause viel aufarbeiten. Sie lernt oft bis in die Nacht hinein und hat anschliessend Mühe, einzuschlafen: Ihre Gedanken kreisen um ungelöste Aufgaben, Versagensängste quälen sie.
Von einer Kollegin hört sie über die Möglichkeit eines Nachteilsausgleichs, dank dem eine Ausbildung den individuellen Bedürfnissen angepasst wird. Dazu aber brauche es eine neuropsychologische Abklärung. Deshalb gelangt Anita an die Psychotherapeutin.
Alles wird zum Problem
Was ist ein Nachteilausgleich?Die Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern schreibt dazu: «Menschen mit einer Behinderung können in der beruflichen Grundbildung Benachteiligungen erfahren, wenn ihren besonderen Bedürfnissen nicht Rechnung getragen wird.»
Unter dem Begriff Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderung werden, so die kantonale Direktion weiter, «spezifische Massnahmen verstanden, die zum Ziel haben, behinderungsbedingte Nachteile auszugleichen, Diskriminierungen zu verhindern und individuelle Anpassungen zu ermöglichen». Voraussetzung zur Gewährung eines Nachteilsausgleichs sind laut der Direktion dem Beruf entsprechende kognitive und fachliche Kompetenzen.
Zudem muss die Behinderung von einer anerkannten Fachstelle, zum Beispiel der Neuropsychologie, schriftlich bestätigt werden.
Anita ist verunsichert, ob sie die Ausbildung schaffen kann. Sie sieht einen riesigen Berg vor sich. Die Lehre dauert vier Jahre, und sie steht erst am Anfang, hat bereits viele Absenzen und in verschiedenen schulischen Fächern ungenügende Noten.
Zudem ist sie älter als ihre meisten Kolleginnen und Kollegen; nach dem Schulabbruch hat sie eine Handelsschule gemacht und ein Jahr auf dem Beruf gearbeitet.
Auch fühlt sie sich unwohl am Arbeitsort. Ihr strenger Chef, harsch und oftmals unbeherrscht im Umgang, stellte sie schon wegen Langsamkeit und wegen ihrer Begriffsstutzigkeit bloss. Dazu sei er distanzlos, trete ihr beim Vorzeigen oder Einrichten am Arbeitsplatz zu nahe.
Weiter befürchtet Anita, neben der Ausbildung keine Zeit zu haben für ihren Bekanntenkreis. Sie erzählt, dass sie sich seit dem Lehrbeginn mehr und mehr zurückgezogen habe.
Im ersten Gespräch wird aber auch deutlich, dass Anita Interesse und Fähigkeiten hat für logisches mathematisches und kreatives Denken. Bei Denksportaufgaben sei sie hartnäckig und gelange oft zu unkonventionellen Lösungswegen. Aber ihre Versagensängste und ihre Langsamkeit stünden ihr im Wege: sie brauche mehr Zeit für praktische Arbeiten, insbesondere in Prüfungssituationen. Eigentlich möchte sie die Ausbildung schaffen.
Es geht gerade ums Gegenteil
Anita ist bereit, sich neuropsychologisch abklären zu lassen.
Die Psychotherapeutin meldet sie an. In der Abklärung wird ein Aufmerksamkeitsdefizit bestätigt und auch verlangsamte Denk- und Handlungsprozesse, letztere eher zurückzuführen auf den momentanen depressiven Erschöpfungszustand. Das Gesuch für Nachteilsausgleich wird von der Fachschule gutgeheissen. Anita nimmt allen Mut zusammen, um mit dem Chef zu reden.
Im Gespräch realisiert sie, dass der Chef ihr eine Chance geben will, er sehe, dass sie fähig sei, zwar etwas langsam, aber begabt. Zuerst ist er skeptisch, dass Anita durch den Nachteilsausgleich in eine stigmatisierende Rolle gegenüber ihren Kolleginnen und Kollegen gerate.
Doch ihr Lehrer entgegnet, gerade ums Gegenteil gehe es: den Blick weglenken von Defizit, Handicap oder Behinderung, hin zur vergleichbaren Qualität. In der Folge bekommt Anita mehr Zeit für Tests und auch bei praktischen Aufgaben.
In der Verhaltenstherapie geht es um Selbstvertrauen und innere Sicherheit. Schwierige Situationen mit Vorgesetzten und Kollegen werden im Rollenspiel geübt: Anita lernt, sich besser abzugrenzen und durchzusetzen.
So sagt sie dem Chef, dass es sie störe, wenn er ihr zu nahekomme. Und sie hält sich mehr dafür, Kolleginnen zu fragen, wenn sie etwas nicht begriffen hat. Auch geht es um besser strukturiertes Arbeitsverhalten, zum Beispiel täglich an den Aufgaben zu schaffen, Pausen einzuschalten und rechtzeitig mit der Testvorbereitung zu beginnen.
Mehr Offenheit
Anita erlebt, dass sie von den Kollegen akzeptiert wird, sie sind respektvoll ihr gegenüber und hilfsbereit. Sie macht die Erfahrung, dass sie mit mehr Offenheit und Eigeninitiative etwas bewirken kann, und dass sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen eigentlich vieles verbindet.
Sie schliesst sich einer Kollegin der oberen Klasse an, zu der sich eine Freundschaft entwickelt. Die neu gewonnene Freundin schenkt ihr zum Geburtstag das Lied «We are», in dem die Erkenntnis zum Ausdruck kommt: Wir unterscheiden uns in kleinen Dingen, in grossen sind wir gleich. Wir sind uns ähnlicher, meine Freunde und ich, als unähnlich.
Anita hat sich gut integriert in ihrer Schulklasse und im Arbeitsteam. Entgegen ihren Befürchtungen fand sie neue Freundschaften. Schulisch konnte sie aufholen, in Fachkunde war sie kürzlich Klassenbeste. Im Arbeitsbereich ist sie dank erlangter Vertrautheit rascher geworden und kann mit den Kollegen Schritt halten. Ihrer beruflichen und sozialen Zukunft sieht sie zuversichtlich entgegen.
*Name geändert