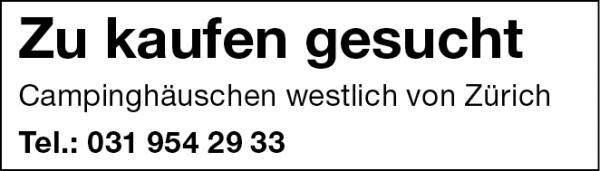Die Kantonspolizei Bern (Kapo) hat Grund, sich auf die Schultern zu klopfen. Rund 85 Prozent der Bernerinnen und Berner sind zufrieden mit deren Arbeit. Dies geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Bevölkerungsbefragung durch die Polizei hervor, an der sich 5500 Personen beteiligten.
Dennoch gibt es einen Bereich, bei dem die Polizei schlecht wegkommt. Dieser betrifft Opfer eines sexuellen Übergriffs – bei der Befragung waren das 16 Personen. Von ihnen gab ein Viertel an, «unzufrieden» zu sein, wie die Polizei mit dem Vorfall umgegangen ist. Ein weiteres Viertel ist nur «mittelmässig» zufrieden.
Die Kantonspolizei hält deshalb in ihrem Fazit fest, dass diesbezüglich «weitere Sensibilisierungsmassnahmen notwendig sind». Der neue Polizeikommandant Christian Brenzikofer verwies an der Medienkonferenz auch auf die bestehenden Angebote. Etwa die Beteiligung am interdisziplinären «Berner Modell». Dabei geht es um die Vernetzung von Polizei, Justiz, Opferhilfe-Organisationen und medizinischen Stellen.
Zudem verfüge die Kapo Bern über ein Frauenpikett, um sicherzustellen, dass weibliche Opfer von einer Frau befragt werden könnten. Dabei handelt es sich nicht um Psychologinnen, sondern um Fahnderinnen.
Die tiefe Zufriedenheitsrate rührt laut Brenzikofer auch daher, dass die Polizeiarbeit gewissen Zwängen unterliege. «Die Polizei hat in erster Linie zu ermitteln, da müssen eben manchmal auch kritische und unangenehme Fragen gestellt werden.» Dass dies bei den Opfern nicht immer gut ankomme, könne er sehr gut verstehen.
Bei den kantonalen Opferberatungsstellen kennt man die Problematik. Das zeigt eine Anfrage bei der Opferhilfe Bern und der Fachstelle Opferhilfe Lantana (Bern) und Vista (Thun). Immer wieder kritisieren dort Betroffene von sexuellen Übergriffen, die Polizei sei bei der Befragung unsensibel vorgegangen. «Tatsächlich gab es Situationen, in denen es unserer Meinung nach klar war, dass die Polizei sich taktlos verhielt oder sogar Opferrechte missachtet hat», sagt Pia Altorfer, Geschäftsführerin der Opferhilfe Bern. Als Beispiel nennt sie, dass eine Betroffene keine Vertrauensperson zur Einvernahme mitnehmen durfte.
Trotzdem sieht auch sie das Problem in erster Linie beim gesetzlichen Ermittlungsauftrag der Polizei. «Die Polizistinnen und Polizisten müssen nach Beweisen suchen und sich der Sache aus einer gewissen Distanz annehmen», so Altorfer. Auch dürften sie keine persönliche Meinung äussern oder zu viel Empathie zeigen. Sie hält fest: «Für Betroffene kann diese Distanziertheit sehr schwierig sein und zu einer Retraumatisierung führen.»
Oft hätten die Betroffenen auch das Gefühl, die Polizei glaube ihnen nicht. Etwa, wenn sie von der Polizei dieselbe Frage mehrmals gestellt bekommen – einfach anders formuliert. Das habe jedoch nichts mit Misstrauen zu tun, meint Altorfer. Es gehe nur darum, den Sachverhalt möglichst genau abzuklären.
Dazu gehört auch die Frage, ob das potenzielle Opfer Alkohol konsumiert hat. «Solche Fragen können bei den Betroffenen dazu führen, dass sie die Schuld bei sich suchen», sagt Barbara Dettwiler, Leiterin der Fachstellen Lantana und Vista.
Die beiden Fachfrauen empfehlen deshalb Betroffenen von sexuellen Übergriffen dringend, vor dem Gang zur Polizei eine Opferberatungsstelle aufzusuchen.
Was die Umfrage ebenfalls zeigte: Drei Viertel der Befragten, die nach eigenen Angaben Opfer eines sexuellen Übergriffs wurden, haben diesen nicht angezeigt. Als Grund wurde häufig Scham genannt. Pia Altorfer kann das bestätigen, nennt jedoch auch andere Gründe. Sexuelle Übergriffe sind meist Vieraugendelikte, bei denen Aussage gegen Aussage steht. Die Beweislast ist schwierig, was zu einem Freispruch für den Beschuldigten führen kann. Michael Bucher