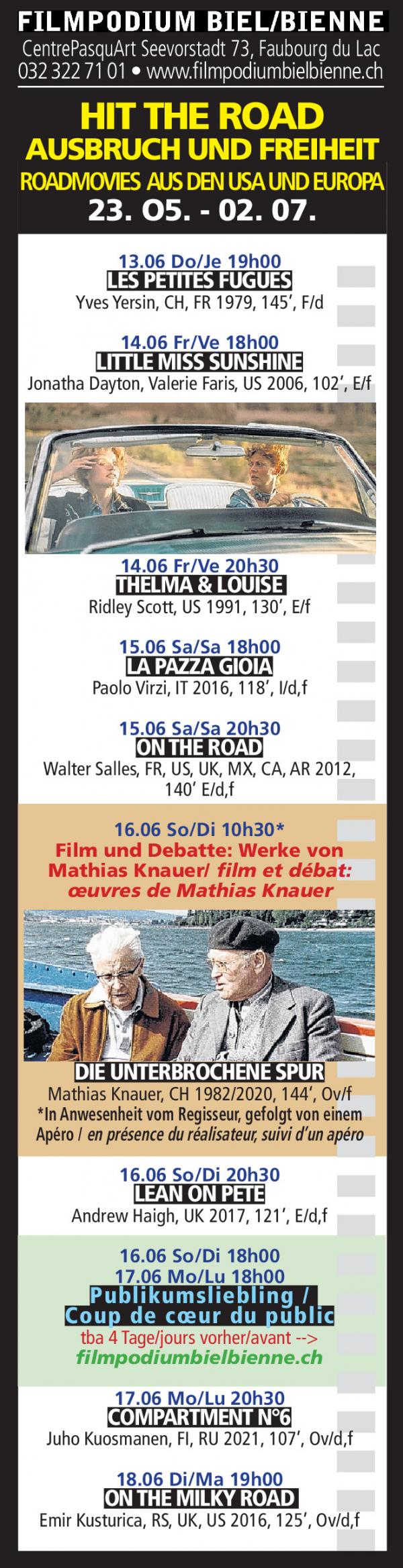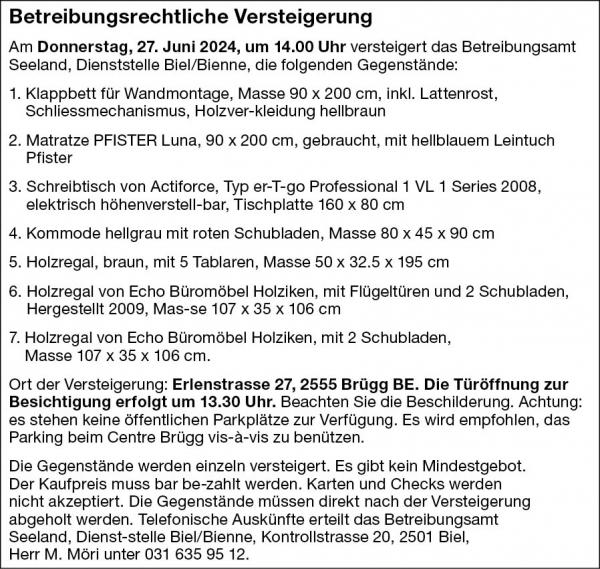Er fällt in unruhige Zeiten, unser diesjähriger Nationalfeiertag, der 1. August am Montag. Gewiss, die Schweiz ist bislang von den Verwerfungen der Zeitgeschichte grossteils verschont geblieben. Doch wirken sich die Ereignisse der vergangenen Wochen und Monate auch aufs Lebensgefühl in der Schweiz aus. Die Welt ist unsicherer geworden. Blicken wir schon nur ins benachbarte Ausland, sehen wir, wie der islamistisch motivierte Terror völlig unberechenbar zuschlagen kann. Da nützt es nichts zu argumentieren (wie dies die Tagesschau der ARD tat), die Wahrscheinlichkeit, beim Essen zu ersticken, sei höher, als bei einem Terroranschlag ums Leben zu kommen. Im Gegenteil: Solche Beschwichtigungsversuche sind nicht erkenntnisfördernd, sie ignorieren berechtigte Sorgen über die grundlegend veränderte Sicherheitslage und sind zynisch. Regional begrenzte Bedrohungslagen der Vergangenheit (etwa in Nordirland oder in Spanien) lassen sich nun mal nicht mit der heutigen Situation gegenrechnen, in der potenziell jeder «Ungläubige» zum Ziel werden kann. Auch der Vergleich von Opferzahlen bringt nicht viel: Der Attentäter von Ansbach dürfte schliesslich kaum das Ziel gehabt haben, nur sich selber in die Luft zu sprengen.
Genausowenig sinnvoll ist es aber, die durch das Newsticker- und Online-Kommentarwesen geschürte Daueraufgeregtheit zur Richtschnur politischer Forderungen oder gar des Handelns zu nehmen. Die Demokratisierung der Publikationsmöglichkeiten durch das Internet ist begrüssenswert, doch zur tieferen Kenntnis der Nutzerinnen und Nutzer trägt sie nur bedingt bei. Oft wird nicht mehr zwischen blossen Meinungen und gesicherten Fakten unterschieden, hektische Emotionalität wird wichtiger als nachdenkliche Rationalität.
Zunehmend erschallt aus diesen Stimmen der Ruf nach mehr Autorität an der Staatsspitze. In Deutschland erstarkt die Alternative für Deutschland, in Frankreich der Front National, in Ungarn und Polen hat die liberale Demokratie unter den aktuellen Regierungen einen schweren Stand. Dem russischen Modell und seinem Machthaber Wladimir Putin schlägt auch aus Mitteleuropa Sympathie entgegen; in den USA hat Donald Trump, der auf jedes komplizierte Problem eine bestechend einfache Lösung verspricht, relle Chancen, der nächste Präsident zu werden.
Das Erfolgsmodell der Schweiz jedoch besteht gerade auch darin, die Rechte und Interessen ihrer Minderheiten zu schützen und die bürgerlichen Freiheiten hochzuschätzen. Nicht der durchschlagende Wille der lauten Mehrheit herrscht, sondern im Idealfall der wohltarierte Kompromiss. Das ist langweilig und mühselig, sorgt aber für Sicherheit und Stabilität.
Wer hierzulande dagegen mit autoritären Modellen liebäugelt, der blicke dieser Tage in die Türkei. Sie bietet Anschauungsunterricht, was die starke Hand eines Präsidenten anrichten kann, der sich mit Verweis auf die Volksmehrheit hinter ihm zum Durchgreifen legitimiert sieht. Mittlerweile getrauen sich die Menschen selbst im Familienkreis nicht mehr offen zu reden, in Grossstädten müssen Passanten jederzeit mit einer Kontrolle ihres Handys rechnen, und wer zur kritischen Minderheit gehört, steht ständig unter Verdacht.
Es ist ein Extrembeispiel, gewiss. Doch es zeigt auf, wie wertvoll unser Modell der freiheitlichen Demokratie ist. Tragen wir ihm Sorge.
E-Mail: tgraden@bielertagblatt.ch
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden oder Registrieren.