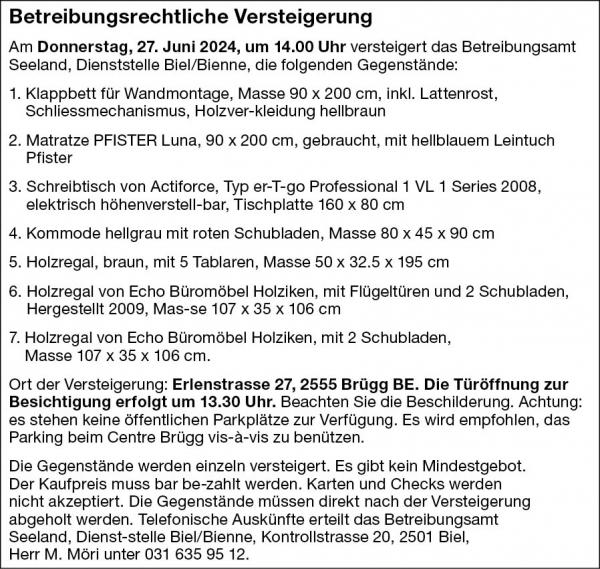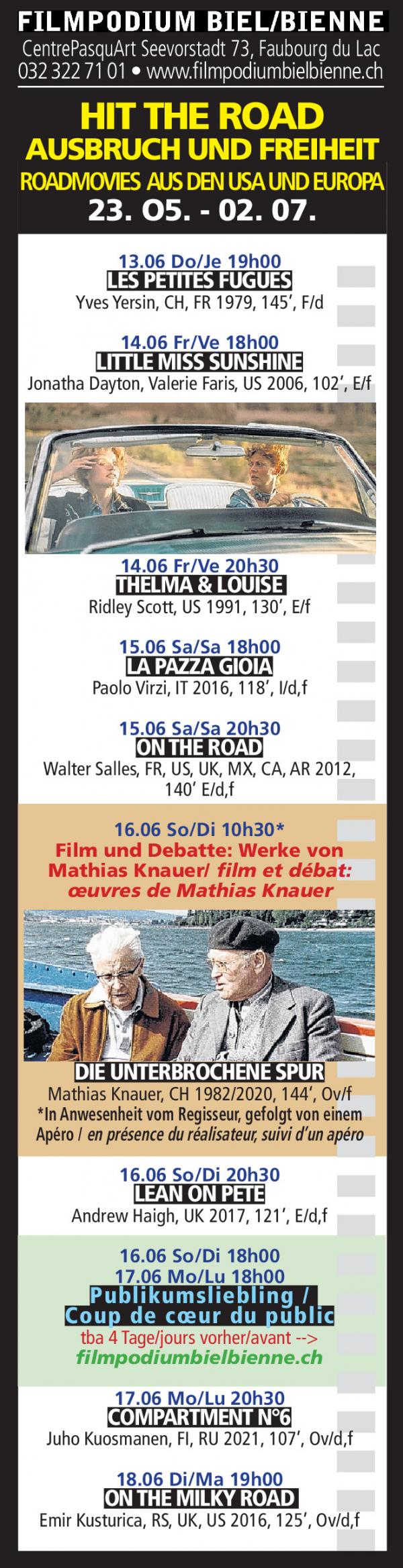Beat Kuhn
Die Strecke zwischen dem Weiler Schafis auf Gemeindegebiet von La Neuveville und Twann ist der letzte eingleisige Abschnitt auf der Bahnstrecke Biel - Lausanne. Mit dem Ausbau auf Doppelspur sowie dem Bau des 2,1 Kilometer langen Ligerztunnels wollen der Bund und die SBB dieses Nadelöhr beseitigen (das BT berichtete).
Dies hat mehrere Vorteile: Die Kapazität kann gesteigert werden, was wegen des wachsenden Verkehrs immer nötiger wird. Auch wird die Fahrplanstabilität grösser. Zudem werden die Anwohnenden künftig vor dem heute ohrenbetäubenden Lärm bewahrt. Die neue Streckenführung bringt auch einen Zeitgewinn von 25 Sekunden zwischen Neuenburg und Biel. Dadurch wird durchgehender Halbstundentakt im Regionalverkehr möglich, ohne dass der Güterverkehr beeinträchtigt wird.
Bahntrassee wird verlegt
Im Oktober haben die Vorbereitungsarbeiten für den Bahntunnel begonnen, dessen Westportal direkt neben dem gleichnamigen Autotunnel liegen wird, der seit 30 Jahren besteht. Aus diesem Anlass hat die SBB die Medien gestern zu einer Baustellenbesichtigung vor dem künftigen Tunneleingang bei Schafis eingeladen.
Derzeit wird parallel zum heutigen Bahntrassee auf einem breiten Streifen Land Humus abgetragen, sodass eine Schneise entsteht. Aus technischen Gründen können die Züge nämlich nicht vom bestehenden Trassee aus mit dem gewünschten Tempo in den Tunnel fahren. Im Abstand von ungefähr zehn Metern Richtung Bielersee wird ein neues angelegt.
Das abgetragene Erdreich, der sogenannte Kulturboden, wird nach Cornaux transportiert und dort zwischengelagert. Nach Bau-Ende wird er auf der Fläche des jetzigen Trassees wieder in den Boden eingebracht. Vor der Erdabtragung waren die dortigen Rebstöcke entfernt worden. Die dadurch verlorengehende Weinbaufläche wird nach dem Bau des neuen Trassees dort, wo sich heute das bestehende befindet, ersetzt, wie Gesamtprojektleiter Philippe Cornaz gestern versprach.
Mittelalterlicher Hafen
Für den Verkehr wichtig war der Standort des künftigen Trassees offenbar schon in früheren Jahrhunderten gewesen. So ist man bei der Erdabtragung auf einen mittelalterlichen Hafen gestossen, den der Archäologische Dienst des Kantons Bern in der Folge freigelegt hat. Laut Grabungsleiter Andreas Marti ist dessen Entdeckung indes keine grosse Überraschung, weil er auf verschiedenen historischen Karten eingezeichnet ist. Über die Jahrhunderte ist immer wieder Erdreich herbeigeführt worden, um dem See am schmalen Jurasüdfuss etwas mehr Landfläche abzutrotzen. Entsprechend ist auch die Hafenmauer mehr und mehr Richtung See verschoben worden. Bei der ersten Juragewässerkorrektion in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde der Pegel des Bielersees dann um über zwei Meter gesenkt.
Im Rahmen einer Notgrabung werden von den Ufersteinen nun 3-D-Aufnahmen gemacht. Die archäologischen Zeugnisse selbst werden nicht mehr zu sehen sein. An jener Stelle wird eine Unterführung gebaut, mit der man unter dem neuen Trassee hindurch fahren oder gehen kann.
Seit 5000 Jahren besiedelt
Laut dem Archäologen Christophe Gerber diente der Hafen dem Abtransport von Trauben, da hier schon damals Wein angebaut wurde. Zwar habe hier durchaus schon ein Weg bestanden, den man wohl auch mit Karren habe befahren können. Doch die Seen hätten allgemein grosse Bedeutung für den Warentransport gehabt. Aus gefundenen Ziegelscherben kann man laut Gerber darauf schliessen, dass in diesem Bereich des Ufers schon die Römer waren. Und man geht sogar davon aus, dass es dort bereits um 3000 vor Christus Pfahlbauten hatte.
Die SBB-Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Dezember 2026. Dann soll die neue Doppelspur in Betrieb genommen werden. Die Kosten für das Projekt, das noch weitere Punkte umfasst, belaufen sich auf 431 Millionen Franken. Das Geld dafür stammt aus dem Bahninfrastrukturfonds, den die Schweizer Stimmbevölkerung 2014 mit der Fabi-Vorlage angenommen hat.