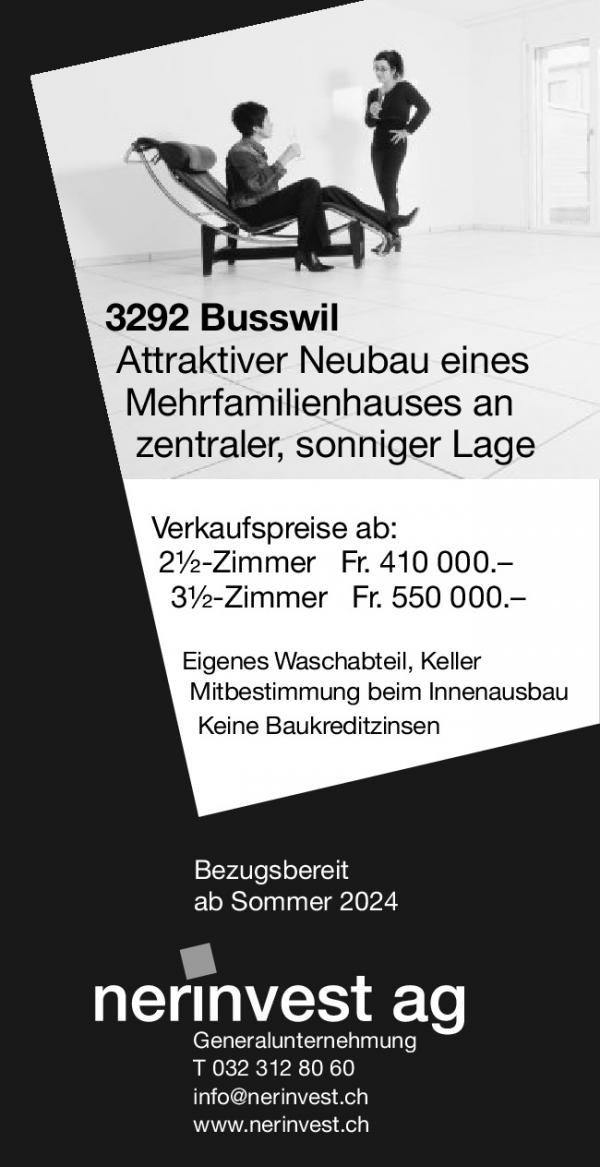Tildy Schmid
«Liebe Clare», schreibt Marie Boss im August 1945 ihrer Schwester nach Pennsylvania. Clare Young-Boss, die in der Schweiz Klara Boss hiess, wanderte 1919 als erstes ihrer zwölf Geschwister nach Amerika aus. Die schwere Wirtschaftskrise, die politische Verunsicherung oder kurz die pure Not dieser Zeit mögen die Gründe gewesen sein, weshalb insgesamt fünf Kinder der Familie Boss in die USA emigrierten.
«Weisst Du, liebe Clare, unsere Mutter sitzt wie immer abends in ihrem altväterischen Fauteuil in der Fensterecke und strickt. Ich lese ihr aus der Volkszeitung vom 11. August 1945 vor», schreibt Marie Boss in schönster Schnürlischrift an ihre Schwester. «Dann schrillt unangenehm laut die Türglocke, obwohl es schon später Abend ist», berichtet sie weiter. «Wohl eine späte ‹Tschädere oder e Lafere›, meint Mutter und widmet sich weiter ihrer ‹Lismete›.»
Im fahlen Licht vor der Haustür steht ein Soldat: «‹Kennsch mi nümme, Tante Marie?› – ‹Ja, bisch du dr Max?›, staune ich – und schon halten wir uns fest umarmt. Max geht auf Mutter zu: ‹Grosmueti, kennsch mi no?› – ‹Ja, bi Goscht, kennen i di›, schüttelt sie verwundert den Kopf.» Mager, elend, mit dunklen Schatten um die Augen steht ihr Enkelsohn Max in der warmen Stube vor ihr.
Als Halbwaise in der Schweiz
Jack Max Young, in der Schweiz schlicht Max genannt, verbrachte sechs Jahre seiner Kindheit bei seinen Seeländer Verwandten. Geboren und aufgewachsen ist er aber in Amerika. Seine Mutter Clare Young-Boss und der Vater Jack Young – auch er ein gebürtiger Schweizer, der hierzulande Jakob Jung geheissen hatte – betrieben in Erie, Pennsylvania, eine Bäckerei.
Als Jack Young an Tuberkulose erkrankte, wollte er sich in der Schweiz behandeln lassen. Seinen Sohn Max brachte er mit nach Gampelen. Eine Woche vor dem Tod des Vaters, im April 1930, erreichte auch Mutter Clare das Seeland. Als ihr Mann starb, beschloss die junge Witwe schweren Herzens, ihren Sohn vorerst bei ihren Eltern und der Schwester zu lassen. Selbst kehrte sie in die USA zurück, um Geld zu verdienen.
Als Max 14 Jahre alt war, zog er mit seinen Grosseltern Anna Maria und Johann Boss-Jampen sowie mit Tante Marie von Gampelen ins neu erbaute Haus am Rebstockweg 38 in Ins. Dort lief für ihn weiterhin alles gut: Gern ging er bei Lehrer Probst in die Schule, hatte den Plausch mit den Inser Kameradinnen und Kameraden.
Mutter wollte ihn schützen
Doch dann, im Jahr 1939, wurde die Schweiz immer stärker mit den Auswirkungen der nationalsozialistischen Bedrohung konfrontiert, und man begann mit dem Bau der Schweizer Réduit. Da verlangte Mutter Clare, dass Max, begleitet von Tante Marie, wieder zu ihr nach Pennsylvania komme. Sie wollte den Jungen vor dem drohenden Krieg in Europa schützen.
Die aufreibende Plackerei für die Abreise und das Abschiednehmen drückte allen aufs Gemüt. Den Inser Schulkameraden und auch dem Frauenchor, dessen Mitglied Tante Marie war, fiel das Abschiednehmen schwer.
Lehrer Probst kam mit seinen Schülerinnen und Schülern, um Max zu Ehren zum Abschied zu singen. Mit dem beruhigenden Gefühl der schweizerischen Zugehörigkeit traten Marie Boss und der 14 Jahre alte Max im Juli 1939 schliesslich die Reise an: Mit dem Zug ging es ins französische Cherbourg und von dort mit dem Dampfschiff «Bremen» nach New York.
Vom Krieg wurde Jack Max Young allerdings nicht verschont. 1943 wurde er in die US-Armee eingezogen und musste mit den Alliierten in Italien in härtesten Schlachten gegen die deutsche Wehrmacht kämpfen.
Im August 1945 nutzt er einen einwöchigen Urlaub, um Grossmutter und Tante in den alten Heimat zu besuchen. Anschliessend muss er wieder in seine Infanterieeinheit innerhalb der Fünften US-Armee in Italien einrücken. Endgültig aus der US-Armee entlassen wird er erst im Spätherbst 1945.
«Allzu Schreckliches erlebt»
«Es isch nümm glych wie früecher», sagt Max und schaut sich in der Stube um. Tante Marie braut Kaffee, brät Eier und Speck, und die Familie sitzt zusammen. «Max sieht viel zu ernst, viel zu müde, hager, verfroren und elend aus», berichtet Marie ihrer Schwester. «Wie gsesch o us, du bisch doch ersch zwänzgi?», fragt denn auch die Grossmutter. Hoffnungslos, traurig, deprimiert und krampfhaft Tränen schluckend sagt er: «Wir haben allzu Schreckliches erlebt.»
Es schmerzt die Familie, ihn so zu sehen und zu hören. «Wir mussten tage- und nächtelang unvorstellbare Ängste und Schrecken durchstehen, und trotzdem hiess es immer: vorrücken, kämpfen.» Zwar ist Max‘ Bett in seinem ehemaligen Stübli schon bereit. Doch noch ist niemandem nach Schlafen zumute. Stockend und immer wieder nach Fassung ringend erzählt der 21-jährige Max von den grausamen Kriegserlebnissen. Marie Boss ist sich der aussergewöhnlichen Situation bewusst und schreibt alles sorgfältig auf.
Anfangs herrschte Euphorie
«Alles begann mit einer grossen Euphorie», erzählt Max. Seiner 13-wöchigen Infanterie-Rekrutenschule in Alabama seien 1943 acht Wochen Manöver in Mississippi gefolgt. «Das Soldatenleben und die fröhliche Kameradschaft gefielen mir sehr», erinnert er sich.
Im August kam die Überfahrt nach Nordafrika. «Wir Boys, die meisten rund 19-jährig, machten uns kühne Hoffnungen auf tapfere Heldentaten: Wir fühlten uns kräftig, mutig, kampfbereit. Unsere Einheit landete mit Transportflugzeugen in Casablanca, Marokko. Wenige Tage später kamen wir an die Front.»
Kaum 22 Stunden an der Front, musste er sich wehren und den ersten Feind, einen Deutschen, erschiessen. «Im ersten Moment, Auge in Auge mit ihm, war ich vor Schreck wie gelähmt. Er legte auf mich an und schoss. Da überfiel mich eine ungeheure Wut, und ich schoss zurück. Unbeherrschbares Zittern fuhr mir durch die Glieder, nahm mir den Atem. Nie waren der Deutsche und ich uns begegnet, nichts hatten wir einander zuleide getan ... und doch hiess es nun: er oder ich.»
Max bekam den riesigen Unterschied zwischen der militärischen Ausbildung und der Realität zu spüren: «Einst zielten wir auf Scheiben, freuten uns an Volltreffern – doch die Wirklichkeit ist komplett anders. Welche Häme, welcher Sarkasmus zum Bibelwort ‹Du sollst nicht töten›.»
Gleich in den ersten Kampftagen verlor er seinen Freund. Dieser wurde von der Wache von einem Kameraden abgelöst und legte sich im Schützengraben im Schlafsack zur Ruhe. Keine halbe Stunde später fiel eine feindliche Handgranate in den Unterstand und brachte die bereit liegenden Handgranaten zur Explosion.
«Wir eilten hinzu. Er lag tot im Schlafsack. Ergriffen, unfähig zu weinen, hilflos standen wir da.» Nun wollten die Kollegen Rache und kämpften von da an verbissen: Fiel ein Feind, freuten sie sich.
Schlacht am Monte Cassino
Nach der Invasion in Sizilien ging es nach Salerno und dann weiter nach Neapel, Caserta und Cassino. Der schlimmste Kampf entbrannte um den Monte Cassino. Die US-Kommandeure meinten, dass Deutsche ein Land, das nicht das ihre sei, kaum allzu stark verteidigen würden.
Doch entgegen dieser Annahme hatten sich die Deutschen in den Gängen des Klosters verbarrikadiert und eine nahezu uneinnehmbare Festung errichtet. Tollkühn kletterten die Soldaten, praktisch ungedeckt, den Berg hinauf, um die Festung, Meter um Meter kämpfend, einzunehmen. «Doch wie von Teufelshand warfen sich uns immer wieder neue Deutsche entgegen, und ein unvorstellbares Gemetzel begann», sagt Max mit brechender Stimme.
Sie sahen aus wie Räuber
Die Schlacht um den Monte Cassino dauerte vom 17. Januar bis zum 18. Mai 1944. «Die grauenvollen Bilder werden in mir nie mehr verblassen. Ich habe die tapfersten Männer schmerzvoll weinen sehen. Viele haben in höchster Not und Lebensgefahr wieder beten gelernt.» Es bleibt still in der Stube am Rebstockweg. Nur die Uhr tickt und tickt.
Wochenlang konnten sich die Soldaten weder waschen noch rasieren, sie sahen aus wie Räuber. Die Verpflegung bestand aus Konserven und Biskuits, selten gab es Warmes, denn jedes Feuer hätte sie verraten. Der Hügel war gut ausgebaut. Unterirdische Gänge führten kreuz und quer zu Räumen und Zimmern. Die Deutschen bewegten sich bestens geschützt wie Maulwürfe in ihren Gängen.
«Wir machten sogenannte Molotow-Cocktails. Füllten Bierflaschen mit Benzin und befestigten Zündkapseln», schildert Max das Vorgehen. Fünf Sekunden nach dem Aufprall explodierten die Wurfgeschosse, das Benzin verspritzte und fing Feuer. «So gelang es uns schliesslich, den Feind ‹auszuräuchern›.»
Unsäglich müde machte dieses schreckliche Morden. Die Atempause bedeutete: zwei Stunden Schlaf an einem sicheren Ort, ohne Angst, im Schlaf erschossen zu werden.
Im Mai 1944 rückte die Einheit vom Niemandsland Castelforte nach Rom vor. Das stete Vorrücken nährte die Hoffnung auf ein Ende dieses schrecklichen Krieges. Am 4. Juni 1944 zog die 5. US-Armee in Rom ein.
Schwer verwundet
Am 12. Juli 1944, exakt fünf Jahre nach Max‘ Ausreise aus der Schweiz in die USA, wurde er bei der Einnahme eines Berges südlich von Florenz schwer verwundet. Kugeln einer feindlichen Maschinengewehrsalve hatten ihn am Kinn gestreift. «Ich war wohl zu aufrecht den Berg hinaufgekrochen, hätte mich ducken sollen», sagt er und erwähnt, wie die Kameraden ihm einen Notverband anlegten und ihn zum Sanitätswagen brachten.
Der Fahrer startete den Wagen, überfuhr eine Mine, die augenblicklich explodierte. Das Auto machte einen Sprung, Splitter und Scherben flogen durch die Luft. «Wir schrien allesamt vor Entsetzen. Ich sprang mit einem Satz zur Hintertür hinaus, wurde durch herumfliegende Splitter am ganzen Körper schwer verwundet», berichtet er und zeigt auf seine Arme. Neben dem toten Fahrer und dem daneben sitzenden Sanitätssoldaten lagen die anderen stöhnend umher, bis die Kameraden des zweiten Sanitätswagens sie aufnahmen und ins Spital nach Rom brachten.
Zwei Tage war Max blind. Unzählige Splitter steckten in seinem Gesicht. Elf Wochen lag er im Spital, erhielt pro Tag acht Penizillin-Injektionen, die sich auf 110 Injektionen summierten. «Ich überstand auch das, kam nach einer Woche Erholungsurlaub in Rom gesundheitlich einigermassen wieder auf die Beine.» Dann wurde er wieder an die Front beordert.
Seltene schöne Momente
Die allerliebsten Augenblicke von Max waren während des Kriegs das Auspacken der Pakete, das Lesen der Briefe seiner Mutter Clare. Wie oft bat er dann, im Innersten aufgewühlt, seine Mutter um Verzeihung. «Ich war nicht immer ein lieber Bub, doch wenn es mir vergönnt ist zurückzukehren, heim zu dir, dann soll es anders sein», versprach er in Gedanken unzählige Male.
Das Heimweh plagte Max schrecklich. Er und all seine Kameraden fühlten sich entsetzlich müde, kriegsmüde.
Ende des Grauens
Max war mit seiner Einheit unterwegs in Richtung Verona und Brennerpass, als sie die Nachricht erreichte, dass Deutschland bedingungslos kapituliert habe. Ein unbeschreibliches Glücksgefühl und Aufatmen machte sich breit. Das Ende des Grauens war in Sicht.
Doppelt dankbar versuchten die Soldaten, ihr Quartier auf dem Brennerpass, die Alpweiden, Berge, Frühlingsblumen und den Sonnenschein zu geniessen. Doch das schreckensvolle Vergangene quälte die Gemüter, liess sich nicht wegschieben. Im Chaos des Kampfes hatte das Nachdenken keinen Raum, umso stärker kam nun alles zum Vorschein.
«Vor sechs Jahren musste ich vom Seeland und von Ins Abschied nehmen. Sechs Jahre, in denen ich die schwerste Zeit meines Lebens durchzustehen hatte. Ich weiss, es ging nicht nur mir so – doch dieses Wissen hat nichts Tröstliches an sich», versichert Max seufzend.
Alle wollten Max sehen
In Ins machte der Besuch von Max wie ein Lauffeuer die Runde. «Nachbarn, frühere Freunde ‹chöme z‘gumpe›», wie Marie ihrer Schwester berichtet, und alsbald drängen sich auch einstige Schulkameraden in der Stube. Der Pflichtbesuch bei Lehrer Probst ist Ehrensache. «Zum Znacht holt Max, ganz wie einst als Bub, Milch in der Käserei. ‹Käsers Hans› habe ihn aus lauter Freude umarmt, erzählt er uns, und erstmals hörten wir ihn lachen.»
Anderntags kündet die Nachbarin Marie Köhli den Besuch eines weiteren Amerikaners an. Es ist Max‘ Cousin Eddie Miller, der als Funker für die amerikanische Armee in Frankreich Kriegsdienst leistet. Die beiden freuen sich riesig, einander nach drei Jahren wieder zu sehen.
«Zum Zmittag gib es Bohnen und ‹es saftigs Laffli›. Ich ergatterte das Fleisch mit Geld und guten Worten, denn die meisten Lebensmittel sind ja, wie Du weisst, immer noch rationiert», erzählt Marie Boss in ihrem Brief an Clare.
Er arbeitete für «Minuteman»
Zurück in der Heimat wurde Max Maschinenschlosser. Als vielfältig begabter Mann stellte er Einzelteile für die «Minuteman», eine dreistufige US-Interkontinentalrakete, und für Spezialprojekte her.
Er heiratete 1952 Sylva Hermann in New York. Sylva wurde ursprünglich auf den Namen Silvia getauft – auch ihre Eltern waren einst aus der Schweiz in die USA ausgewandert, wo sie eine Familie gründeten.
Sylva und Max Young lebten mit ihren Söhnen Chris und Mitchell in Van Nuys, Kalifornien. Später machte Max sich mit einer mechanischen Werkstätte in Rogue River, Oregon, selbstständig. Am 17. Februar 1999 starb er unerwartet an den Folgen eines Herzinfarktes im Spital.