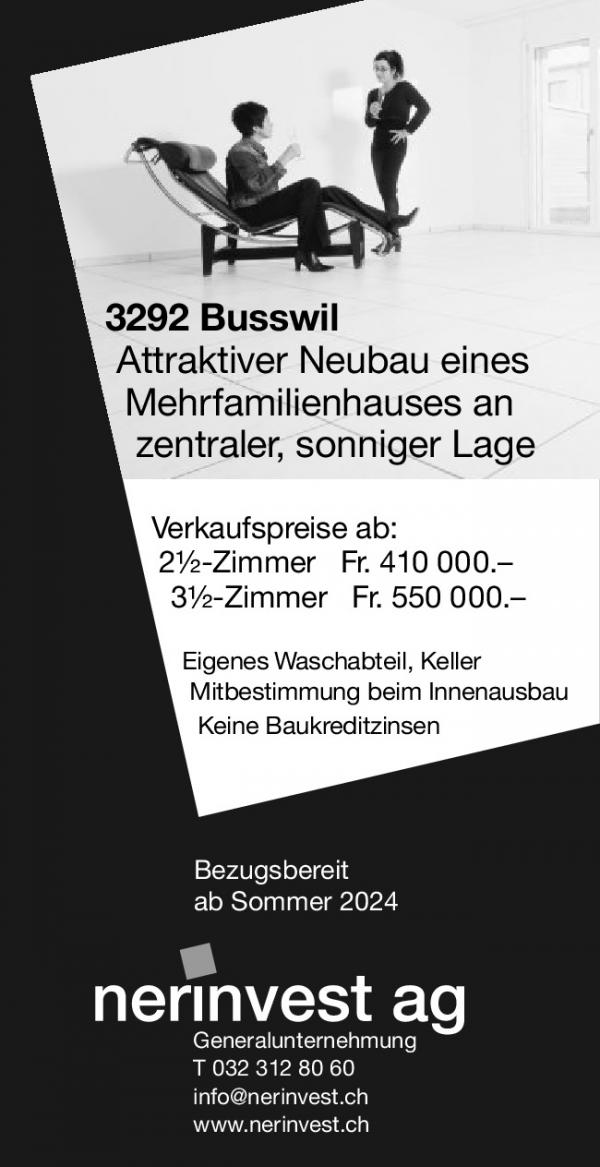Matthias Knecht
Flüchtlinge als Waffe gegen den Westen einsetzen. Genau dies tut der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko, und sein Tun ist zynisch und abscheulich. Er hat Tausende Menschen aus dem Irak, aus Syrien und anderen Krisenländern an die Grenze zu Polen geschafft. Lukaschenko nutzt die Not von Menschen, um eine Drohkulisse an der Aussengrenze der EU aufzubauen. Es ist mehr als eine Kulisse. Die Flüchtlinge versuchen, mit Gewalt die stark gesicherte Grenze zu durchbrechen. Lukaschenko soll ehemalige Kämpfer aus Afghanistan und Irak angeheuert haben, um die Eskalation an der Grenze anzufeuern. Dies berichtete ein inzwischen geflüchteter belarussischer Botschafter.
Tatsächlich sind viele Flüchtlinge gut ausgerüstet: mit Drahtzangen und Knallgranaten. Im Militär nennt man so etwas einen hybriden Angriff. Diesen Begriff haben die sieben führenden Industrieländer diese Woche in einer gemeinsamen Erklärung verwendet. Ihr Vorwurf: Lukaschenko, der letzte Diktator Europas, greift nicht mit der eigenen Armee an. Er lässt andere den Angriff durchführen und unterstützt sie dabei. Er setzt verzweifelte Menschen als Kriegswaffe ein. Das ist abstossend und verwerflich.
Doch abstossend ist auch, wie sich das zivilisierte Europa militärisch gegen Flüchtlinge wehrt. Für 350 Millionen Euro hat die EU die Grenze zu Belarus mit Stacheldraht gesichert. Dazu kommen Bilder von polnischen Grenztruppen, die mit Wasserwerfern und Tränengas gegen Asylsuchende vorgehen. Polnische Grenzer prügeln die Menschen nach Belarus zurück. Eine schwangere Frau sollen sie gar über den Grenzzaun geworfen haben, worauf sie ihr Kind verlor. Soll das das Europa der Menschlichkeit sein?
Auch wenn Lukaschenko die Situation provoziert hat, so müssen wir doch einsehen, dass wir selbst die Voraussetzungen dafür geschaffen haben, mit einer Flüchtlingspolitik, die zynische Züge trägt. Wir, das sind die westlichen europäischen Länder, die Schweiz eingeschlossen. Ob EU oder nicht, spielt keine Rolle. Durch den Schengenraum – die offenen Grenzen mit unseren Nachbarn – sind wir miteinander verbunden und müssen darum auch eine gemeinsame Asylpolitik finden.
Zynisch daran ist, dass wir das Recht auf Asyl versprechen, wie es die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 fordert, zugleich aber alles tun, damit möglichst niemand dieses Recht einfordern kann. Das geschieht, indem gewisse Nachbarstaaten der EU die nicht sehr feine Aufgabe übernehmen, die Flüchtlinge aufzuhalten. So können diese erst gar nicht die Schengengrenze – und damit auch die Schweizergrenze – erreichen.
So gesehen ist Lukaschenko nur ein Baustein im Schutzwall, der die Wohlstandsinsel Westeuropa umgibt. Der Schutzwall, das sind Vasallenstaaten – oder nennen wir sie Schurkenstaaten? – welche die Drecksarbeit erledigen. Dafür bekommen sie etwas von unserem Reichtum ab.
An erster Stelle in diesem System steht nicht Belarus, sondern die Türkei. Wir erinnern uns: 2015, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, hofierte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel den türkischen Machthaber Recep Tayyip Erdogan, die EU machte drei Milliarden Euro locker, und siehe da, die Flüchtlingskrise war beendet. Plötzlich kamen die Menschen nicht mehr über die Türkei hinaus.
Erdogan weiss seither, dass er tun kann, was er will, solange er Europa die Flüchtlinge vom Hals hält. Genau so regiert der Despot vom Bosporus auch sein Land. Wann immer jemand in Europa es wagt, Erdogan zu kritisieren, schickt dieser wieder einige Hundert Flüchtlinge übers ägäische Meer – und schon ist wieder Ruhe im Karton.
An zweiter Stelle in diesem System steht Marokko. Es tut alles, damit kein Migrant die spanische Grenze erreicht. Dafür pflegt Spanien sehr freundschaftliche Beziehungen mit dem Land, das nicht gerade als Vorreiter der Demokratie gilt. Kürzlich wagte es Spanien, Marokko beim Thema Westsahara-Konflikt zu verärgern. Prompt stürmten 8000 Flüchtlinge den spanischen Grenzzaun in der Exklave Ceuta. Dieser ist dank EU-Finanzierung sechs Meter hoch und ebenfalls mit Stacheldraht versehen, was aber nicht ausreicht, um das Elend von Europa fernzuhalten.
Die Regierung in Madrid schäumte angesichts der marokkanischen Politik, sprach von Zynismus und Erpressung. Dann gab Verhandlungen im Hintergrund – und es war wieder Ruhe an der Flüchtlingsfront.
Weitere Länder sind in das europäische Abwehrdispositiv gegen Flüchtlinge eingebunden, etwa Niger oder Mali, nach der Flüchtlingskrise 2015 eingefädelt von Angela Merkel, der Krisenverhandlerin par excellence.
Man kann dies alles Realpolitik nennen. Doch die Realpolitik hat reale Folgen bei den Nachbarn Europas: Autoritäre Regimes werden durch diese Politik gestützt.
Wie sehr Europa davon abhängt, von Autokraten, Tyrannen und Diktatoren umgeben zu sein, zeigte sich nach dem Sturz von Libyens Diktator Muammar al-Gaddafi im arabischen Frühling. Niemand hielt mehr die Flüchtlinge davon ab, über das Mittelmeer Richtung Italien überzusetzen, und so schwollen die Flüchtlingsströme dramatisch an. Auch hier haben Italien und die EU inzwischen eine Lösung gefunden. Wie sie genau aussieht – niemanden interessiert es. Hauptsache, die Flüchtlinge kommen nicht. Auch das ist zynisch.
Zurück zu Lukaschenko. Natürlich wird und muss die EU mit Realpolitik reagieren. Mit Sanktionen und Angeboten, mit Zuckerbrot und Peitsche. Die scheidende deutsche Kanzlerin hat diese Woche zwei lange Telefonate mit Lukaschenko geführt. Laut dessen Regierung wurde bereits eine Lösung gefunden: 2000 Flüchtlinge dürfen demnach in die EU weiter; 5000 weitere schafft Belarus in ihre Herkunftsländer zurück. Bereits wurde ein Lager nahe der Grenze geräumt.
Die deutsche Regierung dementierte gestern allerdings diese Darstellung. Ob die brandgefährliche Situation wirklich entschärft wurde, ist im Moment also nicht klar.
Klar ist: In einer Krisensituation wie der aktuellen wäre eine solche Lösung grundsätzlich gut. Der Merkelpragmatismus würde eine Eskalation der Gewalt verhindern.
Doch langfristig reicht diese Realpolitik nicht. Es wird weitere Lukaschenkos geben – autoritäre Machthaber mit dem Rücken zur Wand –, die jede Chance nutzen, um Westeuropa vorzuführen.
Wenn wir uns nicht mehr vorführen lassen wollen, dann müssen wir unsere Flüchtlingspolitik ändern. Denn das jetzige System gewährt nur denjenigen Schutz, die es bis auf das Territorium ihres Ziellandes gelangen, meist Deutschland, manchmal auch die Schweiz. Ein solches System belohnt diejenigen, die besonders dreist sind, so wie aktuell an der polnischen Grenze, oder diejenigen, die genügend Geld für Schlepper haben. Das sind aber nicht zwangsläufig diejenigen Personen, die unseren Schutz am nötigsten haben.
Dem Geist der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 wird damit längst widersprochen. Der Soziologe Steffen Mau, der ein Buch über moderne Grenzkontrollen veröffentlicht hat, spricht von Doppelmoral in der europäischen Flüchtlingspolitik. Je mehr Westeuropa auf Stacheldraht und Wasserwerfer setzt, um Asylsuchende abzuwehren, desto mehr verletzt es die Werte, für die Europa steht.
Der Forscher schlägt darum vor, die Asylgewährung radikal zu ändern, etwa mit Anträgen im Herkunftsland, mit Kontingenten und anderen Modellen. Asyl würde damit nicht mehr jedem gewährt, und doch würden mehr Menschen Schutz erhalten, die ihn wirklich brauchen. Eine solche Asylpolitik wäre glaubwürdiger. Sie würde Schleppern die Geschäftsgrundlage schmälern. Vor allem aber wäre Westeuropa nicht mehr auf Lukaschenkos und Erdogans an den Grenzen angewiesen.
Wie diese glaubwürdige Flüchtlingspolitik der Zukunft genau aussieht, wird eine der grossen Fragen sein. Die Schweiz wäre gut beraten, sich einzubringen – und sich nicht darauf zu verlassen, dass es die EU schon richten wird. Denn diese ist viel zu sehr mit Realpolitik beschäftigt.